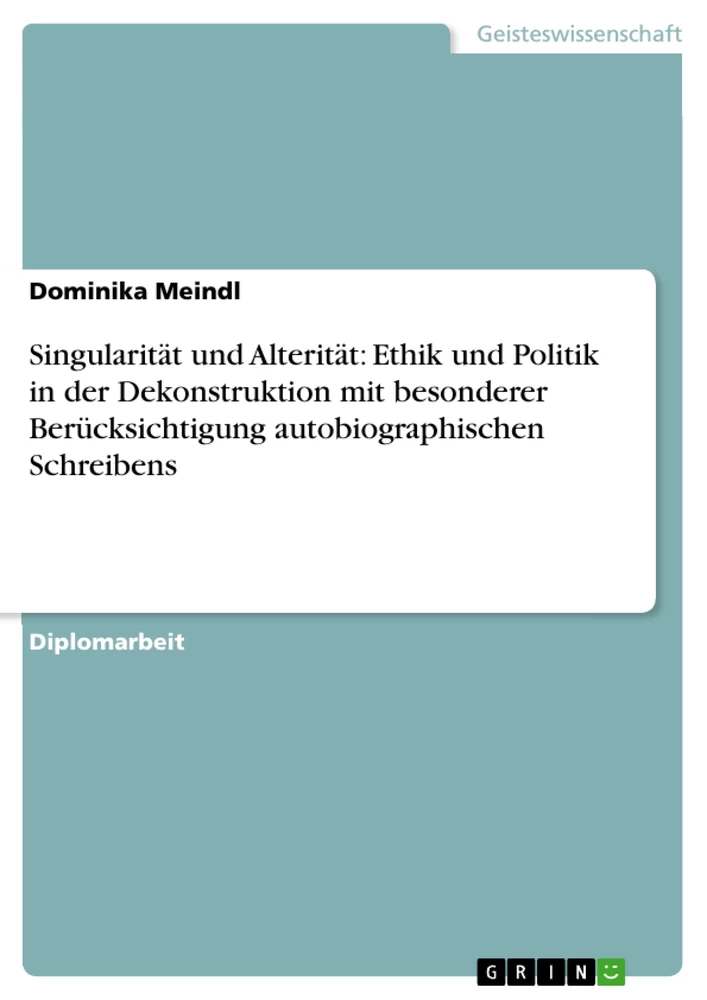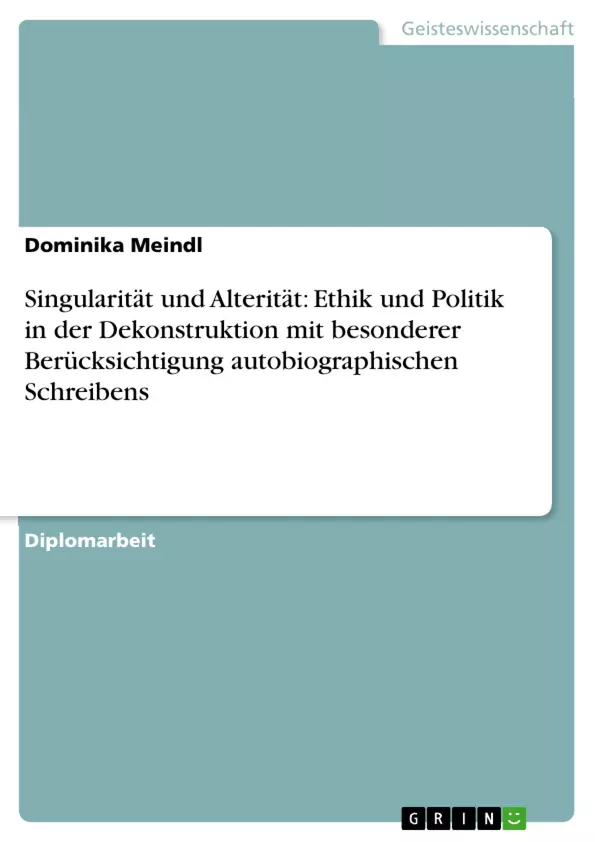Im Mittelpunkt dieser Diplomarbeit steht die kritische Auseinandersetzung mit der Dekonstruktion im Sinne Jacques Derridas unter Berücksichtigung theoretischer Positionen, die sich mit verschiedenen von Derrida problematisierten Themen beschäftigen. Das Hauptaugenmerk liegt auf entsprechenden Texten von Rodolphe Gasché, Jürgen Habermas, Richard Rorty, Stanley Cavell und John Caputo. Einer der Gesichtspunkte, unter dem diese Positionen ausgewählt worden sind, ist die Frage nach der öffentlichen Relevanz der Dekonstruktion. Eine erste Leitfrage ist in weiterer Folge diejenige, in welchem Ausmaß die Dekonstruktion eine mögliche Grundlage für ethische und politische Analysen bilden kann. Im Zuge dieser Aufgabenstellung gilt es zu klären, inwieweit die Dekonstruktion in den klassischen Begriff „Philosophie“ noch zu integrieren ist, und in welchem Verhältnis sie zur Literaturkritik steht, der sie zuweilen zugerechnet wird. Will man, so lautet eine erste Behauptung, die Dekonstruktion für ethische und politische Fragestellungen öffnen, so muss man sie der Philosophie (wieder) annähern. Die zweite wichtige Frage ist die nach dem möglichen Inhalt ethischer und politischer Ansprüche der Dekonstruktion. Es gilt in diesem Sinne die Annahme zu begründen, dass dafür die Anerkennung der Singularität des Fremden und Anderen bzw. das Bemühen um eine nicht-aneignende Haltung gegenüber der Alterität eine wesentliche Voraussetzung darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung und Herangehensweise
- Gasché: "A system beyond being"
- Reflexivität ohne Ursprung
- Heterologie
- Infrastrukturen
- Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne
- Die Unaufhebbarkeit der Rationalität...
- Die poststrukturalistische Literaturkritik.
- Derridas ästhetischer Kontextualismus.
- Rorty: Pragmatismus und Dekonstruktion
- Kontextualisierung
- Gemeinsame Ausgangsposition.
- Rortys Einwände gegen die Dekonstruktion: Die Sprache als Quasi-Subjekt...........
- Derrida und seine amerikanischen Bewunderer..
- Culler: Die Praxis der Dekonstruktion in der Literaturwissenschaft.
- Rortys Kritik an Gasché...\n.
- Liberale und Ironiker - Derrida und Habermas..
- Die Dekonstruktion als privates Projekt.……………………...\n
- Derrida I und Derrida II.
- Private Autonomie und öffentliche Problemlösungsarbeit.
- Rorty über Derridas Autobiographie..
- Bemerkungen zu Gasché, Habermas und Rorty
- Die Quasi-Transzendentalität der Dekonstruktion (Derrida und Gasché)
- Die Unverzichtbarkeit der transzendentalen Frage...\n.
- Einwände und eigene Bemerkungen zu Gasché...\n.
- Die Dekonstruktion der Gattungsgrenzen (Derrida und Habermas)..\n
- Philosophie und Literatur..\n.
- Einwände und eigene Bemerkungen zu Habermas.
- Singularität und Dekonstruktion (Derrida und Rorty).
- Dekonstruktion und Pragmatismus.......\n
- Einwände und eigene Bemerkungen zu Rorty..\n
- Ethik und Politik der Dekonstruktion
- Falsche Lektüren.
- Zum quasitranszendentalen Status der „magic words”
- Der Diskurs über den Parasiten….........
- Die Bestimmung des Kontexts als politischer Akt...\n
- Radikale Alterität als ethisches Motiv.
- Cavell: A Pitch of Philosophy.....
- Die Verteidigung der Philosophie der gewöhnlichen Sprache.
- Die Unterdrückung der Stimme durch den Skeptizismus
- Die Autobiographie als möglicher Ort der Philosophie .\n
- Cavell und Derrida...\n
- Die Dekonstruktion der Autobiographie: Circumfession
- Autobiographie als Strategie der Dekonstruktion
- Autobiographie und Erinnerung.
- Autobiographie und Entfremdung .....
- Autobiographie und das Warten auf den Anderen.....
- Autobiographie als nicht-privates Philosophieren ......
- Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen ……………………..\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Dekonstruktion als philosophischem Ansatz und ihrer Bedeutung für Ethik und Politik. Sie untersucht, wie die Dekonstruktion die traditionellen Grenzen zwischen Philosophie und Literatur, Theorie und Praxis, Subjekt und Objekt auflöst. Dabei wird insbesondere auf den Zusammenhang zwischen Dekonstruktion und autobiographischem Schreiben eingegangen.
- Die Dekonstruktion als philosophische Methode
- Der Einfluss der Dekonstruktion auf Ethik und Politik
- Die Rolle der Autobiographie in der Dekonstruktion
- Die Bedeutung von Singularität und Alterität in der Dekonstruktion
- Die Kritik an traditionellen philosophischen Konzepten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Fragestellung und die Herangehensweise. Kapitel 1 analysiert das Werk von Gasché und seine Konzeption von "A system beyond being". Kapitel 2 beleuchtet Habermas' Theorie des philosophischen Diskurses der Moderne. Kapitel 3 beschäftigt sich mit Rortys Kritik an der Dekonstruktion und untersucht die Beziehung zwischen Dekonstruktion und Pragmatismus. Kapitel 4 befasst sich mit der Kritik an Gasché, Habermas und Rorty. Kapitel 5 untersucht die ethischen und politischen Implikationen der Dekonstruktion. Kapitel 6 analysiert Cavells Werk "A Pitch of Philosophy" und seine Verbindung zur Dekonstruktion. Kapitel 7 schließlich untersucht die Dekonstruktion der Autobiographie und ihre Rolle im Denken von Derrida.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Dekonstruktion, Ethik, Politik, Autobiographie, Singularität, Alterität, Philosophie, Literatur, Pragmatismus, Transzendentalität und Kontextualisierung. Sie analysiert die Werke von Jacques Derrida, Rodolphe Gasché, Jürgen Habermas und Richard Rorty sowie Stanley Cavell.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel von Jacques Derridas Dekonstruktion?
Die Dekonstruktion zielt darauf ab, festgefahrene Strukturen und Gegensätze in Texten und im Denken aufzulösen, um verborgene Hierarchien und Voraussetzungen freizulegen.
Wie hängen Dekonstruktion und Ethik zusammen?
Die Dekonstruktion fordert eine Anerkennung der Singularität des Anderen und eine Offenheit gegenüber dem Fremden (Alterität), was als ethische Grundlage dient.
Welche Rolle spielt die Autobiographie in Derridas Denken?
Autobiographisches Schreiben wird als Strategie genutzt, um die Grenzen zwischen privatem Philosophieren und öffentlicher Theorie zu verwischen.
Was kritisiert Habermas an der Dekonstruktion?
Habermas sieht in der Dekonstruktion eine Verwischung der Gattungsgrenzen zwischen Philosophie und Literatur und warnt vor einem Verlust an rationaler Argumentationskraft.
Was bedeutet „Alterität“ in diesem Kontext?
Alterität bezeichnet die radikale Andersheit des Anderen, die nicht durch bestehende Begriffe oder Konzepte vollständig angeeignet werden kann.
- Quote paper
- Mag. Dominika Meindl (Author), 2004, Singularität und Alterität: Ethik und Politik in der Dekonstruktion mit besonderer Berücksichtigung autobiographischen Schreibens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55453