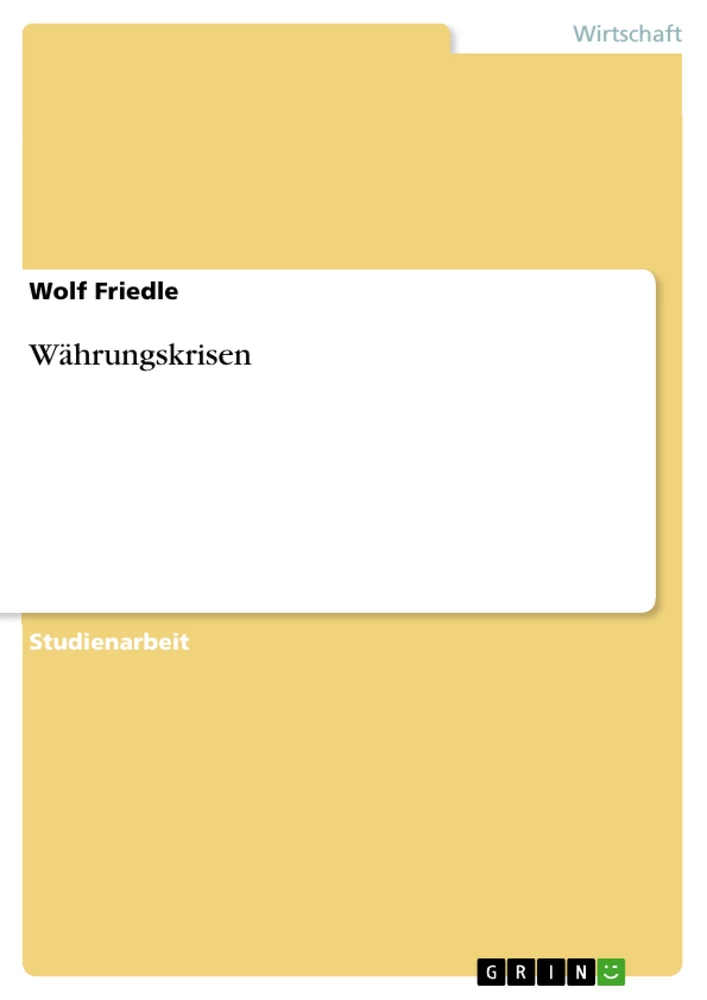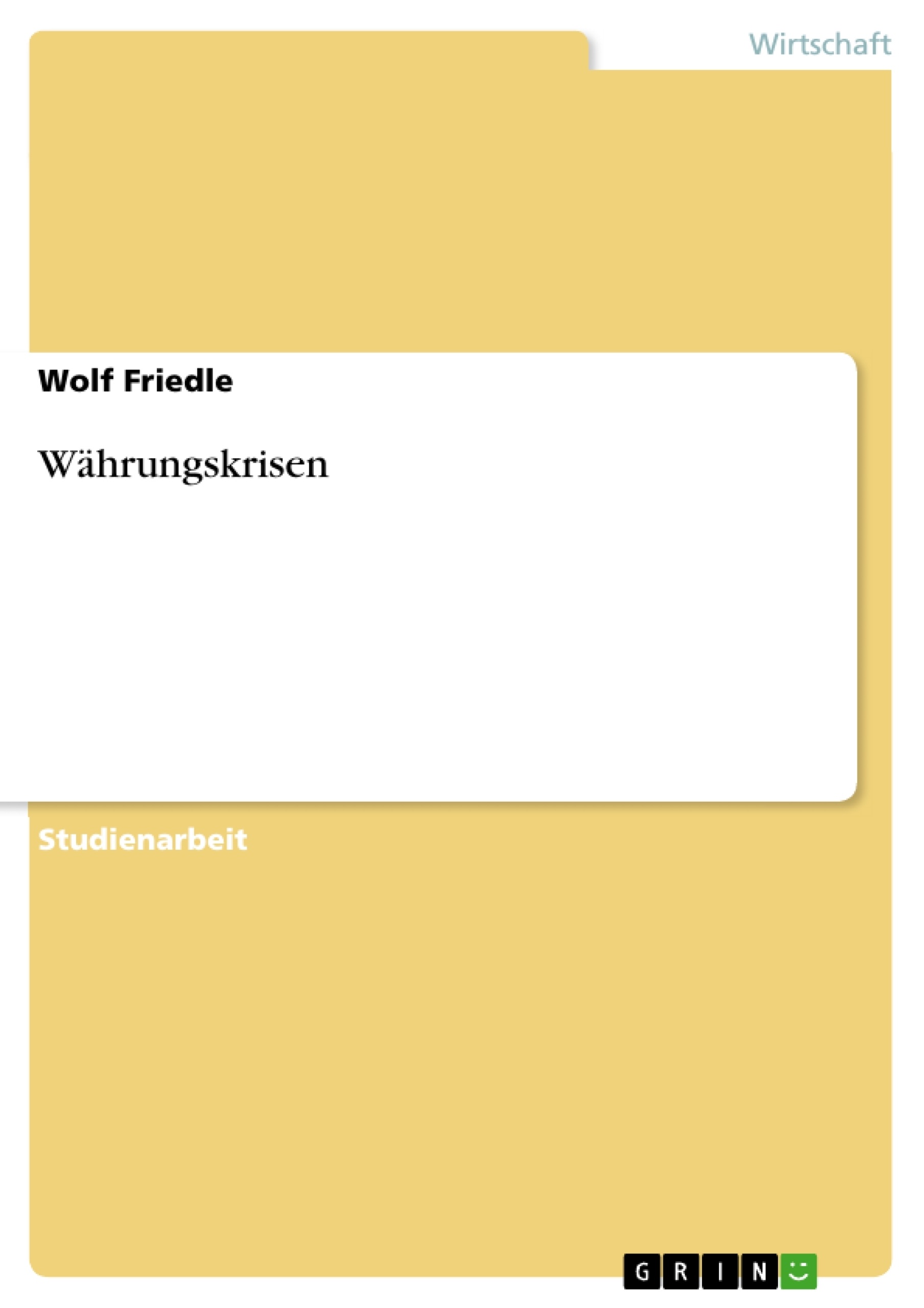Stellen sie sich vor, sie seien Bürger eines Landes das von einer unvorhergesehenen Währungskrise getroffen wird. Normalerweise werden sie ihr Vermögen in heimischer Währung angelegt haben. Abends kommen die ersten Meldungen im Fernsehen, die einen dramatischen Verfall der Landeswährung beschreiben. Banken schließen, um noch schlimmeres zu verhindern. Sie müssen untätig zusehen, wie ihr Vermögen drastisch an Wert verliert.
In Deutschland ist man meist nur Beobachter solcher Horrorszenarien, doch sie treten immer wieder, über den ganzen Globus verteilt auf. Neben Kriegen gibt es außer Finanzkrisen nur wenige Ereignisse, die in solch kurzer Zeit flächendeckende Verarmung zur Folge haben.
Die volkswirtschaftlichen Kosten von Währungskrisen präzise zu beziffern ist nahezu unmöglich. Doch alleine die Betrachtung von Kernindikatoren spricht Bände. So kommt es nach einer Untersuchung von KAMINSKY unter 69 Währungskrisen zwischen 1970 und 2002 zu einer durchschnittlichen Abwertung von 20% und einem durchschnittlichen Rückgang des BIP um 3%. Von weiteren Auswirkungen, wie dem Anstieg der Preise von Konsumgütern und wachsender Staatsverschuldung ganz zu schweigen.
Geschürt durch wachsende Existenzangst sowie einem erschütterten Vertrauen in das System als Ganzes kann es zu noch weitreichenderen Folgen kommen. Unruhen und Proteste in den betroffenen Ländern zeigen die Empfindlichkeit demokratischer Systeme auf Einschnitte im Lebensstandard breiter Bevölkerungsschichten. In Russland gelang es 1996 nur mit Hilfe massiver Unterstützung des Westens einen Sieg der extremen Parteien zu verhindern, was zu unabsehbaren Folgen über die Grenzen Russlands hinaus geführt hätte.
Diese globale Dimension von Währungskrisen führt verständlicherweise zu einer Flut von Änderungsvorschlägen, Erklärungsversuchen oder einfach nur grober Kritik. Nur wenn es gelingt, mehr Licht in die (oftmals sehr unterschiedlichen) Zusammenhänge zu bringen, die letztendlich zu einer Krise führen, steigen die Chancen solche werte- und vertrauenszerstörenden Phänomene zu verhindern. Doch um dieses Ziel zu erreichen müssen die Mechanismen von Ereignissen der Vergangenheit verstanden sein. Es ist daher Ziel der vorliegenden Arbeit, einen Überblick über die theoretischen Erklärungsversuche von bereits statt-gefundenen Währungskrisen zu verschaffen - sowie die Probleme in der Realität zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Währungskrisen – Definition und Historie
- Theoretische Definition und Abgrenzung
- Historie der Währungskrisen
- Evolution der Modelle – Realität und Theorie
- Modelle der ersten Generation
- Währungskrise in Mexiko 1982
- Der Modellansatz
- Kritikpunkte
- Modelle der zweiten Generation
- Der Zusammenbruch des EWS 1992/93
- Obstfeld – Modell
- Kritikpunkte
- Twin Crisis und die Asienkrise (Modelle der dritten Generation)
- Modelle der ersten Generation
- Epilog
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, einen Überblick über die theoretischen Erklärungsansätze bereits stattgefundener Währungskrisen zu geben und die Probleme in der Realität zu verdeutlichen. Sie analysiert die Entwicklung von Währungskrisenmodellen über drei Generationen hinweg und beleuchtet die Rolle von Wirtschaftspolitik, Spekulation und selbst erfüllenden Prophezeiungen.
- Definition und historische Entwicklung von Währungskrisen
- Analyse der Modelle der ersten, zweiten und dritten Generation zur Erklärung von Währungskrisen
- Die Rolle der Wirtschaftspolitik und der Erwartungen der Marktteilnehmer
- Das Phänomen der "Twin Crisis" und die Asienkrise 1997/98
- Die Bedeutung von Kapitalverkehrskontrollen und der Stabilität des Bankensystems
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt eindrücklich die Auswirkungen von Währungskrisen auf betroffene Bevölkerungsgruppen und Volkswirtschaften. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit, die zugrundeliegenden Mechanismen zu verstehen, um zukünftige Krisen zu verhindern. Die Arbeit soll einen Überblick über theoretische Erklärungsversuche und die Realitäten von Währungskrisen liefern.
Währungskrisen – Definition und Historie: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Währungskrise" und differenziert ihn von anderen Finanzkrisen. Es bietet einen historischen Überblick über die Häufigkeit und das Auftreten von Währungskrisen, wobei der Zusammenhang zwischen der Liberalisierung der Finanzmärkte und der Zunahme von Krisen hervorgehoben wird. Die Darstellung umfasst eine Reihe von Beispielen, beginnend mit dem späten 19. Jahrhundert bis hin zur Asienkrise.
Evolution der Modelle – Realität und Theorie: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung von Währungskrisenmodellen über drei Generationen. Es beginnt mit den Modellen der ersten Generation, die als Reaktion auf die lateinamerikanischen Schulden- und Währungskrisen entstanden sind. Die mexikanische Krise von 1982 wird als Fallbeispiel detailliert analysiert, um die Schwächen dieser ersten Modelle aufzuzeigen. Die Modelle der zweiten Generation berücksichtigen die Rolle der Regierung als Nutzenmaximierer und die Bedeutung von selbst erfüllenden Erwartungen. Der Zusammenbruch des Europäischen Währungssystems (EWS) 1992/93 dient als Beispiel, gefolgt von einer detaillierten Erklärung des Obstfeld-Modells. Schließlich werden die Modelle der dritten Generation im Kontext der Asienkrise 1997/98 und des Phänomens der "Twin Crisis" diskutiert. Der Fokus liegt auf der Interaktion von Banken- und Währungskrisen.
Schlüsselwörter
Währungskrise, Finanzkrise, Wechselkurs, Devisenreserven, Geldpolitik, Spekulation, Selbst erfüllende Prophezeiung, Modellentwicklung, Mexiko-Krise 1982, EWS-Zusammenbruch 1992/93, Asienkrise 1997/98, Twin Crisis, Kapitalverkehrskontrollen, Bankenkrise, Inflationsaversion, Reputationskosten, moral hazard, IWF.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Währungskrisen - Modelle und Realität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die theoretischen Erklärungsansätze für Währungskrisen und ihre praktische Umsetzung. Sie analysiert die Entwicklung von Währungskrisenmodellen über drei Generationen hinweg und beleuchtet dabei die Rolle von Wirtschaftspolitik, Spekulation und selbst erfüllenden Prophezeiungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und historische Entwicklung von Währungskrisen, analysiert Modelle der ersten, zweiten und dritten Generation zur Erklärung von Währungskrisen, untersucht die Rolle der Wirtschaftspolitik und der Erwartungen der Marktteilnehmer, betrachtet das Phänomen der "Twin Crisis" und die Asienkrise 1997/98, und beleuchtet die Bedeutung von Kapitalverkehrskontrollen und der Stabilität des Bankensystems.
Welche Modelle werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung von Währungskrisenmodellen über drei Generationen. Die Modelle der ersten Generation werden anhand der mexikanischen Krise von 1982 erläutert. Die Modelle der zweiten Generation werden im Kontext des Zusammenbruchs des Europäischen Währungssystems (EWS) 1992/93 und des Obstfeld-Modells diskutiert. Schließlich werden die Modelle der dritten Generation im Zusammenhang mit der Asienkrise 1997/98 und dem Phänomen der "Twin Crisis" behandelt.
Welche konkreten Krisen werden als Fallbeispiele verwendet?
Die Arbeit verwendet die mexikanische Währungskrise von 1982, den Zusammenbruch des Europäischen Währungssystems (EWS) 1992/93 und die Asienkrise von 1997/98 als zentrale Fallbeispiele zur Illustration der verschiedenen Modellgenerationen und ihrer Stärken und Schwächen.
Welche Rolle spielen Spekulation und selbst erfüllende Prophezeiungen?
Die Arbeit hebt die bedeutende Rolle von Spekulation und selbst erfüllenden Prophezeiungen bei der Entstehung und Verschärfung von Währungskrisen hervor. Diese Faktoren werden in den verschiedenen Modellgenerationen unterschiedlich berücksichtigt und analysiert.
Welche Bedeutung haben Wirtschaftspolitik und Erwartungen der Marktteilnehmer?
Die Arbeit betont die wichtige Rolle der Wirtschaftspolitik und der Erwartungen der Marktteilnehmer bei der Entstehung und Entwicklung von Währungskrisen. Die Analyse zeigt, wie politische Entscheidungen und die Erwartungen der Märkte die Stabilität des Währungssystems beeinflussen können.
Was sind die Schlüsselbegriffe der Arbeit?
Schlüsselbegriffe der Arbeit sind: Währungskrise, Finanzkrise, Wechselkurs, Devisenreserven, Geldpolitik, Spekulation, Selbst erfüllende Prophezeiung, Modellentwicklung, Mexiko-Krise 1982, EWS-Zusammenbruch 1992/93, Asienkrise 1997/98, Twin Crisis, Kapitalverkehrskontrollen, Bankenkrise, Inflationsaversion, Reputationskosten, moral hazard, IWF.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition und Historie von Währungskrisen, ein Kapitel zur Evolution der Modelle und einen Epilog gegliedert. Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Entwicklung und zum Verständnis von Währungskrisenmodellen. Sie betont die Komplexität der Zusammenhänge und die Notwendigkeit, die Rolle von Spekulation, Erwartungen und politischen Entscheidungen bei der Vermeidung zukünftiger Krisen zu berücksichtigen.
- Quote paper
- Diplom-Volkswirt Wolf Friedle (Author), 2004, Währungskrisen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55424