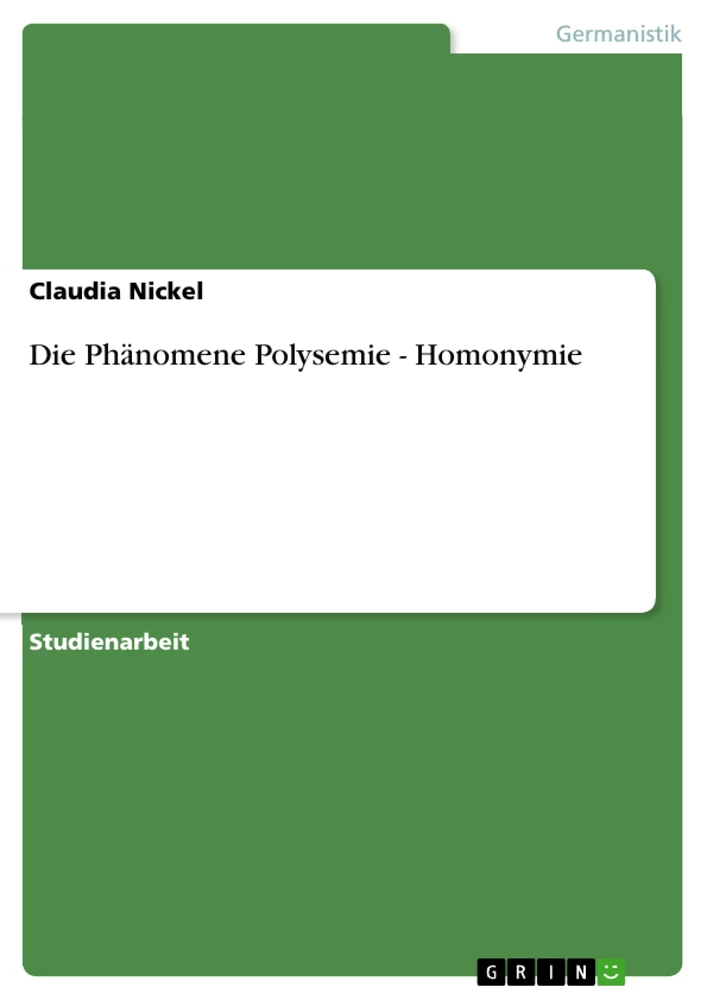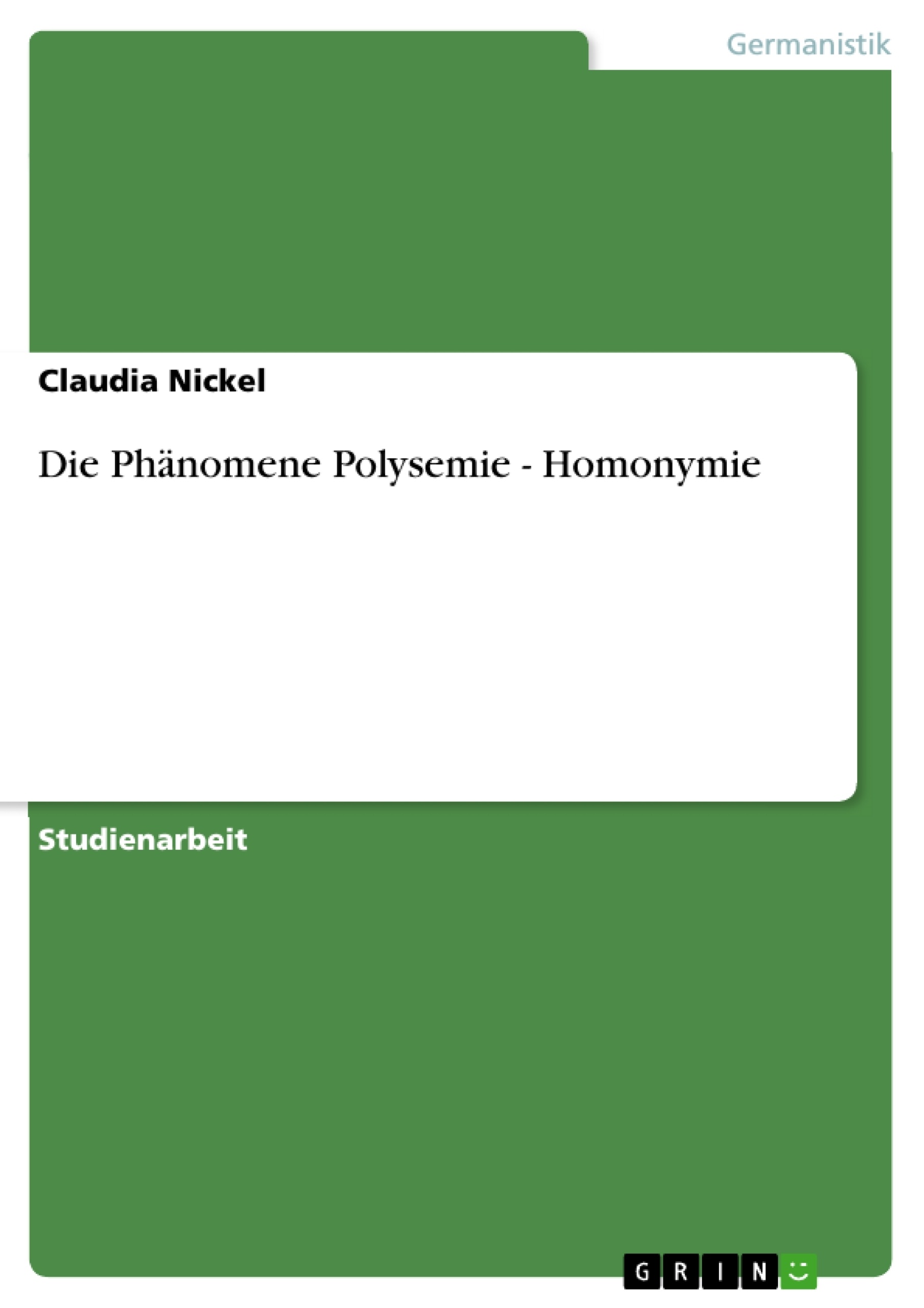Zu Beginn soll zuerst eine Erklärung des Begriffs "Wort" folgen, bevor zu einer Definition von Polysemie und Homonymie aus der wissenschaftlichen Literatur1 übergegangen wird. Ein Wort wird auch als Lexem bezeichnet und ist definiert als eine zusammengesetzte Einheit aus materialen Formen und den ihnen zugeordneten Bedeutungen. Nach Ferdinand de Saussure bestehen sprachliche Zeichen aus einem Inhalt und einem Ausdruck, wobei diese Verbindung arbiträr (beliebig) und konventionell ist. Viele sprachliche Zeichen sind prinzipiell arbiträr, so dass es keinen ursächlichen, vorbestimmten Zusammenhang zwischen dem Bezeichneten und der Form des Zeichens gibt. Sprachliche Zeichen sind außerdem prinzipiell konventionell, was bedeutet, dass sich die Angehörigen einer Kommunikationsgemeinschaft darüber einigen (meist stillschweigend, nur selten bewusst), mit welchem Ausdruck (oder Zeichen) eine bestimmte Sache bezeichnet wird.
Im Folgenden wird eine Definition für Polysemie und Homonymie dargestellt.
[...]
Im weiteren Verlauf der Seminararbeit soll die Entstehung der Polysemie sowie die Arten und Voraussetzungen der Homonymie beschrieben werden.
Schierholz unterstellt diesen Ansätzen, dass sie häufig von subjektiven Entscheidungen und Institutionen der Untersuchenden beeinflusst sind. Ferner bemängelt er, dass zu einer klaren Differenzierung von Polysemie und Homonymie weitgehende Uneinigkeit herrscht. (Schier-holz, 1991: 64)
Der zweite Teil der Seminararbeit beschäftigt sich mit dem quantitativen Ansatz von Schierholz. Es geht darum, die Existenz der Polysemie zu klären. Hierbei soll der quantitative Forschungsansatz aufgezeigt werden, da die bisherigen Methoden keine quantitativen Ergebnisse über die Existenz der Polysemie liefern. Außerdem soll aufgezeigt werden, dass empirische Methoden sowohl in der Lexikologie als auch in anderen Forschungsgebieten der Linguistik aufschlussreiche Resultate ergeben können (Schierholz, 1991 Vorwort).
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Traditionelle Ansätze zur Unterscheidung von Polysemie und Homonymie aus der wissenschaftlichen Literatur
- Die Polysemie (nach Schippan, 1984)
- Entstehung der Polysemie
- Metaphorische Beziehungen als Ausdruck der Mehrdeutigkeit
- Metonymische Beziehungen als Ausdruck der Mehrdeutigkeit
- Hyperonymische Beziehungen als Ausdruck der Mehrdeutigkeit
- Homonymie
- Zwei Arten der Homonymie
- Voraussetzungen für die Homonymie
- Vorschläge zur Abgrenzung von Polysemie und Homonymie nach Sigurd Wichter (1988)
- Das Etymologiekriterium
- Das Verwandtschaftskriterium
- Varianten des Verwandtschaftskriteriums
- Die Polysemie (nach Schippan, 1984)
- Quantitative Ansätze zur Bestimmung von Polysemie und Homonymie nach Schierholz (1991)
- Kritische Einwände der traditionellen Ansätze zur Polysemie von Schierholz
- Polysemie oder Homonymie?
- Die Definition der Polysemie
- Die lexikographische Polysemiedarstellung
- Die qualitative Vorgehensweise von Schierholz zur Ermittlung der Polysemie
- Kritische Einwände der traditionellen Ansätze zur Polysemie von Schierholz
- Polysemie oder Homonymie? - ein Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die sprachlichen Phänomene Polysemie und Homonymie. Ziel ist es, traditionelle und quantitative Ansätze zur Unterscheidung dieser beiden Begriffe aus der wissenschaftlichen Literatur zu beleuchten und kritisch zu bewerten. Die Arbeit analysiert die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Polysemie und Homonymie und diskutiert die Frage nach der Existenz der Polysemie.
- Definition und Abgrenzung von Polysemie und Homonymie
- Kritische Auseinandersetzung mit traditionellen Ansätzen
- Präsentation eines quantitativen Ansatzes zur Bestimmung von Polysemie
- Analyse der Entstehung von Polysemie
- Untersuchung der Arten und Voraussetzungen von Homonymie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einer Definition des Begriffs "Wort" als Lexem, bestehend aus materiellen Formen und zugeordneten Bedeutungen. Sie erläutert die arbiträre und konventionelle Natur sprachlicher Zeichen nach Saussure. Anschließend werden Polysemie als Mehrdeutigkeit von Wörtern und Homonymie als Zusammenfall von Homographie und Homophonie eingeführt. Die Arbeit thematisiert die Schwierigkeit, Polysemie und Homonymie eindeutig zu definieren und voneinander abzugrenzen, und kündigt die Einbeziehung eines quantitativen Ansatzes an, um diese Herausforderungen zu begegnen.
Traditionelle Ansätze zur Unterscheidung von Polysemie und Homonymie aus der wissenschaftlichen Literatur: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene traditionelle Ansätze zur Unterscheidung von Polysemie und Homonymie, basierend auf den Arbeiten von Schippan und Wichter. Es werden verschiedene Kriterien zur Abgrenzung der beiden Phänomene diskutiert, einschließlich etymologischer und semantischer Aspekte. Die Kapitelteile befassen sich mit der Definition der Polysemie nach Schippan, einschließlich der Entstehung von Polysemie und verschiedenen Arten semantischer Beziehungen (metaphorisch, metonymisch, hyperonymisch), sowie mit der Definition und den Arten von Homonymie. Der Abschnitt über Wichter fokussiert auf seine Kriterien zur Unterscheidung von Polysemie und Homonymie.
Quantitative Ansätze zur Bestimmung von Polysemie und Homonymie nach Schierholz (1991): Dieses Kapitel befasst sich mit der Kritik von Schierholz an den traditionellen Ansätzen zur Polysemie und präsentiert seinen quantitativen Ansatz. Schierholz bemängelt die subjektiven Einflüsse und die Uneinigkeit bei der Abgrenzung von Polysemie und Homonymie in den traditionellen Ansätzen. Sein quantitativer Ansatz zielt darauf ab, die Existenz der Polysemie empirisch zu untersuchen und liefert somit quantitative Ergebnisse, welche die bisherigen, qualitativen Methoden nicht liefern konnten. Das Kapitel zeigt, dass empirische Methoden auch in der Lexikologie aufschlussreiche Resultate bringen können.
Schlüsselwörter
Polysemie, Homonymie, Lexem, Mehrdeutigkeit, Wortbedeutung, Semantik, Etymologie, quantitativer Ansatz, empirische Methode, Wortbildung, wissenschaftliche Literatur, Lexikologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Polysemie und Homonymie
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die sprachlichen Phänomene Polysemie und Homonymie. Sie beleuchtet und bewertet kritisch traditionelle und quantitative Ansätze zur Unterscheidung dieser beiden Begriffe aus der wissenschaftlichen Literatur. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Polysemie und Homonymie und der Diskussion über die Existenz der Polysemie.
Welche traditionellen Ansätze zur Unterscheidung von Polysemie und Homonymie werden behandelt?
Die Arbeit präsentiert und diskutiert verschiedene traditionelle Ansätze, basierend auf den Arbeiten von Schippan (mit Fokus auf die Entstehung von Polysemie und verschiedenen Arten semantischer Beziehungen wie metaphorisch, metonymisch und hyperonymisch) und Wichter (mit seinen Kriterien zur Unterscheidung, inklusive etymologischer und semantischer Aspekte). Es werden die Definitionen der Polysemie und Homonymie nach diesen Autoren erläutert und kritisch beleuchtet.
Welchen quantitativen Ansatz zur Bestimmung von Polysemie beschreibt die Arbeit?
Die Arbeit beschreibt den quantitativen Ansatz von Schierholz (1991). Dieser Ansatz kritisiert die subjektiven Einflüsse und die Uneinigkeit in den traditionellen Ansätzen und zielt darauf ab, die Existenz der Polysemie empirisch zu untersuchen. Schierholz' Methode liefert quantitative Ergebnisse, die im Gegensatz zu den bisherigen qualitativen Methoden stehen und die Bedeutung empirischer Methoden in der Lexikologie hervorheben.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Vorwort, Einleitung, Traditionelle Ansätze zur Unterscheidung von Polysemie und Homonymie, Quantitative Ansätze zur Bestimmung von Polysemie und Homonymie nach Schierholz (1991), Polysemie oder Homonymie? - ein Resümee und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik, beginnend mit einer Einführung und Definition der zentralen Begriffe bis hin zur kritischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Forschungsansätzen und einer zusammenfassenden Schlussfolgerung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Thematik der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Polysemie, Homonymie, Lexem, Mehrdeutigkeit, Wortbedeutung, Semantik, Etymologie, quantitativer Ansatz, empirische Methode, Wortbildung, wissenschaftliche Literatur und Lexikologie.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis der sprachlichen Phänomene Polysemie und Homonymie zu vermitteln, indem traditionelle und quantitative Ansätze kritisch untersucht und verglichen werden. Die Arbeit soll die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der beiden Phänomene aufzeigen und zur Diskussion über die Existenz und Definition von Polysemie beitragen.
Welche Methoden werden in der Arbeit eingesetzt?
Die Arbeit nutzt sowohl qualitative als auch quantitative Methoden. Sie analysiert und bewertet traditionelle, qualitative Ansätze aus der wissenschaftlichen Literatur und präsentiert und diskutiert einen quantitativen Ansatz zur Bestimmung von Polysemie. Die Kombination beider Methoden ermöglicht eine umfassendere und differenziertere Betrachtung der Thematik.
Wer sind die wichtigsten Autoren, die in der Arbeit zitiert werden?
Die Arbeit bezieht sich maßgeblich auf die Arbeiten von Schippan, Wichter und Schierholz, die unterschiedliche Ansätze zur Definition und Unterscheidung von Polysemie und Homonymie vertreten.
- Citar trabajo
- Claudia Nickel (Autor), 2006, Die Phänomene Polysemie - Homonymie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55370