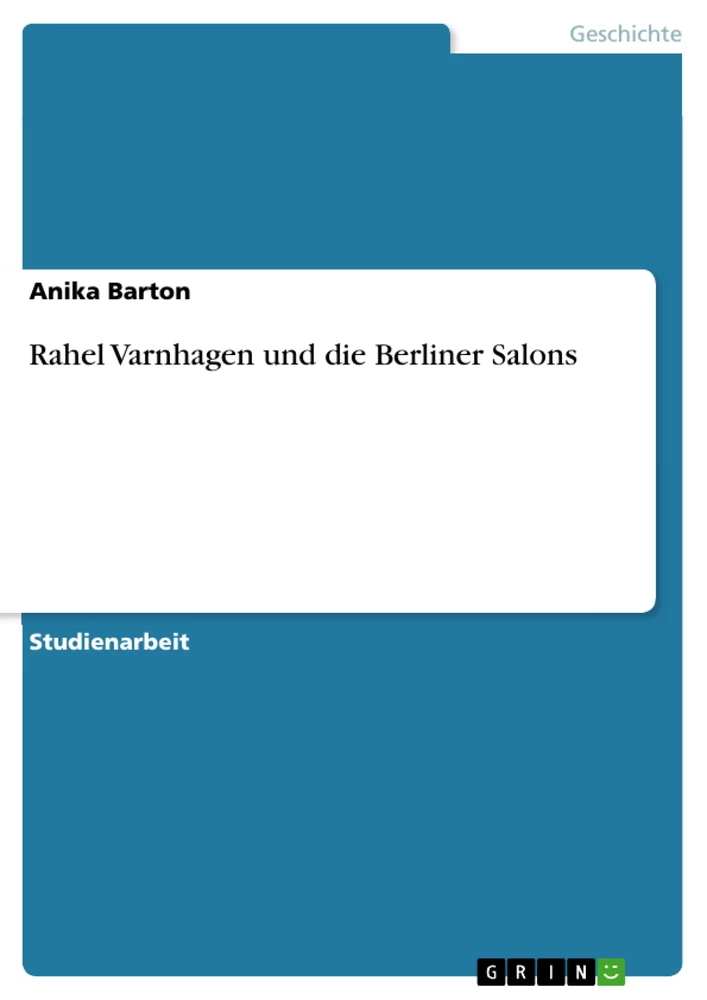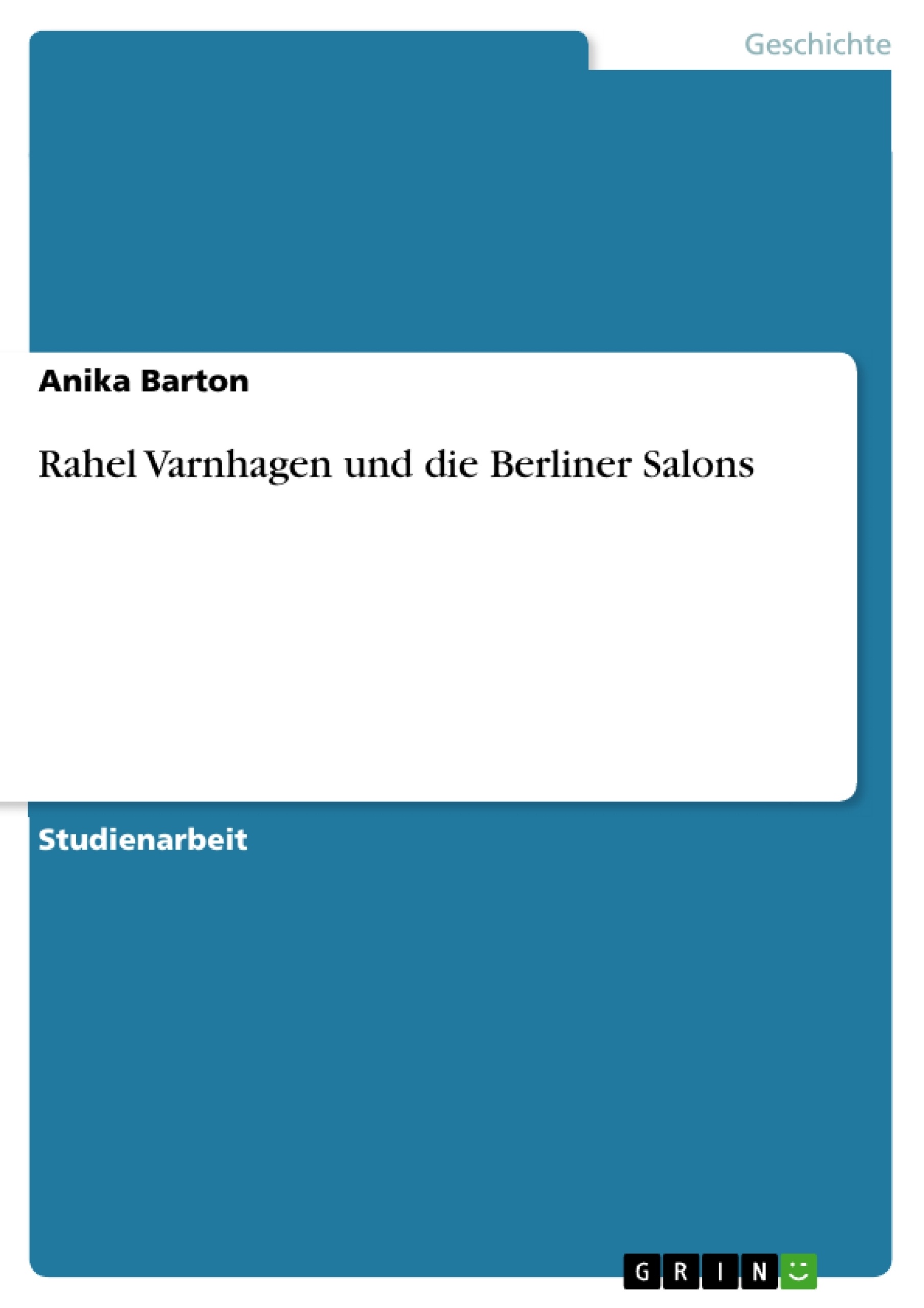Rahel Levin wird am 19. Mai 1771 als ältestes Kind eines jüdischen Kaufmanns, Bankiers und Juweliers in Berlin geboren. Ihr folgen vier weitere Kinder. Die Familie Levin ist sehr wohlhabend und gehört zu den 500 Schutzjuden der jüdischen Oberschicht, die es zur Zeit Friedrich II. in Berlin gibt. Sie besitzen deshalb für Juden ungewöhnlich viele Rechte. Als 1790 jedoch Rahels Vater stirbt, gerät die Familie in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das Geschäft geht an Rahels Bruder Markus. Rahel kümmert sich um ihre kleineren Geschwister und übernimmt deren Erziehung, da sich ihre Mutter dazu nicht in der Lage fühlt. Rahel ist von ihrer Familie finanziell anhängig. 1790 eröffnet sie ihren ersten Salon im elterlichen Haus in der Dachstube. Er ist die Weiterführung der Abendgesellschaft des verstorbenen Vaters. In ihrem Salon treffen Menschen jeden Standes zusammen, um sich über Literatur, Natur und Kunst zu unterhalten. Unter den Gästen befinden sich auch bekannte Romantiker wie Brentano, Schleiermacher, die Gebrüder Humboldt und Tieck. Da Rahel schon in ihrer Jugend häufig krank ist, reist sie im Sommer 1795 zur Kur nach Teplitz.
Im Winter lernt sie den Grafen von Finckenstein kennen. Die Beziehung scheitert jedoch trotz Verlobung nach fünf Jahren, da Rahel von seiner Familie nicht akzeptiert wird und Finckenstein nicht bereit ist, ein Doppelleben zu führen. Um sich abzulenken, fährt Rahel 1800 nach Paris und bleibt dort bis zum April 1801. 1802 lernt Rahel den spanischen Gesandtschaftssekretär Don Raphael d`Urquijo kennen und erlebt eine zweite unglückliche Liebesbeziehung. Schon nach eineinhalb Jahren erfolgt der Bruch. Als sie 1806, aufgrund Napoleons Einzugs in Berlin, ihren ersten Salon auflösen muss, geht es auch ihrer Familie finanziell immer schlechter. Rahel muss ihren Lebensstandard einschränken. 1808 lernt sie ihren zukünftigen Mann Karl August Varnhagen kennen, der jedoch schon bald zu einem Medizinstudium in eine andere Stadt aufbricht. Zudem zieht Rahel als nun 37- jährige nach schweren Konflikten mit ihrer Mutter aus der gemeinsamen Wohnung aus und mietet sich eine eigene. Nach der Krankheit und dem Tod ihrer Mutter 1809, zieht sie 1810 erneut um und ändert ihren Familiennamen. Von nun an nennt sie sich Robert (vgl. auch Gründe für ihren Religionswechsel). Als Preußen Frankreich 1813 den Krieg erklärt, reist Rahel nach Prag. Dort lebt sie wieder auf, denn alles ist neu und fremd für sie.
Inhaltsverzeichnis
- Biografie Rahel Varnhagens
- Erziehung und Bildung Rahels
- Stellung der Juden in der Romantik
- Stellung der Frauen in der Romantik
- Rahel in der Rolle der Frau im Bezug zu den Männern
- Die Salonkultur und andere Gesellschaften
- Ziele Rahels und Gründe für ihr Schreiben
- Möglichkeiten Rahels, ihre Ziele mithilfe ihres Salons durchzusetzen
- Identitätskrise
- Rahels Inneres und Äußeres
- Rahels Einstellung zur Religion
- Gründe für ihren Religionswechsel
- Rahels Verhalten als Christin
- Analyse des Briefes an Ludwig Robert vom 29. August 1819
- Inhalt
- Stil und Besonderheiten
- Tagebucheintrag vom 2. März 1823 als Ergänzung/ Bestätigung
- Rahels Bekenntnis zurück zum Judentum am 2. März 1833
- Inhalt
- Bekenntnisanalyse und Vergleich/Unterschiede zum Brief
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Biografie von Rahel Varnhagen und ihrer Rolle in der Berliner Salonkultur der Epoche der Romantik. Die Arbeit beleuchtet dabei insbesondere die Stellung des Judentums und der Frauen in dieser Zeit.
- Rahel Varnhagens Biografie und ihre Bildungsgeschichte
- Die Rolle der Juden in der Gesellschaft der Romantik
- Die Situation von Frauen in der Epoche der Romantik
- Die Salonkultur in Berlin und die Rolle Rahels
- Rahels Identitätskrise und ihre Auseinandersetzung mit Religion
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Hausarbeit widmet sich der Biografie von Rahel Varnhagen und beleuchtet ihre Kindheit, Erziehung und Bildung. Es wird deutlich, dass sie trotz ihrer privilegierten Herkunft im Kreise der „Schutzjuden“ eine ungewöhnliche Ausbildung genoss.
Das zweite Kapitel erörtert die Stellung der Juden in der Romantik und verdeutlicht die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen, denen sie in dieser Epoche gegenüberstanden. Die Arbeit beleuchtet die Diskriminierung, die ihnen entgegengebracht wurde, und zeigt auf, wie sie als Sündenböcke für gesellschaftliche Probleme herhalten mussten.
Das dritte Kapitel untersucht die Stellung der Frauen in der Epoche der Romantik und beleuchtet die gesellschaftlichen Erwartungen und Normen, die an sie gestellt wurden. Im Fokus steht Rahels eigene Rolle als Frau im Verhältnis zu den Männern ihrer Zeit.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Salonkultur und anderen Gesellschaften in der Romantik. Die Arbeit analysiert die Ziele Rahels mit ihrem Salon und beleuchtet, wie sie ihre Ziele mithilfe dieser Plattform durchsetzen konnte.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Identitätskrise, die Rahel durchmachte. Die Arbeit untersucht ihre innere und äußere Welt und versucht, die Ursachen und Folgen dieser Krise aufzuzeigen.
Das sechste Kapitel untersucht Rahels Einstellung zur Religion und betrachtet ihre Entscheidung, zum Christentum zu konvertieren. Es werden die Gründe für ihren Religionswechsel und ihr Verhalten als Christin analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Begriffe wie: Rahel Varnhagen, Salonkultur, Romantik, Judentum, Frauenrolle, Identitätskrise, Religion, Bildung, Briefanalyse, Gesellschaft, Diskriminierung, Emanzipation.
- Quote paper
- Anika Barton (Author), 2005, Rahel Varnhagen und die Berliner Salons, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55150