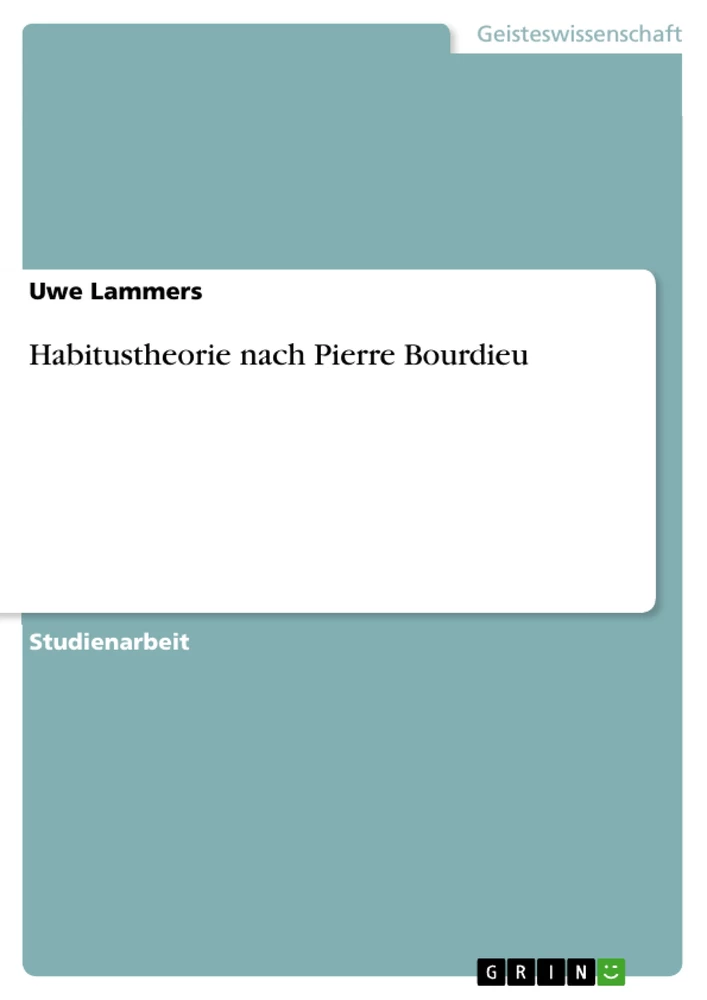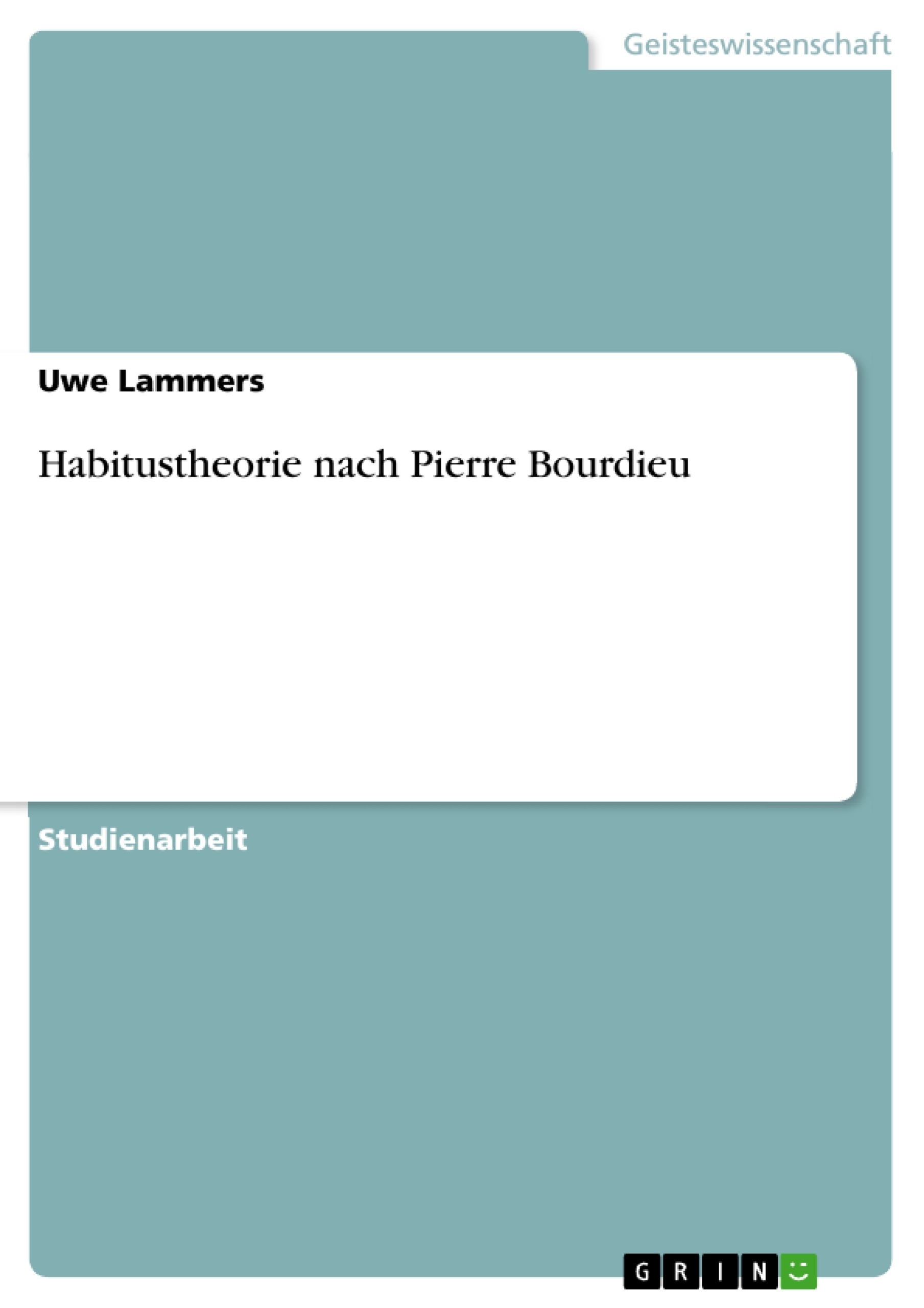1. Einleitung
Pierre Bourdieu (1930 - 2002) studierte im Hauptfach Philosophie in Paris und unternahm als Soldat im Algerienkrieg 1958 - 1960 erste Feldforschungen zur Kultur der nordalgerischen Berber. 1979 erscheint in Frankreich sein sehr empirisch orientiertes (sog.) Hauptwerk „La Distinction. Critique sociale du jugement“, zu deutsch (1982): „Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft.“ Seit 1981 hatte er einen Lehrstuhl für Soziologie in Frankreich am College de France und galt als einer der renommiertesten Soziologen Frankreichs. Aus den Grundzügen seiner Untersuchungen in Algerien entstand seine Theorie des Habitus- Konzepts. Bourdieu erkannte, dass die archaisch- vorkapitalistischen algerischen Bauern im Zuge der Kolonialisierung Frankreichs durch die übergestülpte Ökonomisierung der Moderne völlig überfordert waren, da sie schlichtweg nicht über stillschweigend vorausgesetzte Verhaltensdispositionen des westlichen Kapitalismus und der modernen Zivilisation verfügten.
Das Wort und die entsprechende Verwendung des „Habitus“ stammt allerdings nicht von Bourdieu, sondern aus dem alten Latein der antiken Philosophie. Einer lexikalischen Eintragung zufolge versteht man unter „Habitus (lat.) der: ...Erscheinung, Haltung, Gehaben, Besonderheiten im Erscheinungsbild eines Menschen,... auf einer Disposition aufgebaute, er-worbene sittliche Haltung...“ „Habitualisieren“ bedeutet dementsprechend: „zur Gewohnheit machen resp. werden“. Cornelia Bohn ergänzt diese Definition in ihrer Untersuchung und Kritik an Bourdieu noch um die Formulierung des lateinischen „habilis“, der „Fähig- keit“. Auchgreift Bohn auf, dass es bei der deutschen Formulierung des „Habituskonzepts“, der Übersetzung Bourdieus aus dem Französischen, zu übersetzungsbedingten Missverständnissen kommen kann, da das Wort „Habitus“ im Deutschen einzig singulär gebraucht werden kann. Es gibt keine verschiedenen Arten des einen oder anderen Habitus oder ein Plural von Habitus.
Es wird nun im Folgenden dargestellt, inwiefern die Lebensweisen eines Individuums sich gegenseitig durch und mit seinem Umfeld erzeugen und erzeugen lassen. Denn der Habitus ist nach Bourdieu ein Erzeugungs- sowie auch Wahrnehmungsprinzip und eine Interpretationsu. Bewertungsmatrix, welche ihren sozialen Sinn in spezifischen Praxisfeldern manifestiert. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Habitus und Feld
- Soziale Praxis
- Kapital
- Distinktion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat beschäftigt sich mit der Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu. Es soll die zentralen Elemente der Theorie beleuchtet und ihre Bedeutung für das Verständnis von sozialer Praxis aufgezeigt werden.
- Das Konzept des Habitus als Erzeugungs- und Wahrnehmungsprinzip
- Die Rolle sozialer Felder und ihre Bedeutung für die Bildung des Habitus
- Die Verbindung zwischen Habitus und Kapital sowie deren Einfluss auf soziale Distinktion
- Die Bedeutung des Habitus für die Reproduktion sozialer Strukturen
- Die Relevanz der Habitus-Theorie für die Analyse von sozialen Ungleichheiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Pierre Bourdieu und seine wissenschaftliche Laufbahn vor. Sie skizziert den Ursprung der Habitus-Theorie in Bourdieus Feldforschungen in Algerien und beleuchtet die Entstehung des Habitus-Konzepts im Kontext der französischen Kolonialisierung. Außerdem wird die Bedeutung des Habitus-Konzepts im Kontext der modernen Zivilisation und des westlichen Kapitalismus beleuchtet.
Habitus und Feld
Dieses Kapitel erläutert die Konzepte von „sozialen Räumen“ und „sozialen Feldern“ nach Bourdieu. Es wird gezeigt, wie diese Felder durch dichotome Strukturen geformt sind und wie sich der Habitus als ein Prinzip der Handlungsregulation innerhalb dieser Felder manifestiert.
Soziale Praxis
Der Zusammenhang zwischen Habitus und sozialer Praxis wird in diesem Kapitel näher beleuchtet. Es wird dargestellt, wie der Habitus die Wahrnehmung, Interpretation und Reproduktion der sozialen Praxis beeinflusst und gleichzeitig durch diese geformt wird.
Kapital
Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Formen von Kapital (ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital), die nach Bourdieu den Habitus prägen und gleichzeitig von ihm beeinflusst werden. Es wird gezeigt, wie die Verteilung von Kapital zu sozialen Ungleichheiten führt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu umfassen: Habitus, soziales Feld, Kapital, Distinktion, soziale Praxis, soziale Ungleichheit, und Reproduktion.
- Quote paper
- Uwe Lammers (Author), 2005, Habitustheorie nach Pierre Bourdieu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55011