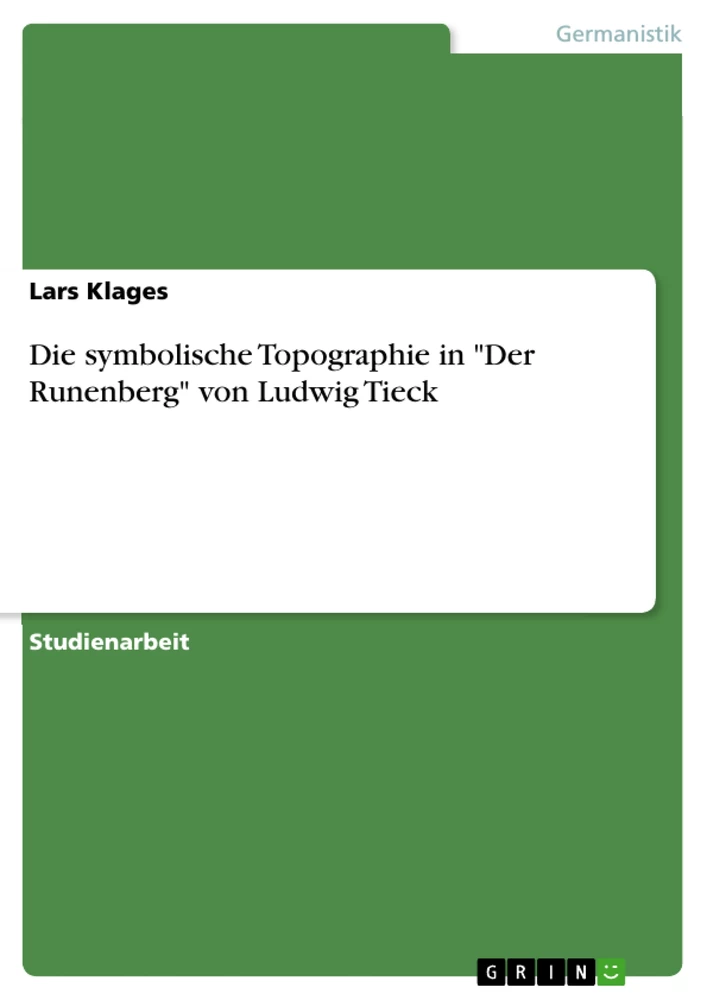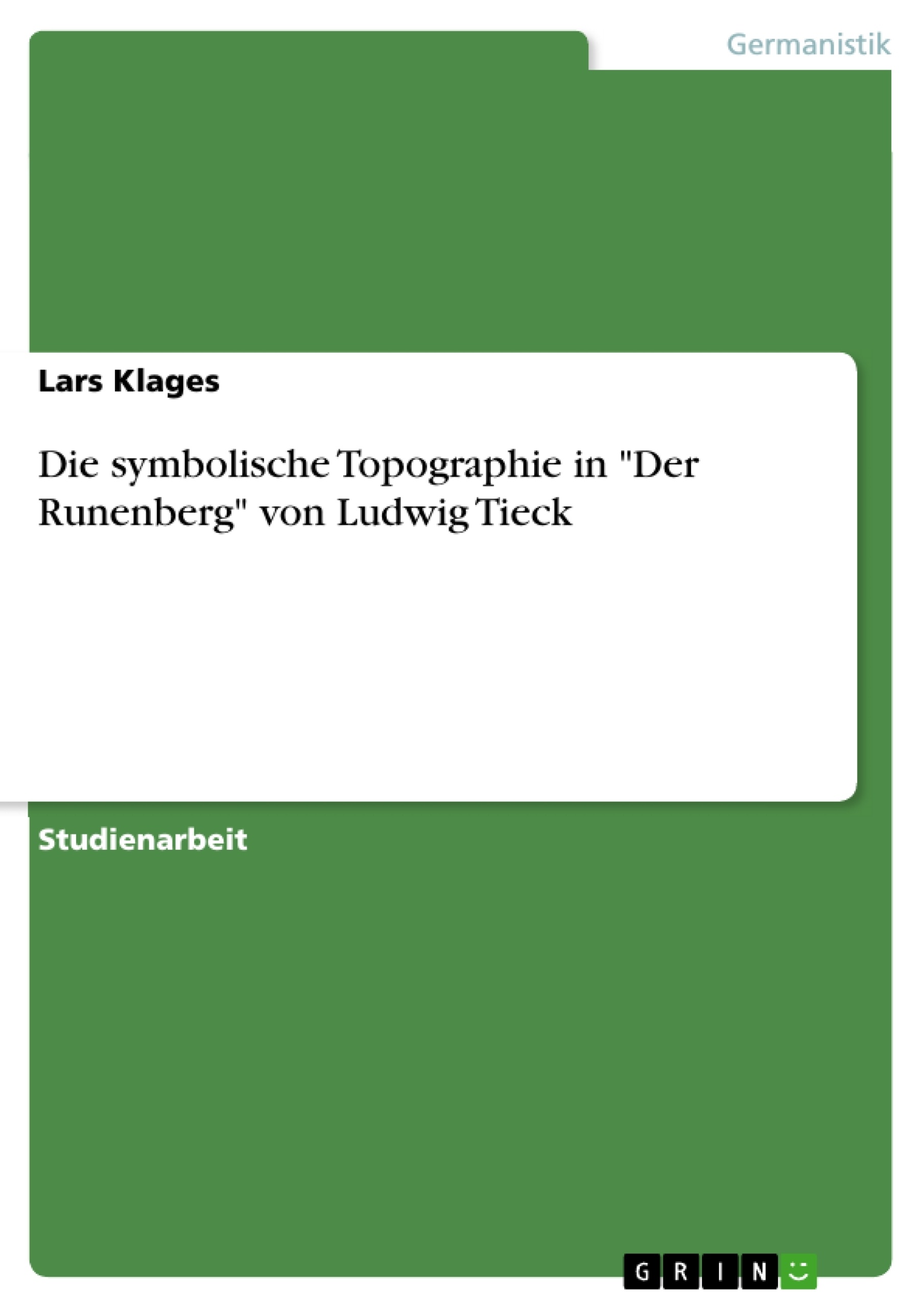Die von Ludwig Tieck verfasste Novelle „Der Runenberg“ von 1802 zählt zu den früheren Werken des Autors und wird zur Gattung der Kunstmärchen gerechnet. Bei Kunstmärchen handelt es sich um jene Märchen, die im Gegensatz zu den meist mündlich überlieferten Volksmärchen von einem Autor bewusst geschaffen wurden. Der Stoff kann dabei durchaus schon vorher behandelt worden sein. Der Verfasser dichtet ihn jedoch zu einer eigenen Geschichte um, so dass ein neues literarisches Werk entsteht. Das Kunstmärchen gilt demnach als geistiges Eigentum des Verfassers. Ein weiterer Unterscheidungspunkt zum Volksmärchen ist die Bedeutung der Natur. Diese Unterscheidung spielt auch für die Interpretation eine wichtige Rolle. Jens Tismar spricht in dem Zusammenhang von einer „Dämonisierung der Natur“, die er wie folgt beschreibt: „Im Volksmärchen erscheint Natur als Kulisse oder handlungsabhängiger Raum, in Tiecks Märchen als eigenständige Gegenmacht.“
Auch die Grundsätze und Ideale der literaturgeschichtlichen Epoche der Frühromantik, zu der „Der Runenberg“ zu rechnen ist, lassen sich im Werk exemplarisch erkennen. Insbesondere die Betonung des subjektiven Empfindens und der Aspekt der „Sehnsucht nach der Sehnsucht“ fallen ins Auge.
In der vorliegenden Arbeit wird deshalb nun kurz zum besseren Verständnis die Epoche der Frühromantik kurz charakterisiert und Ludwig Tieck, der Zeitgenossen weithin als „König der Romantik“ galt, in sie eingeordnet. Diese Verortung ist hilfreich, da hierdurch die anschließende Interpretation des Werkes leichter nachvollziehbar wird.
Danach folgt eine Analyse der symbolischen Topographie des „Runenbergs“. Hierbei wird sich zeigen, dass die gesamte Geschichte durch Gegensätze geprägt ist. Diese Gegensätze sind ein wichtiger Hinweis für die Interpretation der Entwicklung des Protagonisten Christian. In der Schlussbetrachtung schließlich wird versucht, zusammenfassend zu bewerten, ob Christian letztendlich gescheitert ist, oder ob er die Erfüllung seiner geheimsten Wünsche gefunden hat, wenn auch zu dem Preis, aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen zu sein und für die Menschen als „wahnsinnig“ zu gelten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Vorraussetzungen zum Verständnis: Tieck und die Frühromantik
- III. Die symbolische Topographie in „Der Runenberg“
- 1. Die Ebene
- 2. Das Gebirge
- 3. Pflanzenwelt vs. Steinwelt
- 4. Die beiden Frauengestalten
- IV. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die symbolische Topographie in Ludwig Tiecks Novelle „Der Runenberg“. Sie zielt darauf ab, die Bedeutung der Landschaft für die Entwicklung des Protagonisten Christian zu analysieren und die Verbindung zur Frühromantik aufzuzeigen.
- Symbolische Bedeutung von Landschaft und Topographie
- Frühromantische Ideale und ihre Verkörperung in „Der Runenberg“
- Gegensätze als zentrale Elemente der Erzählung
- Entwicklung des Protagonisten Christian im Kontext der Topographie
- Verbindung von subjektiver Wahrnehmung und symbolischer Bedeutung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt „Der Runenberg“ als Kunstmärchen im Gegensatz zum Volksmärchen vor und verdeutlicht die Bedeutung der Natur als eigenständige Gegenmacht. Sie hebt zudem die Bedeutung der Frühromantik für das Verständnis des Werkes hervor.
II. Vorraussetzungen zum Verständnis: Tieck und die Frühromantik
Dieses Kapitel charakterisiert die Frühromantik als Epoche und ordnet Ludwig Tieck als wichtigen Vertreter dieser Bewegung ein. Es beleuchtet die Abkehr von der Nachahmung der Realität und die Betonung des subjektiven Empfindens. Darüber hinaus werden die Verbindung von Natur und Geist sowie die Bedeutung des Mittelalters als Quelle für romantische Motive hervorgehoben.
III. Die symbolische Topographie in „Der Runenberg“
Dieser Abschnitt analysiert die symbolische Topographie des „Runenbergs“. Es werden die Ebenen, das Gebirge, die Pflanzen- und Steinwelt sowie die beiden Frauengestalten im Kontext ihrer symbolischen Bedeutung untersucht. Die Gegensätze innerhalb der Topographie werden als Hinweise auf die Entwicklung des Protagonisten Christian interpretiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Frühromantik, Ludwig Tieck, Kunstmärchen, symbolische Topographie, „Der Runenberg“, Landschaft, Natur, Gegensätze, Subjektivität, Christian, Entwicklung des Protagonisten.
- Quote paper
- Lars Klages (Author), 2006, Die symbolische Topographie in "Der Runenberg" von Ludwig Tieck, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54988