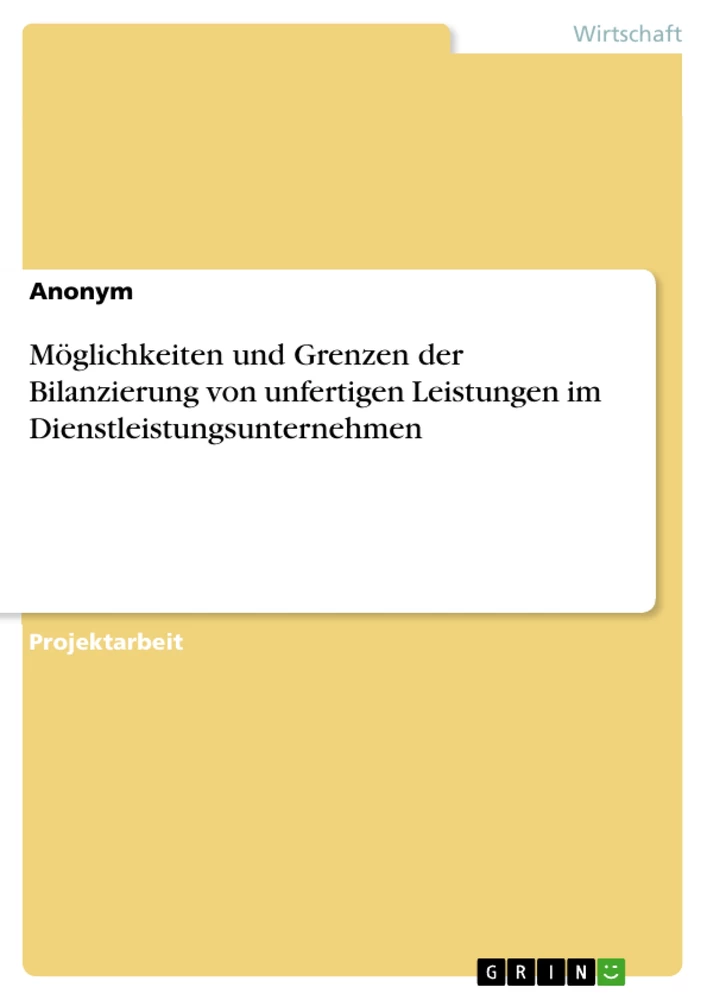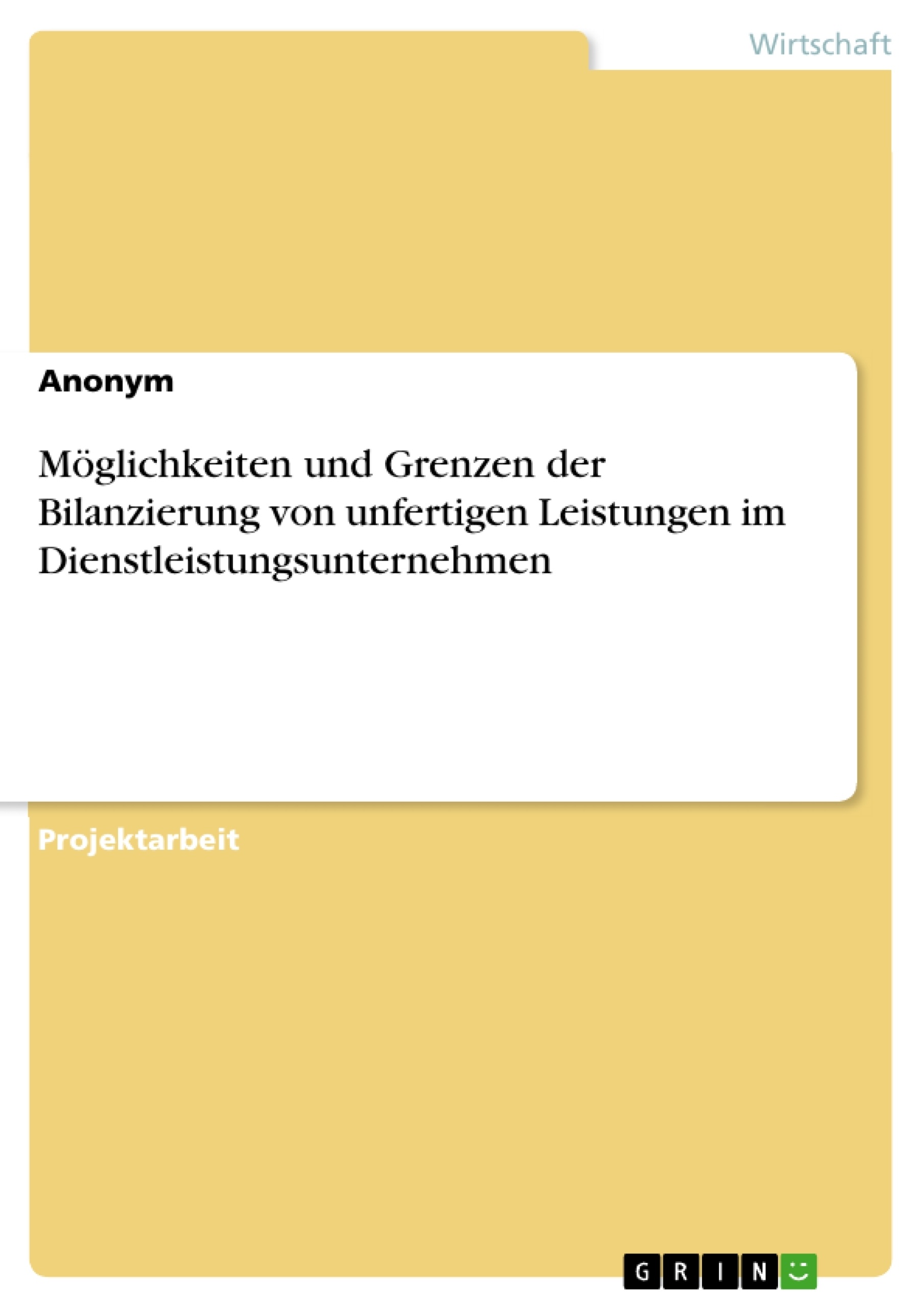Ziel dieser Arbeit ist es, die Bilanzierung der unfertigen Erzeugnisse eines Dienstleistungsunternehmens darzustellen. Daher sollen sowohl die Möglichkeiten und Grenzen der Bilanzierungsmöglichkeiten bei Betrachtung der Höhe des Wertansatzes, als auch die Möglichkeiten und Grenzen des Zeitpunkts der Gewinnrealisierung thematisiert werden. Zur Zielsetzung der Arbeit zählt neben der Darstellung der Bilanzierung der unfertigen Erzeugnisse auch eine Beurteilung, ob die Zielsetzung des handelsrechtlichen Normensystems durch die Bilanzierungsmethoden erfüllt werden können.
Alle Ausführungen konzentrieren sich auf den Einzelabschluss von mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 2 und 3 HGB, da nur diese alle Bilanzposten des § 266 Abs. 2 und 3 HGB sowie Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 HGB gesondert ausweisen müssen.
Zunächst werden die Ziele, Prinzipien und Grundsätze, die für die Aufstellung des Jahresabschlusses nach HGB gelten, vorgestellt. Danach erfolgt eine Abgrenzung und Erläuterung der Vorräte eines Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmens. Anschließend soll der Begriff der unfertigen Leistungen und zusätzlich die periodenübergreifende Auftragsfertigung definiert werden. Daraufhin werden die rechtlichen Grundlagen aus der Erbringung von Dienstleistungen vorgestellt. Die theoretischen Grundlagen werden bei der Bilanzierung angewendet. Des Weiteren erfolgt die Ermittlung des Wertes des Vermögensgegenstands im Rahmen des materiellen Bilanzansatzes. Bis zum Zeitpunkt der Gewinnrealisierung wird ein unfertiges Erzeugnis bilanziert, daher soll dieser näher analysiert werden. Dabei soll die nach HGB einschlägige Completed-Contract-Methode thematisiert und auf die Teilgewinnrealisierung durch Teilabnahmen und ohne Abnahme kritisch betrachtet werden. Es wird aufgezeigt, wo der Vermögensgegenstand oder die Schuld im Jahresabschluss ausgewiesen wird. Da erhaltene Anzahlungen, Drohverlustrückstellungen und Bestandsveränderungen eigene Positionen darstellen und diese im Zusammenhang mit den unfertigen Erzeugnissen entstehen, werden sie im Rahmen des Ausweises thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Der Jahresabschluss nach HGB
- 2.1.1. Ziele von Jahresabschlüssen nach HGB
- 2.1.2. Ausgewählte Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung
- 2.2. Besonderheiten der Vorräte im Dienstleistungsunternehmen
- 2.2.1. Vorräte in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen
- 2.2.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen – Definition
- 2.2.3. Periodenübergreifende Auftragsfertigung – Definition
- 2.2.4. Handelsrechtliche Bilanzierung der unfertigen Erzeugnisse
- 3. Rechtliche Grundlagen aus der Erbringung von Dienstleistungen
- 3.1. Ansatz - Formeller Bilanzansatz: Bilanzierung dem Grunde nach
- 3.2. Bewertung - Materieller Bilanzansatz: Bilanzierung der Höhe nach
- 3.2.1. Zugangsbewertung - Herstellungskosten
- 3.2.2. Folgebewertung - Niederstwertprinzip
- 3.3. Gewinnrealisierungszeitpunkt nach HGB
- 3.3.1. Completed-Contract-Methode
- 3.3.2. Teilgewinnrealisierung durch Teilabnahmen
- 3.3.3. Teilabrechnung ohne Abnahme
- 3.4. Ausweis
- 3.4.1. Bilanz - Unfertige Erzeugnisse, Unfertige Leistungen
- 3.4.2. Bilanz - Erhaltene Anzahlungen
- 3.4.3. Bilanz - Drohverlustrückstellungen
- 3.4.4. GuV - Bestandsveränderungen
- 3.4.5. Anhang und Lagebericht
- 4. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bilanzierung unfertiger Leistungen in Dienstleistungsunternehmen unter dem Handelsgesetzbuch (HGB). Das Ziel ist die Darstellung der Möglichkeiten und Grenzen der Bilanzierung hinsichtlich des Wertansatzes und des Gewinnrealisierungszeitpunkts. Es wird kritisch bewertet, ob die verwendeten Methoden die Zielsetzung des HGB erfüllen.
- Bilanzierung unfertiger Leistungen in Dienstleistungsunternehmen
- Wertansatz unfertiger Leistungen während der Projektdurchführung
- Gewinnrealisierungszeitpunkt nach HGB
- Anwendung der handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätze
- Kritische Beurteilung der Methoden im Hinblick auf die Zielsetzung des HGB
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die wachsende Bedeutung von Dienstleistungsunternehmen in der deutschen Wirtschaft und ihren hohen Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Sie hebt den Unterschied zwischen der Bilanzierung materieller Güter in produzierenden Unternehmen und der Bilanzierung immaterieller Leistungen in Dienstleistungsunternehmen hervor, wobei unfertige Leistungen im Fokus stehen. Die Arbeit konzentriert sich auf die handelsrechtliche Bilanzierung dieser Leistungen und die damit verbundenen Herausforderungen, besonders hinsichtlich des Wertansatzes und des Gewinnrealisierungszeitpunkts während länger laufender Projekte.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Arbeit. Es beschreibt den Jahresabschluss nach HGB, einschließlich der Ziele und Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Ein Schwerpunkt liegt auf den Besonderheiten von Vorräten in Dienstleistungsunternehmen, insbesondere die Definition und Bilanzierung unfertiger Leistungen im Gegensatz zu produzierenden Unternehmen. Der Abschnitt beleuchtet die Herausforderungen der Periodenzuordnung von Gewinnen und Verlusten bei langfristigen Projekten.
3. Rechtliche Grundlagen aus der Erbringung von Dienstleistungen: Dieses Kapitel befasst sich mit den rechtlichen Aspekten der Bilanzierung unfertiger Leistungen. Es behandelt den formellen (Ansatz) und materiellen (Bewertung) Bilanzansatz, inklusive der Zugangs- und Folgebewertung nach Herstellungskosten und dem Niederstwertprinzip. Die verschiedenen Methoden der Gewinnrealisierung (Completed-Contract-Methode, Teilgewinnrealisierung) werden erläutert und deren Anwendung im Kontext von Teilabnahmen oder Teilabrechnungen diskutiert. Schließlich werden die Ausweisvorschriften in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang behandelt.
Schlüsselwörter
Bilanzierung, unfertige Leistungen, Dienstleistungsunternehmen, HGB, Jahresabschluss, Wertansatz, Gewinnrealisierung, Herstellungskosten, Niederstwertprinzip, Completed-Contract-Methode, Teilabnahme, Teilabrechnung, Handelsrecht.
Häufig gestellte Fragen zur Bilanzierung unfertiger Leistungen in Dienstleistungsunternehmen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Bilanzierung unfertiger Leistungen in Dienstleistungsunternehmen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Sie untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Bilanzierung hinsichtlich des Wertansatzes und des Gewinnrealisierungszeitpunkts und bewertet kritisch, ob die verwendeten Methoden die Zielsetzung des HGB erfüllen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bilanzierung unfertiger Leistungen, den Wertansatz während der Projektdurchführung, den Gewinnrealisierungszeitpunkt nach HGB, die Anwendung handelsrechtlicher Bilanzierungsgrundsätze und eine kritische Beurteilung der Methoden im Hinblick auf die Zielsetzung des HGB. Sie umfasst theoretische Grundlagen (Jahresabschluss nach HGB, Besonderheiten von Vorräten in Dienstleistungsunternehmen), rechtliche Grundlagen der Bilanzierung (formeller und materieller Ansatz, Bewertung nach Herstellungskosten und Niederstwertprinzip, Gewinnrealisierungsmethoden wie Completed-Contract-Methode und Teilgewinnrealisierung) und die Ausweisvorschriften in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang.
Welche Methoden der Gewinnrealisierung werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Completed-Contract-Methode sowie die Teilgewinnrealisierung durch Teilabnahmen und Teilabrechnungen ohne Abnahme. Die Anwendung dieser Methoden im Kontext von Dienstleistungsunternehmen und langfristigen Projekten wird erläutert.
Wie wird der Wertansatz unfertiger Leistungen behandelt?
Der Wertansatz wird im Kontext der Zugangs- und Folgebewertung nach Herstellungskosten und dem Niederstwertprinzip behandelt. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen bei der Bewertung immaterieller Leistungen in Dienstleistungsunternehmen im Vergleich zu materiellen Gütern in produzierenden Unternehmen.
Welche rechtlichen Grundlagen werden berücksichtigt?
Die Arbeit stützt sich auf die relevanten Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und behandelt sowohl den formellen Bilanzansatz (Ansatz dem Grunde nach) als auch den materiellen Bilanzansatz (Bewertung der Höhe nach).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen (Jahresabschluss nach HGB und Besonderheiten von Vorräten in Dienstleistungsunternehmen), ein Kapitel zu den rechtlichen Grundlagen der Bilanzierung unfertiger Leistungen, und eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Bilanzierung unfertiger Leistungen in Dienstleistungsunternehmen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Bilanzierung, unfertige Leistungen, Dienstleistungsunternehmen, HGB, Jahresabschluss, Wertansatz, Gewinnrealisierung, Herstellungskosten, Niederstwertprinzip, Completed-Contract-Methode, Teilabnahme, Teilabrechnung, Handelsrecht.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Bereich der Wirtschaftsprüfung und der Rechnungslegung, die sich mit der Bilanzierung in Dienstleistungsunternehmen auseinandersetzen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die umfassende Darstellung der Bilanzierung unfertiger Leistungen in Dienstleistungsunternehmen nach HGB, einschließlich der Herausforderungen bei der Wertansatzbestimmung und der Gewinnrealisierung, sowie eine kritische Bewertung der angewandten Methoden.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Möglichkeiten und Grenzen der Bilanzierung von unfertigen Leistungen im Dienstleistungsunternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/549686