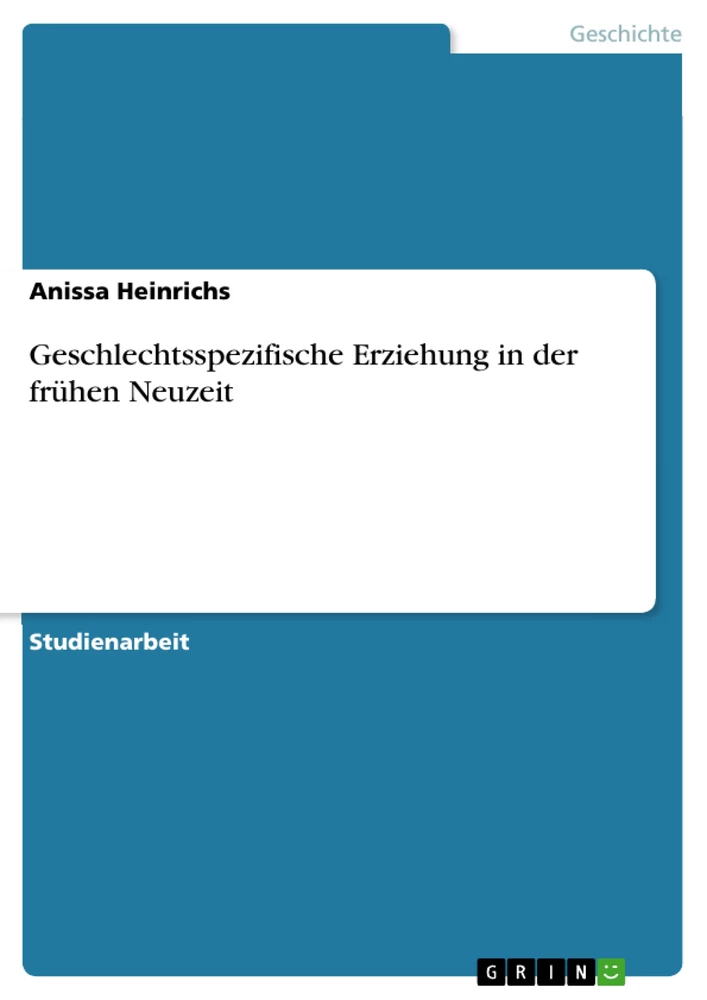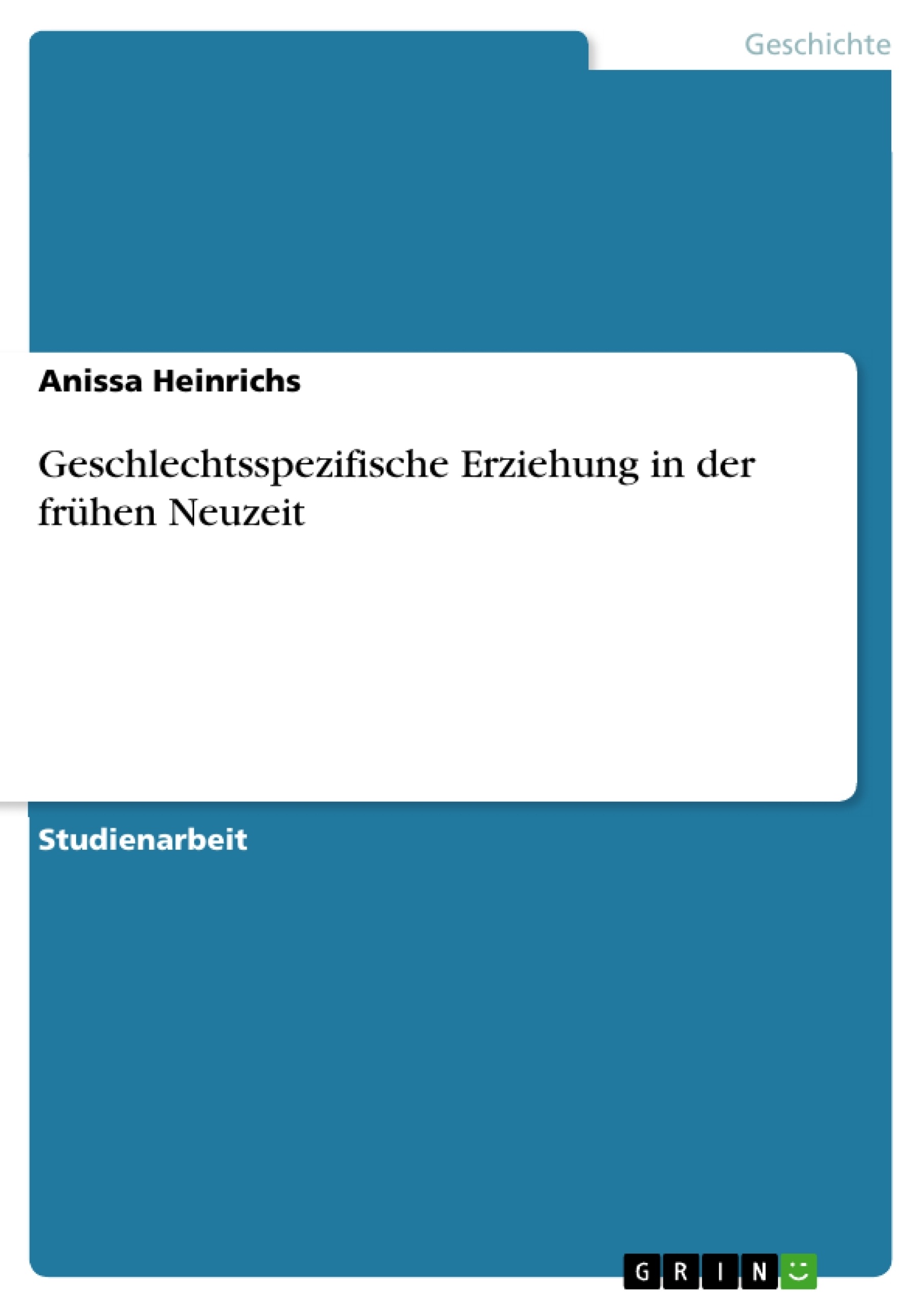Die Sozialenstrukturen und den Umgang mit anderen erlernt der Mensch in seiner Kindheit. Die Erziehung ist jedoch von Familie zu Familie und von Stand zu Stand unterschiedlich. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Kinder werden auf ihr Leben in der Erwachsenenwelt vorbereitet. Sie sollen alle Fertigkeiten erlernen, die man später in der Gesellschaft und im Beruf benötigt. Das gilt für damals ebenso wie für heute. Auch heute werden Kinder von den Eltern auf die Welt vorbereitet. Während im Mittelalter Erziehung und Bildung dem Adel und dem Klerus vorbehalten war, kamen in der Renaissance neben den kirchlichen Schulen sogenannte „Bürgerschulen“ auf. Nach dem Dreißigjährigen Krieg fordert Johann Amos Comenius in seiner Abhandlung „Didactica Magna“ von 1632 Allgemeinbildung für alle, unabhängig der Herkunft oder des Geschlechts. Später in der Aufklärung wird die Kindheit zum ersten Mal als ein wichtiger Lebensabschnitt begriffen.
In der frühen Neuzeit, hier ein festgelegter Zeitraum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, waren die Geschlechterrollen klar definiert.
Der Mann ist das Oberhaupt der Familie und der Ernährer. Er repräsentiert die Familie nach außen. Die Frau hingegen ist abhängig von ihrem Mann, der sie ernährt und beschützt. Sie hütet die Kinder und kümmert sich um den Haushalt. Ihre sozialen Kontakte gehen mehr nach innen in die Familie.
In meiner Arbeit möchte ich mich vor allem mit der Erziehung und Bildung der Frau beschäftigen. Wieso unterscheidet sich die Erziehung der Mädchen von der der Jungen? Wie sah es mit der Bildung aus? Gab es auch eine gemeinsame Erziehung der Geschlechter? Zu Beantwortung dieser Fragen habe ich hauptsächlich Literatur aus der Pädagogik mit dem Schwerpunkt Frauenbildung benutzt. Um das Thema weiter einzugrenzen, konzentriere ich mich nur auf die höheren Stände wie Bürgertum und Adel.
Im ersten Abschnitt werde ich auf das Leben der Frau in der frühen Neuzeit eingehen, um einen Überblick zu schaffen und auf die Frage einzugehen, warum die Mädchenerziehung anders ist und worauf das zurückzuführen ist.
Dann möchte ich einen Blick in die Erziehung und Bildung werfen, um schließlich auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Mädchen- und Jungenerziehung zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Er ist die Sonn`, sie ist der Mond“
- 2.1 Die Frau als Opfer oder Partner?
- 3. Bildung und Erziehung
- 3.1 Ein berühmtes Beispiel
- 3.2 Resümee
- 4. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die geschlechtsspezifische Erziehung in der frühen Neuzeit, insbesondere im Bürgertum und Adel. Sie beleuchtet die Unterschiede in der Erziehung von Mädchen und Jungen und hinterfragt die Gründe dafür. Der Fokus liegt auf der Bildung und den sozialen Rollen der Frauen in diesem Zeitraum.
- Geschlechtsspezifische Rollenverteilung in der frühen Neuzeit
- Unterschiede in der Erziehung von Mädchen und Jungen
- Zugang von Frauen zu Bildung und deren Auswirkungen
- Soziale Abhängigkeiten von Frauen und ihre gesellschaftliche Rolle
- Vergleich der Erziehungspraktiken verschiedener sozialer Schichten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der geschlechtsspezifischen Erziehung in der frühen Neuzeit ein. Sie betont die unterschiedlichen Erziehungspraktiken je nach sozialem Stand und Geschlecht und skizziert den historischen Kontext, der von klar definierten Geschlechterrollen geprägt war. Die Autorin erläutert ihre Forschungsfrage – die Untersuchung der Unterschiede in der Mädchen- und Jungenerziehung – und ihre methodische Vorgehensweise, die auf Literatur aus der Pädagogik mit Schwerpunkt Frauenbildung basiert. Der Fokus liegt auf den höheren Ständen, und die Arbeit soll einen Einblick in den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht und die Unterschiede in der Erziehung und Bildung im Vergleich zum männlichen Geschlecht bieten. Es wird klargestellt, dass die Arbeit keine umfassende Abhandlung des Themas sein kann, sondern einen fokussierten Einblick gewährt. Die Autorin benennt wichtige Quellen, insbesondere die Werke von Heide Wunder und Christiane Brokmann-Nooren.
2. „Er ist die Sonn`, sie ist der Mond“: Dieses Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen Zukunftsperspektiven für Mädchen und Jungen in der frühen Neuzeit. Mädchen wurden auf Haushalt und Familie vorbereitet, während Jungen entweder in die Fußstapfen des Vaters traten oder einen Beruf erlernten, um eine Familie zu ernähren. Die Frage der Bevorzugung eines Geschlechts wird diskutiert, wobei festgestellt wird, dass es sowohl Beispiele für die Bevorzugung von Söhnen als auch von Töchtern gab, je nach Familiensituation und individuellen Umständen. Das Kapitel beleuchtet den Zeitpunkt des Endes der Kindheit, der von den sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen abhing. Es wird der Unterschied zwischen der Dauer der Jugendzeit in verschiedenen sozialen Schichten herausgestellt, wobei Töchter aus höheren Ständen oft früh verheiratet wurden, während Bürgertöchtern und Mädchen aus der bäuerlichen Schicht mehr Zeit zur Verfügung stand. Das Kapitel betont die Abhängigkeiten von Frauen im täglichen Leben durch arrangierte Ehen und die Überführung von der Vormundschaft des Vaters in die des Ehemannes. Trotz dieser Abhängigkeiten wird betont, dass Frauen ihre Rolle oft gut spielten und in ihrer Lage ein gewisses Maß an Glück durch die Erfüllung sozialer Normen fanden. Die Bedeutung der Frauen im Haushalt und ihre Rolle als soziale Schlüsselpersonen innerhalb der Familie werden hervorgehoben, während Männer die Kontakte nach außen pflegten und in der Öffentlichkeit präsenter waren.
Schlüsselwörter
Geschlechtsspezifische Erziehung, Frühe Neuzeit, Frauenbildung, Geschlechterrollen, Sozialstruktur, Bürgertum, Adel, Mädchen- und Jungenerziehung, Familienstrukturen, soziale Abhängigkeiten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Geschlechtsspezifische Erziehung in der frühen Neuzeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die geschlechtsspezifische Erziehung in der frühen Neuzeit, insbesondere im Bürgertum und Adel. Sie beleuchtet die Unterschiede in der Erziehung von Mädchen und Jungen und hinterfragt die Gründe dafür. Der Fokus liegt auf der Bildung und den sozialen Rollen der Frauen in diesem Zeitraum.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie die geschlechtsspezifische Rollenverteilung, Unterschiede in der Mädchen- und Jungenerziehung, den Zugang von Frauen zu Bildung und dessen Auswirkungen, die sozialen Abhängigkeiten von Frauen und ihre gesellschaftliche Rolle sowie einen Vergleich der Erziehungspraktiken verschiedener sozialer Schichten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die unterschiedlichen Zukunftsperspektiven von Mädchen und Jungen ("Er ist die Sonn`, sie ist der Mond"), ein Kapitel über Bildung und Erziehung mit Unterkapiteln zu einem berühmten Beispiel und einem Resümee, und schließlich Schlussbetrachtungen.
Was ist das zentrale Thema des Kapitels „Er ist die Sonn`, sie ist der Mond“?
Dieses Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen Zukunftsperspektiven von Mädchen und Jungen in der frühen Neuzeit. Es analysiert die Vorbereitung von Mädchen auf Haushalt und Familie im Gegensatz zur Ausbildung von Jungen für berufliche Tätigkeiten. Es beleuchtet auch die Frage der geschlechtsspezifischen Bevorzugung, die Abhängigkeit von Frauen durch arrangierte Ehen und ihre Rollen innerhalb der Familie.
Wie wird das Thema Bildung und Erziehung behandelt?
Das Kapitel über Bildung und Erziehung untersucht die Unterschiede in der Erziehung von Mädchen und Jungen. Es enthält ein Beispiel, das die Thematik veranschaulicht, und fasst die Erkenntnisse zusammen.
Welche Quellen werden genannt?
Die Arbeit nennt insbesondere die Werke von Heide Wunder und Christiane Brokmann-Nooren als wichtige Quellen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussbetrachtungen fassen die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und bieten einen abschließenden Überblick über die geschlechtsspezifische Erziehung in der frühen Neuzeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geschlechtsspezifische Erziehung, Frühe Neuzeit, Frauenbildung, Geschlechterrollen, Sozialstruktur, Bürgertum, Adel, Mädchen- und Jungenerziehung, Familienstrukturen, soziale Abhängigkeiten.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für die Geschichte der Frauen und die geschlechtsspezifische Erziehung in der frühen Neuzeit interessiert.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen können in den genannten Werken von Heide Wunder und Christiane Brokmann-Nooren gefunden werden.
- Citar trabajo
- Anissa Heinrichs (Autor), 2005, Geschlechtsspezifische Erziehung in der frühen Neuzeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54913