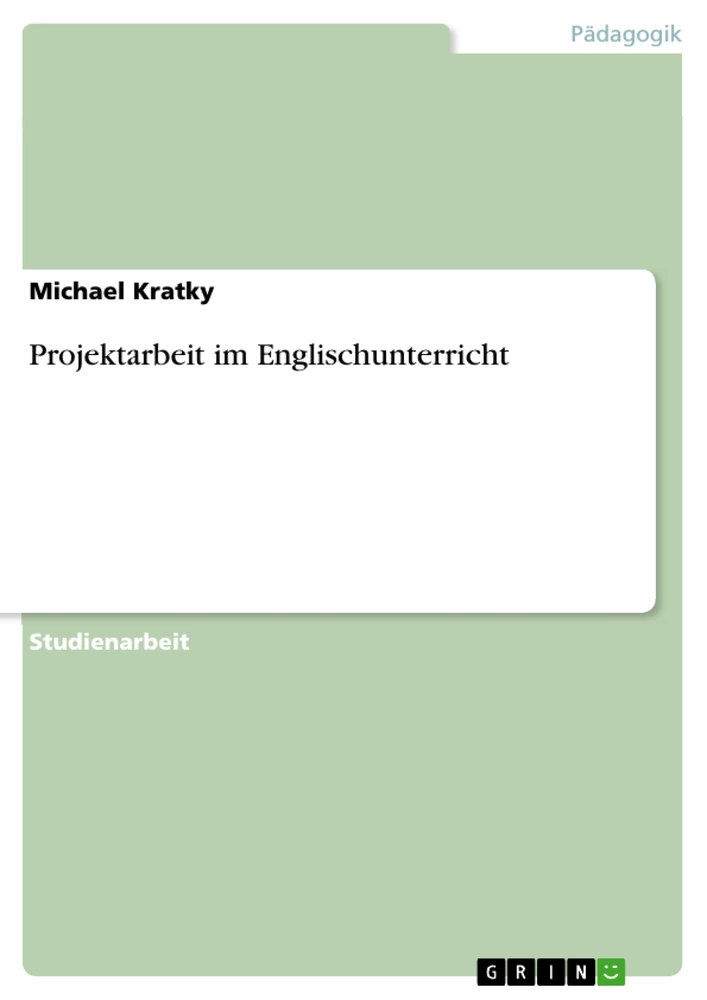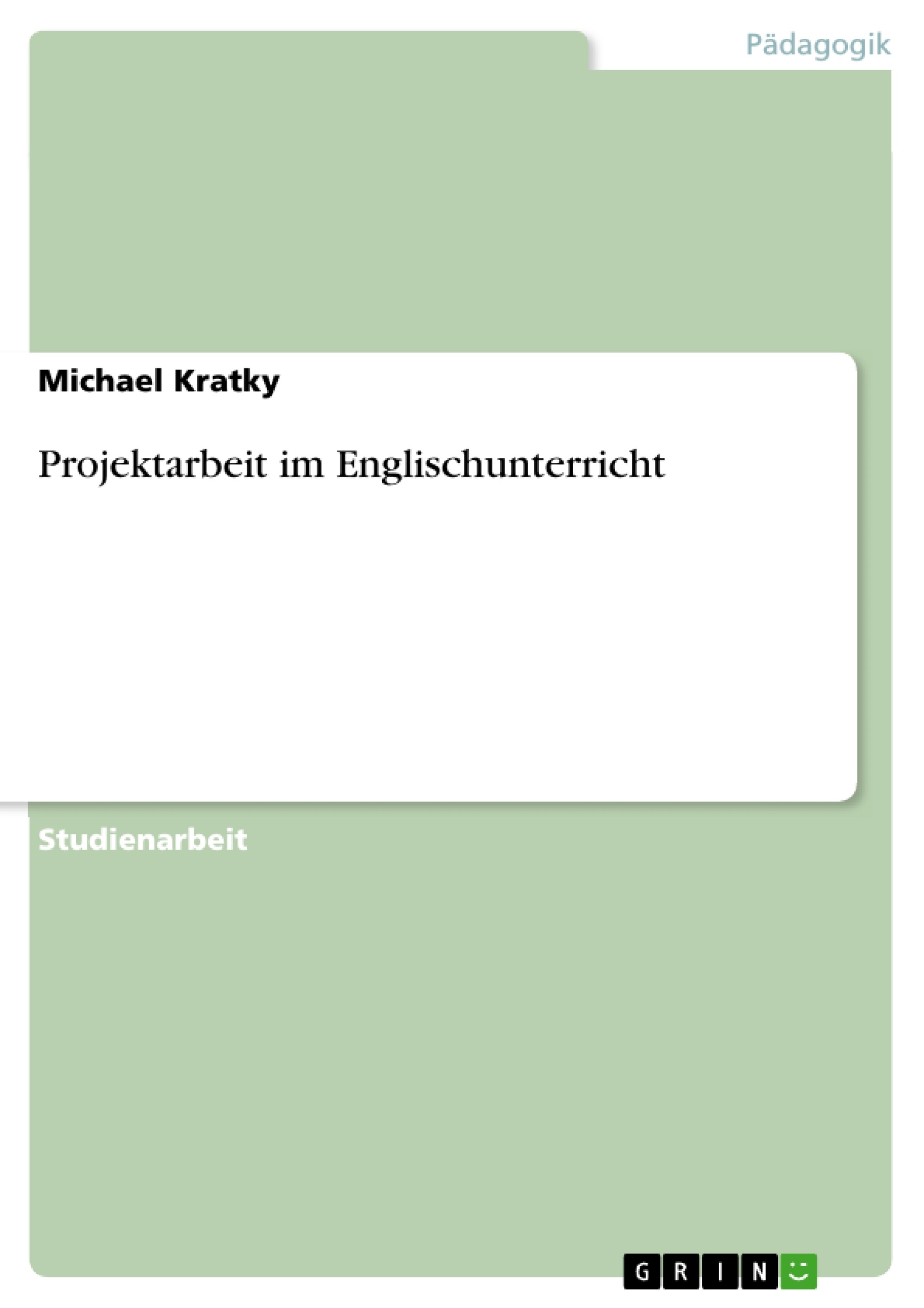Am Beispiel des Projektunterrichts wird eine Möglichkeit gezeigt, der immer lauter werdenden Forderung nach einer Ausbildung von Kompetenzen und Qualifikationen, die über reine fachliche Befähigungen hinausgehen, gerecht zu werden. Mit dem Projekt "Klassenfahrt nach London" verbinden sich fremdsprachliche Qualifikationen mit dem unter anderem von Legutke geprägten Begriff der Projektkompetenz: Die Schüler erleben nicht nur den authentischen Nutzen der Fremdsprache, die manchmal nur als Abstraktum wahrgenommen wird, und bedienen sich ihrer, um ihre Fahrt nach London zu organisieren. Sie erfahren vielmehr, was es bedeutet, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, Verantwortung im Team für einen bestimmten Tätigkeitsbereich zu übernehmen und damit zum Gelingen eines größeren Projektes beizutragen. Gerade eine Klassenfahrt stellt hinsichtlich der sozialen Kompetenzen der Schüler eine große Herausforderung dar, da man im Schulalltag nie so lange und so intensiv Zeit miteinander verbringt und zusätzlich noch weitreichende Aufgaben zu erledigen hat. Insofern hat der Projektunterricht und besonders die Durchführung des Projektes nach der Planungsphase Modellcharakter für ganzheitliches Lernen und trägt zur Qualifikation von Schülern und Lehrern in Richtung Kernkompetenzen wie Teamarbeit, Organisationsfähigkeit, Kreativität, aber auch Spontaneität und Routine bei unvorhergesehen Situationen bei.
Im ersten Teil dieser Arbeit soll nach einer Begriffsdefinition und –Abgrenzung die Projektarbeit dargestellt, entsprechende Zielsetzungen erläutert und kritisch beleuchtet werden, bevor im zweiten Teil ein konkretes Unterrichtsprojekt für den Englischunterricht präsentiert wird.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Rechtfertigung der Forderung nach Projekt(orientiertem)4 Unterricht
2. Theoretische Überlegungen zum Projektunterricht
2.1 Begriffe und Definitionen
2.2 Schema des Projektprozesses
2.2.1 Projektvorbereitung
2.2.2 Projektdurchführung
2.2.3 Projektnachbereitung
2.2.4 Fixpunkte und Metainteraktionen
2.3 Lehrer-Schüler-Perspektiven
2.4 Kritische Gesichtspunkte
3. Projekt: Klassenfahrt nach London
3.1 Grundidee
3.2 Konzeption
3.3 Projektbeschreibung
3.3.1 Vorbereitung und Planung
3.3.2 Durchführung
3.3.3 Nachbereitung
4. Schlussgedanke
5. Literaturverzeichnis
1. Rechtfertigung der Forderung nach Projekt(orientiertem) Unterricht
Im Zuge der Globalisierung ergeben sich für den Unterricht neue Lernziele. Es besteht die Forderung und die Notwendigkeit, den Unterricht an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Für den Englischunterricht bedeutet dies zum Beispiel, dass neben der zu erwerbenden sprachlichen und landeskundlichen Kompetenz, Werte und Befähigungen wie Kommunikationskompetenz, Teamarbeit und die Fähigkeit, gemeinsam Probleme zu lösen, an Wert gewinnen. Ebenso werden aus der Wirtschaft, einem wichtigen späteren Betätigungsfeld für die Schüler, Forderung unter anderem nach den oben genannten Kompetenzen lauter, die man in die Reihe der Schlüsselqualifikationen eingliedern kann.
Die lineare Arbeit mit dem Lehrbuch und die stetige Abfolge von Übungssequenzen in einer frontal unterrichteten Schulklasse können diese Forderungen nicht erfüllen. Zudem haben Lehrwerk und Lehrperson ihr Monopol über die Informationsquellen für die Schüler längst verloren. Letztere können sich mit Hilfe des Internets eines außerordentlich breiten Spektrums an Informationsquellen bedienen, die aber nicht wie im Lehrbuch strukturiert sind, sondern völlig ungeordnet auf sie einströmen. Der Umgang mit dieser neuen Situation muss zu den Zielen eines ganzheitlichen Unterrichts zählen.
Eine Möglichkeit, auf diese Gegebenheiten angemessen zu reagieren und den Bildungsauftrag der Schule ernsthaft zu erfüllen, stellt der Projektunterricht oder zumindest projektorientierter Unterricht dar. Im Folgenden soll im ersten Teil dieser Arbeit nach einer Begriffsdefinition und –Abgrenzung die Projektarbeit dargestellt, entsprechende Zielsetzungen erläutert und kritisch beleuchtet werden, bevor im zweiten Teil ein konkretes Unterrichtsprojekt für den Englischunterricht präsentiert wird.
2. Theoretische Abhandlung des Projektunterrichts
2.1 Begriffe und Definitionen
In der Schulpädagogik kennt man die Begriffe “Projektunterricht”, “projektartiger” oder “projektorientierter Unterricht” oder schlicht “Projekt”. Man kann Projektunterricht als
ganzheitliche, integrative Lernform […], der ein Höchstmaß an curricularer Offenheit zukomme und die den bestmöglichen Raum für Lernermitbestimmung und Schülerorientierung bei Themenfindung und Lernzielfestlegung, für Binnendifferenzierung und kooperatives Verhalten bereitstelle […][1]
sehen, der aus verschiedenen Komponenten oder Phasen besteht, die im Abschnitt 2.2 näher erläutert werden. Stütz sich das Vorgehen der Projektgruppe, also zum Beispiel der Schulklasse, nicht gänzlich auf diese Komponenten, sondern nur auf zwei oder drei davon, spricht man von projektorientiertem oder projektartigem Lernen.
Karl Frey erinnert mit dem Begriff „Projektmethode“ an William H. Kilpatricks „The Project Method“ von 1918 und verdeutlicht damit, das die Wurzeln für seine Projektmethode im amerikanischen Pragmatismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts liegen. Er spricht bewusst nicht von Projektunterricht, weil seine Konzeption über institutionell organisierten Unterricht hinausgeht, also auch für Erwachsenenarbeit, außerschulische Jugendarbeit und im Beruf Geltung besitzen. Da die Projektmethode immer auf die lokale Situation und die Teilnehmerinteressen Rücksicht nimmt, ist eine präzise Definition schwierig.[2]
Behelfen kann man sich mit einem Merkmalskatalog, einer Auflistung der Charakteristika von Projekten. Nach Gudjons zeichnen sich Projekte durch Situationsbezogenheit mit einer Verbindung zum wirklichen Leben und Interessensbezogenheit aus. Das Interesse kann dabei auch erst im Laufe des Projekts entstehen. Projekte sollen zudem gesellschaftsrelevant und handlungsorientiert sein, wobei körperliche und geistige Arbeit gefragt sind und möglichst alle Sinne angesprochen werden sollen. Ein wichtiges Charakteristikum stellt die zielgerichtete Planung dar, die einen zeitlichen Rahmen, Selbstorganisation und Selbstverantwortung der Schüler und Kooperation sowie Gruppenarbeit bzw. Teamwork mit einschließt. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Wichtigkeit eines positiven Beziehungsgefüges hingewiesen, in dem womöglich auftretende Spannungen und Konflikte aufgespürt und gelöst sein wollen. Im Übrigen sind Projekte im Idealfall interdisziplinär angelegt, was bereits einen Hinweis auf die Schwierigkeiten im Zusammenhang des „im 45-Minutentakt gegliederten Fächerpotpourri des Schulalltags“[3] zulässt, auf die später in einer kritischen Stellungnahme zum Projektunterricht eingegangen wird.[4]
Im Folgenden wird der Begriff Projektunterricht verwendet, muss allerdings als Idealform gesehen werden und ist im Gegensatz zu Freys Projektmethode speziell auf den schulischen Unterricht bezogen, in dessen Umfeld schließlich auch das Beispielprojekt im Punkt 3. gesehen werden muss.
2.2 Schema des Projektprozesses
Einen Projektablauf kann man idealtypisch in verschiedene Phasen und Komponenten einteilen, die den Prozess sowohl chronologisch ordnen als auch, wie bei Frey, strukturelle Momente wie Fixpunkte und Metainteraktionen beinhalten. Das folgende Schema stellt eine Synthese aus den sieben Komponenten bei Frey bzw. acht Phasen bei Legutke dar. Es ist in drei chronologische und zwei strukturelle Momente unterteilt.
2.2.1 Projektvorbereitung
Startpunkt für ein Projekt ist eine Projektinitiative, bei der es unwichtig ist, von wem sie kommt, allerdings muss sie auf die Bedürfnisse und Interessen der Beteiligten treffen. Wichtig ist nach Frey die Offenheit der Ausgangssituation – im Idealfall kommt der Anstoß zum Projekt nicht vom Lehrer – andererseits schreibt der Lehrplan oft ein bestimmtes Stoffgebiet vor wie dies im institutionellen Rahmen der Schule der Regelfall ist. Die Schwierigkeit besteht in diesem Fall darin, von der engen Ausgangssituation in die offene Projektarbeit überzuleiten. Nach Frey können Techniken wie zum Beispiel die Ausweitungsfrage, stimulierende Hinweise, oder ein Ideenwettbewerb angewandt werden.[5]
Legutke spricht von opening the field of awarness in der ersten Prozessphase, in der eine Sensibilisierung für das Thema, eine Mobilisierung von Vorwissen, ein Wecken von Neugier und der Austausch von persönlichen Erfahrungen stattfinden können.[6]
An dieses erste Herantasten schließt sich eine nähere Auseinandersetzung mit der Projektidee, Legutke nennt diese Phase die Orientierungsphase, in der auch die Gruppenbildung stattfindet. Zentral sind in dieser Phase das Bewusstmachen des Forschungsfeldes, die Wahrnehmung von möglichen Schwierigkeiten, möglicherweise auch das Formulieren von ersten Hypothesen. Das Ergebnis der Auseinandersetzung mit der Projektidee ist eine meist schriftlich fixierte Projektskizze, die die Grundlage für den wichtigsten Schritt in der Vorbereitungsphase bildet: die Erstellung eines konkreten Projektplans.
Die einzelnen Gruppen erarbeiten hier gemeinsam nach einer Themenkonkretisierung und entsprechender Interessensartikulation präzise Projektaufgaben, erstellen Fragebögen und Interviews, bauen Kontakte über Telefon, Post, Email, Internetforen, Chats auf und legen ein genaues Zeitbudget fest. Schüler müssen also besonders befähigt werden, „sich aktiv um Informationsquellen und Ressourcen zu bemühen, […] Kontakte mit Menschen aufzunehmen und aufrechtzuerhalten“[7]. Häufig muss hier eine Auswahl der noch in der Projektskizze festgehaltenen Überlegungen getroffen werden, da sonst entweder das Zeitbudget gesprengt oder Fertigkeits- und Kompetenzdefizite einer Verwirklichung im Wege stehen würden. Hier kann der Lehrer als Manager wichtige Anregungen liefern. Am Ende steht fest,
wer im weiteren Verlauf des Projektes
welche Art von Tätigkeiten
intensiv
für eine längere Zeit
ausführen wird.[8]
[...]
[1] Legutke, Michael: Lebendiger Englischunterricht. Kommunikative Aufgaben und Projekte für schüleraktiven Unterricht. Bochum: Kamp, 1988. S.185
[2] Frey, Karl: Die Projektmethode. (8. Auflage 1998). Weinheim und Basel: Belz, 1982. S. 14
[3] Legutke, 1988, S.185
[4] vgl. Gudjons, Herbert: Handlungsorientiert lehren und lernen: Projektunterricht und Schüleraktivität.
Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1986. S. 57 ff.
[5] vgl. Frey, 1998, S. 92 ff.
[6] vgl.Legutke, 1988. S. 215
[7] Martin, Jean-Pol: „Weltverbesserumgskompetenz als Lernziel?“ in: Pädagogisches Handeln,
6.Jahrgang, Heft 1, 2002. S.71
[8] Frey, 1998, S. 140
- Quote paper
- Michael Kratky (Author), 2005, Projektarbeit im Englischunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54900