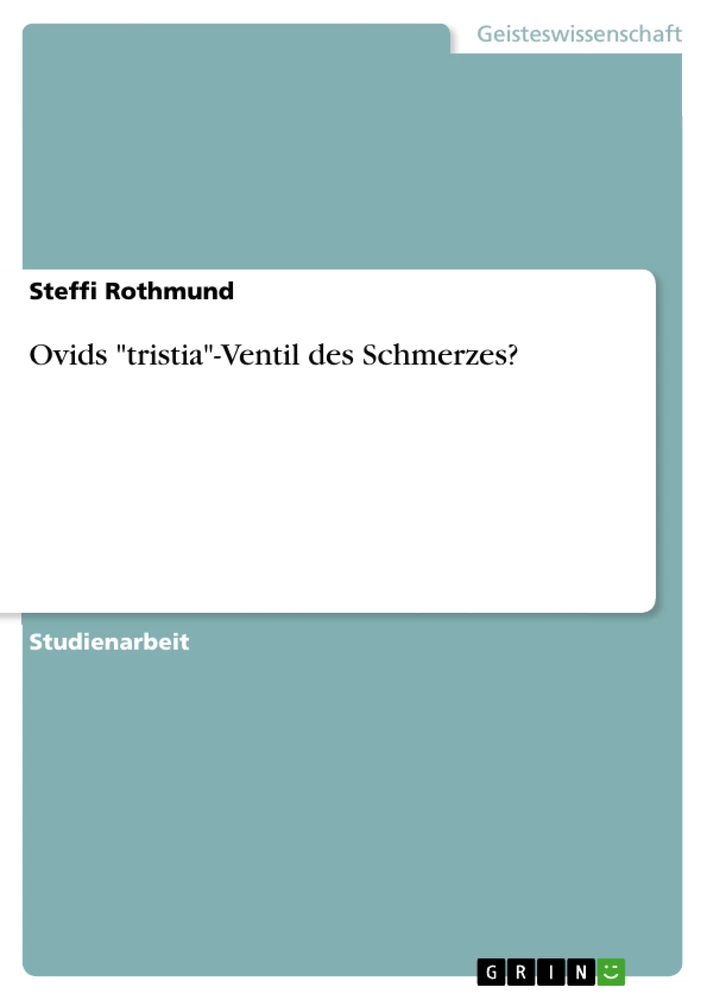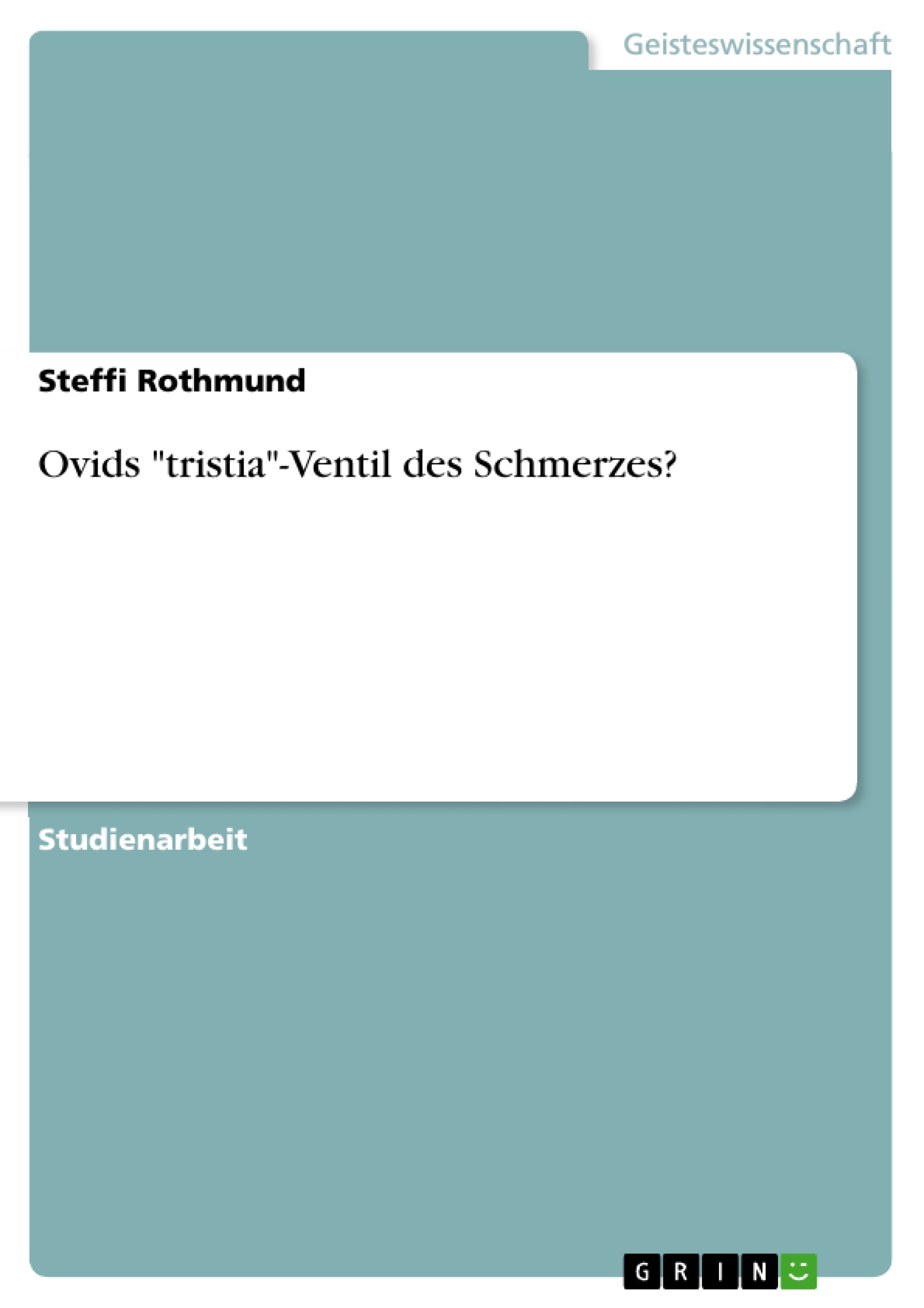Ovids „Tristia“ lassen sich gut mit der Phrase „sich etwas von der Seele schreiben“ verbinden, auch wenn in der Forschung kein Konsens darüber besteht: Die Einen sehen die „Tristien“ als „Jammerpoesie eines Jammerlappens“1, andere behaupten sogar, Ovid sei niemals im Exil gewesen. So wird in der Forschung als wichtiger Aspekt vor allem die Funktion der „Tristia“ für Ovid immer wieder erörtert. Auch diese Arbeit befasst sich damit, die Funktion der „Tristien“ für Ovid herauszuarbeiten und zu beurteilen. Der Schwerpunkt liegt in der Frage, ob die Trauerlieder des Ovid als Ventil gelten können, also ob Ovid hauptsächlich schreibt, um seinen aus der Verbannung resultierenden Kummer zu verarbeiten. Hierzu ist es unerlässlich, zunächst einmal darzustellen, was Ovid denn genau Kummer bereitet hat, weshalb seine Situation in der neuen Heimat Tomis dargestellt wird. Im Anschluss daran wird Wilfried Strohs Arbeit „Tröstende Musen“ vorgestellt, die sich als erste sehr ausführlich mit den „Tristia“ unter dem Aspekt der Tröstung durch die Musen beschäftigt hat und dadurch einen Einbezug in diese Arbeit rechtfertigt. Wilfried Stroh beschreibt den Topos der Selbstaussprache in der Dichtung und stellt die These auf, dass Ovids Dichtung als Ventildichtung angesehen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ovids Situation
- Neue Heimat Tomis und Sehnsucht nach Rom
- Ovid in seiner neuen Situation
- Trost im Schreiben
- Wilfried Stroh: Tröstende Musen
- Trost beim Schreiben: Sinn und Funktion eines Tagebuchs
- „Tristia\" als Ventil des Schmerzes?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Funktion der „Tristia“ für Ovid und untersucht, ob die Trauerlieder des Ovid als Ventil für seinen Kummer aus der Verbannung dienen können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, wie Ovid seinen Schmerz verarbeitet und ob die Dichtung als Ventildichtung betrachtet werden kann.
- Ovids Leben und seine Situation in Tomis
- Die Rolle der „Tristia“ als Ventil für Ovids Schmerz
- Wilfried Strohs These von der Dichtung als Ventildichtung
- Die Funktion des Tagebuchschreibens im Kontext der „Tristia“
- Die „Tristia“ als Ausdruck von Ovids Sehnsucht nach Rom
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der „Tristia“ und ihre Bedeutung für Ovids Leben dar. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf die „Tristien“ in der Forschung und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
- Ovids Situation: Dieses Kapitel beschreibt Ovids Situation in seiner neuen Heimat Tomis. Es geht dabei um seine Sehnsucht nach Rom, die Sprachbarrieren, die klimatischen Bedingungen und die negative Darstellung der Skythen als „nordöstliche Barbaren“.
- Trost im Schreiben: Dieses Kapitel untersucht die Funktion des Schreibens für Ovid als Trostquelle. Es stellt Wilfried Strohs Arbeit „Tröstende Musen“ vor, die sich mit der „Tristia“ als Ventildichtung beschäftigt. Außerdem werden Parallelen zwischen Ovids Schreiben und dem Phänomen des Tagebuchschreibens gezogen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Ovid, „Tristia“, Verbannung, Ventildichtung, Trost, Tagebuchschreiben, Tomis, Skythen, Wilfried Stroh, Musen.
- Quote paper
- Steffi Rothmund (Author), 2006, Ovids "tristia"-Ventil des Schmerzes?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54835