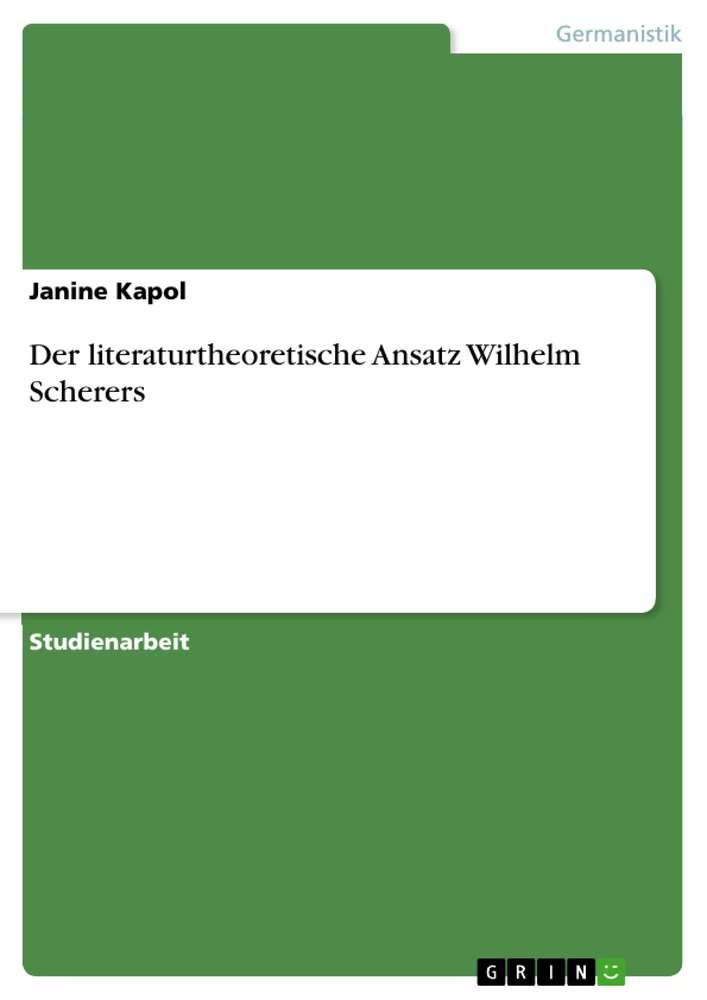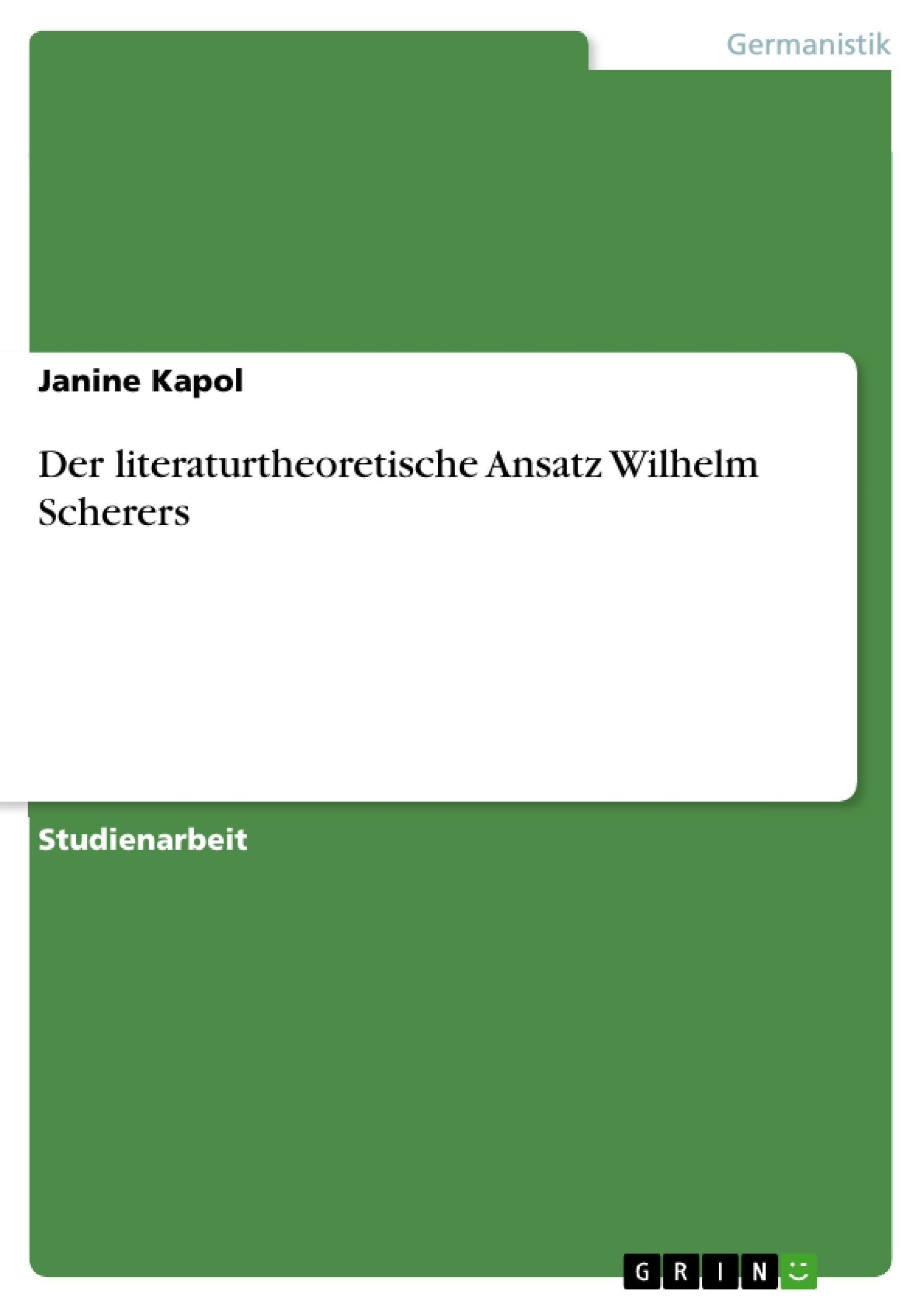Der 1841 in Österreich geborene Wilhelm Scherer gilt als einflussreicher Positivist und Literaturhistoriker. Unzufrieden mit seinem Studium in Wien, wechselte et 1860 nach Berlin über. In der Auseinandersetzung mit Scherer wird vor allem ein Aspekt deutlich, der nicht immer zureichend in der Sekundärliteratur akzentuiert wird, nämlich der, dass es bei Scherer nicht einfach eine programmatische Linie gibt. Zwar finden wir bestimmte Leitprinzipien, wie das Kausalitäts- und Determinismusprinzip, jedoch diese im Verlaufe seines Lebens in unterschiedlicher Ausprägung. So ist sein Drang, alle äußeren Einflussfaktoren herauszustellen, die dann die Dichterpersönlichkeit bilden, besonders in seinen frühen Schriften (Aufsatz über Grillparzer) ausgeprägt. Grundsätzlich wird mit der Zeit ein Zurücktreten von Biographismus und mechanischer Ursachenforschung deutlich und auch der Wert psychologischer Erkenntnisse wird miteinbezogen. In Rahmen dieser Arbeit möchte ich zunächst zwei zentrale Werke Scherers behandeln, anhand der gewonnenen Erkenntnisse im Anschluss die Hauptpunkte seiner Programmatik erläutern und schließlich auf Kritik und die seinem Denken folgende „Scherer-Schule“ eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Geschichte der deutschen Literatur”
- Die methodologische Programmatik
- „Poetik”
- Rezension und Kritik
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den literaturtheoretischen Ansatz von Wilhelm Scherer, einem einflussreichen Positivisten und Literaturhistoriker des 19. Jahrhunderts. Die Arbeit untersucht Scherers programmatische Linie, die sich im Laufe seines Lebens in ihrer Ausprägung wandelte. Es wird insbesondere auf die Entwicklung von Scherers Herangehensweise an die Literaturgeschichte, von biographischem Determinismus hin zu einer stärkeren Einbeziehung psychologischer Erkenntnisse, eingegangen. Zudem wird die „Geschichte der deutschen Literatur“ (1883) als zentrales Werk Scherers analysiert.
- Die Entwicklung des literaturtheoretischen Ansatzes von Wilhelm Scherer
- Die Bedeutung des Kausalitäts- und Determinismusprinzips in Scherers Werk
- Die Rolle der „Geschichte der deutschen Literatur“ in der Literaturgeschichte
- Scherers Kritik an der Literaturgeschichte seiner Zeit
- Die „Scherer-Schule“ und ihre Rezeption von Scherers Werk
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt Wilhelm Scherer als einflussreichen Positivisten und Literaturhistoriker vor und skizziert seine Entwicklung von einem starken biographischen Determinismus hin zu einer stärkeren Berücksichtigung psychologischer Erkenntnisse.
- „Geschichte der deutschen Literatur”: Dieses Kapitel behandelt Scherers einflussreichstes Werk und beleuchtet dessen Entstehungsgeschichte, Ziele und Kritikpunkte. Im Fokus steht Scherers These von drei Blüteperioden der deutschen Literaturgeschichte, die er anhand von exemplarischen Werken beleuchtet.
Schlüsselwörter
Wilhelm Scherer, Literaturgeschichte, Positivismus, Determinismus, „Geschichte der deutschen Literatur“, Blüteperioden, Heldenlieder, Frauen in der Literatur, Scherer-Schule, Rezeption.
- Quote paper
- Janine Kapol (Author), 2006, Der literaturtheoretische Ansatz Wilhelm Scherers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54819