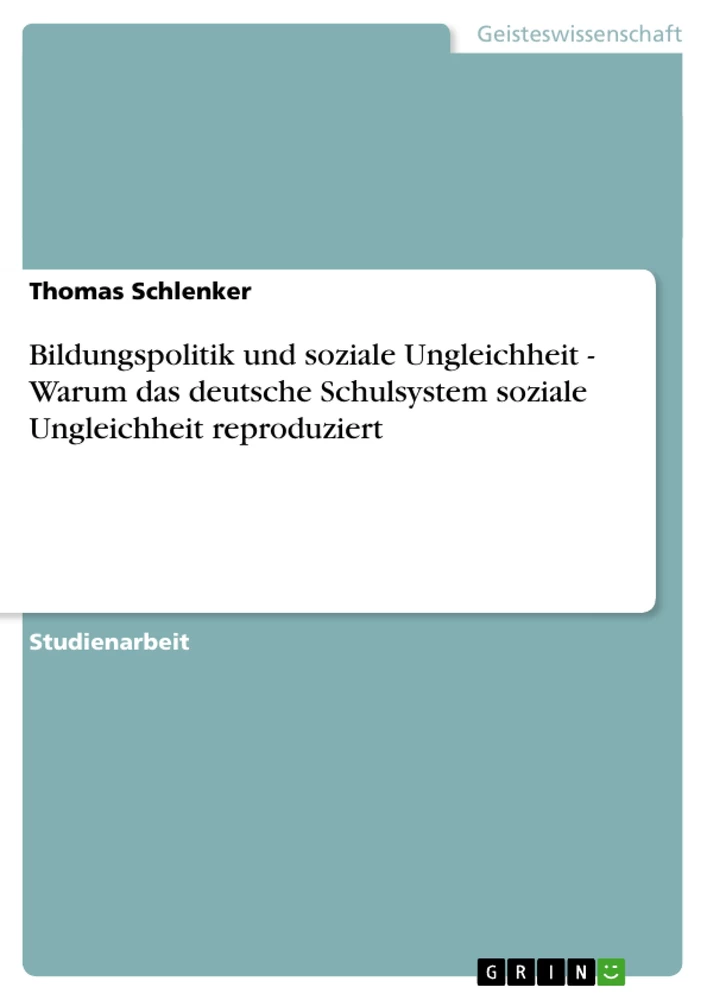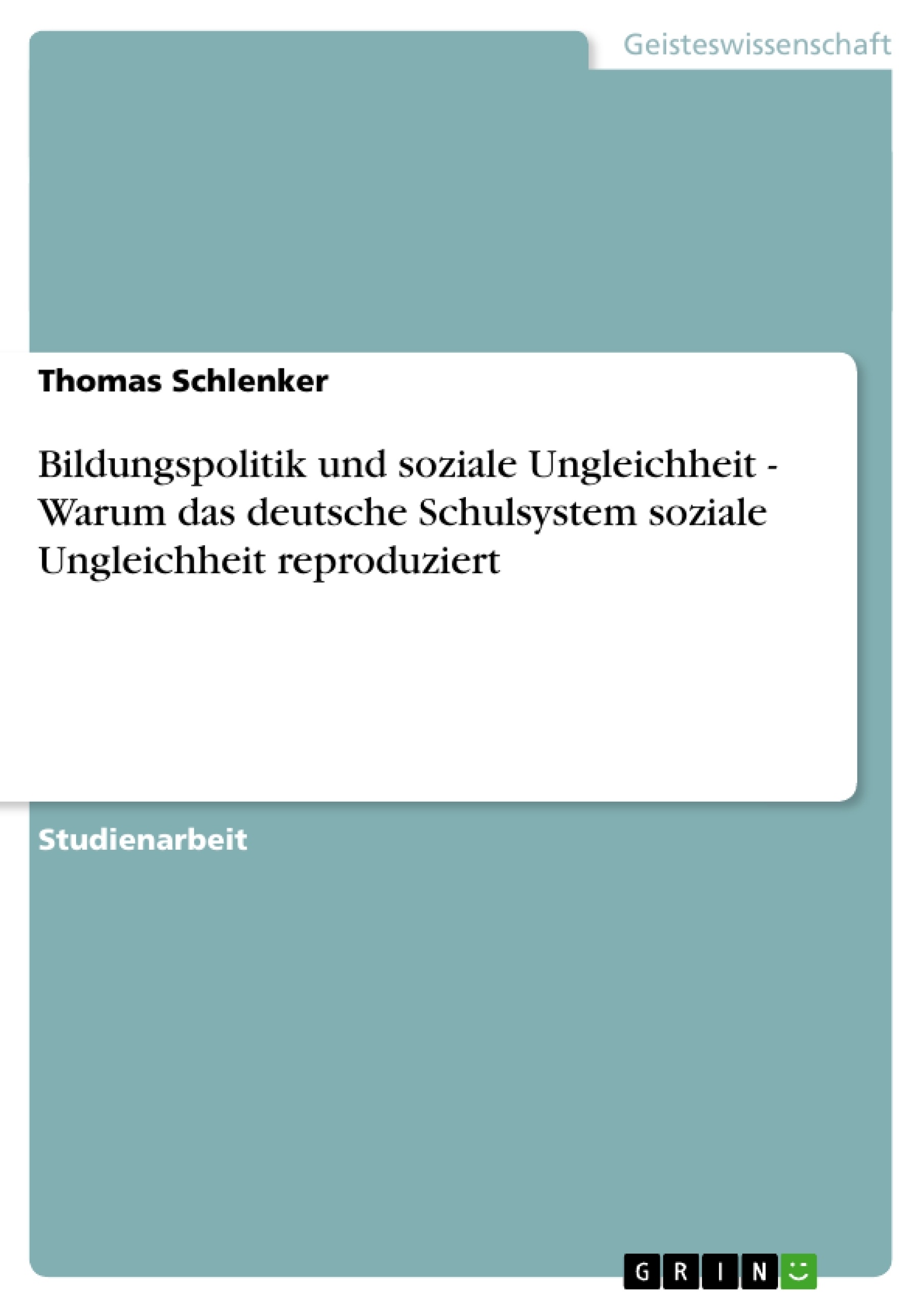Nachdem das deutsche PISA-Konsortium im Herbst 2005 die Details der zweiten im Jahre 2003 durchgeführten PISA-Studie veröffentlicht hatte, wurde im gesellschaftlichen Diskurs neben dem allgemeinen Leistungsniveau deutscher Schülerinnen und Schüler besonders auch der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und den Bildungschancen thematisiert. Diese Arbeit reflektiert daher, unter Berücksichtung der beiden bisher in den Jahren 2000 und 2003 durchgeführten PISA-Studien, den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und den Bildungschancen. Da ein gerechter Zugang zu Bildungsmöglichkeiten einen Schlüssel für die zukünftige Verringerung allgemeiner sozialer Ungleichheiten darstellt, ist dieses Thema in Bezug auf die Zukunftsgestaltung in der Bundesrepublik Deutschland von zentraler Bedeutung.
Im Anschluss zur Darstellung der in den PISA-Studien gewonnen Erkenntnissen werden die aktuellen Schwierigkeiten bei der Entkopplung von Bildungschancen und der sozialen Herkunft thematisiert. Dieses Buch liefert somit klare Fakten, die im aktuellen Diskurs über die Umgestaltung des deutschen Bildungssystems berücksichtigt werden müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- PISA was ist das (überhaupt)?
- Bedingungen für Schulische Erfolge
- Soziales Kapital und kulturelles Kapital
- Soziales Kapital
- Kulturelles Kapital
- Die Befunde von PISA 2000
- Besuchte Schulformen im Bezug zur sozialen Herkunft
- Die Bedeutung der sozialen Herkunft im internationalen Vergleich
- Statistik für Nichtstatistiker
- Mittelwerte
- Streuung, Varianz und Standardabweichung
- Positionen der Rot-Grünen Bundesregierung (2002 bis 2005)
- Die Befunde von PISA 2003
- Der neue Index des ökonomischen, sozialen und kulturellen Status (ESCS)
- Besuchte Schulformen in Bezug zum ESCS
- Die Bedeutung der sozialen Herkunft im internationalen Vergleich
- Ein Vergleich von PISA 2000 und PISA 2003
- Reaktionen auf PISA
- Was Soziologen und Bildungsforscher schon lange beschäftigt
- Reaktionen und Aktionen der Politik nach PISA
- Die aktuelle politische Lage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen im deutschen Schulsystem, insbesondere im Kontext der PISA-Studien. Sie analysiert, wie die PISA-Befunde die Bedeutung der sozialen Herkunft für den Bildungserfolg beleuchten und welche Konsequenzen diese Erkenntnisse für die Bildungspolitik haben.
- Die Rolle der PISA-Studien bei der Analyse von Bildungsungleichheit
- Die Bedeutung von sozialem und kulturellem Kapital für den Bildungserfolg
- Der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Wahl der Schulform und die Bildungschancen
- Die Herausforderungen bei der Entkopplung von Bildungschancen und sozialer Herkunft
- Die Reaktionen der Politik auf die PISA-Ergebnisse und die aktuelle politische Debatte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema „Bildungspolitik und soziale Ungleichheit“ vor und erklärt die Relevanz der PISA-Studien für die Analyse von Bildungschancen im Kontext der sozialen Herkunft. Kapitel 2 erläutert die PISA-Studien und deren Zielsetzung. Kapitel 3 betrachtet die Bedingungen für schulische Erfolge, insbesondere das Konzept von sozialem und kulturellem Kapital nach Bourdieu.
Kapitel 4 analysiert die Befunde von PISA 2000, insbesondere den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und besuchter Schulform. Kapitel 5 führt in grundlegende statistische Konzepte ein, die für die Interpretation der PISA-Daten relevant sind. Kapitel 6 analysiert die Befunde von PISA 2003, insbesondere den neuen ESCS-Index und die Bedeutung der sozialen Herkunft für den Bildungserfolg. Kapitel 7 vergleicht die Befunde von PISA 2000 und PISA 2003 und zeigt die Kontinuitäten und Veränderungen in Bezug auf den Einfluss der sozialen Herkunft.
Kapitel 8 beleuchtet die Reaktionen der Politik auf die PISA-Ergebnisse und diskutiert die aktuellen politischen Debatten und Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungschancen.
Schlüsselwörter
PISA-Studien, Bildungspolitik, soziale Ungleichheit, Bildungschancen, soziale Herkunft, soziales Kapital, kulturelles Kapital, ESCS-Index, Bildungsressourcen, Leistungsniveau, Schulform, Bildungsforscher, politische Debatte.
- Quote paper
- Thomas Schlenker (Author), 2006, Bildungspolitik und soziale Ungleichheit. Warum das deutsche Schulsystem soziale Ungleichheit reproduziert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54704