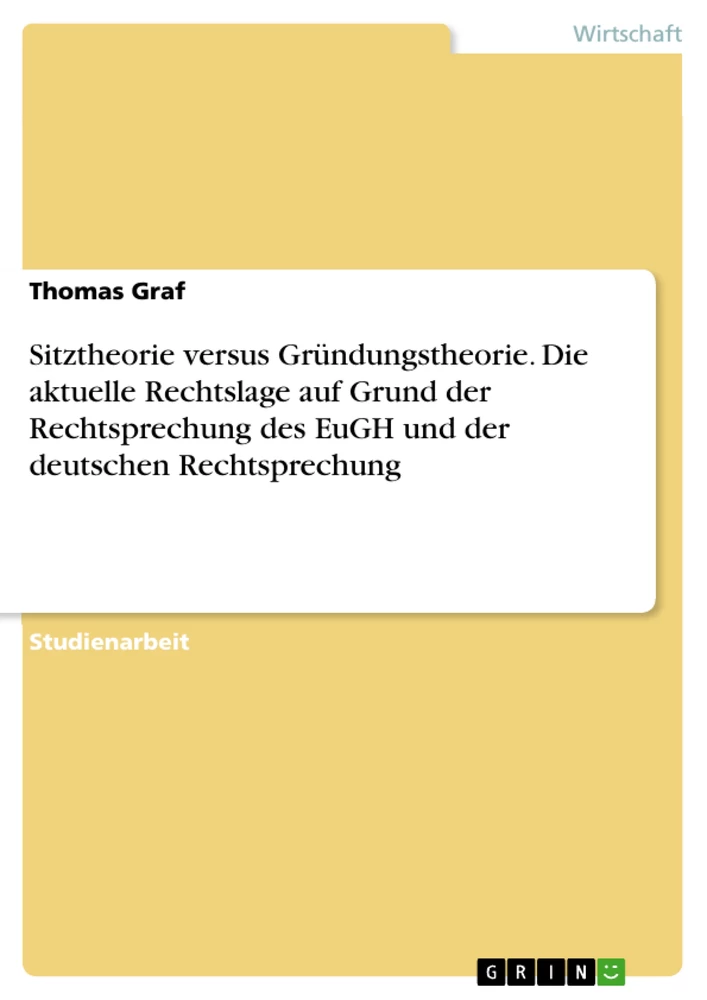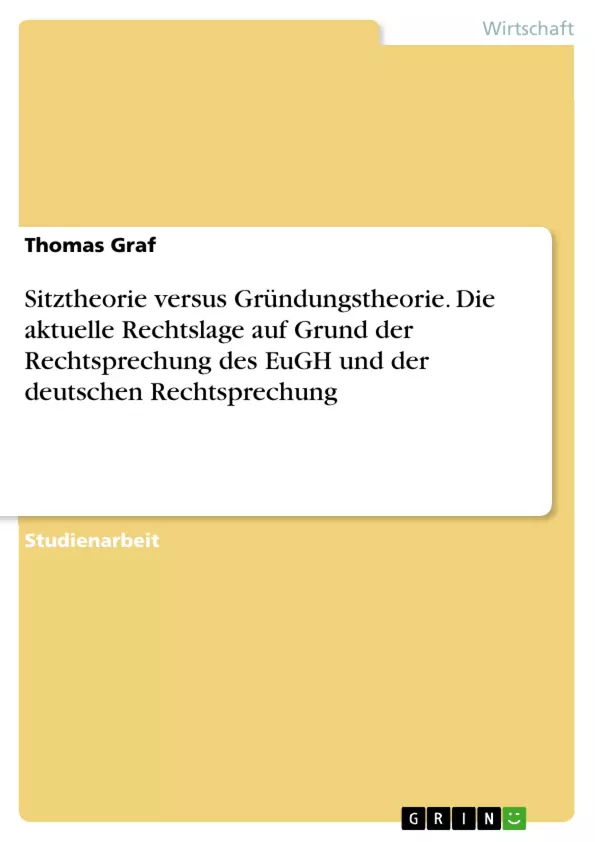Die Europäische Union gewinnt immer stärker an Bedeutung. Europäisches Recht beeinflußt schon seit längern die deutsche Rechtssprechung. Aus diesem Hintergrund wird die Fragestellung, ob die im deutschen Gesellschaftsrecht geltende Sitztheorie zu Gunsten der Gründungstheorie vollständig aufgegeben wurde, betrachtet.
Die Niederlassungsfreiheit ist ein europäisches Grundrecht. Es ermöglicht Gesellschaften ihre Hauptniederlassung in jedes Staatsgebiet eines Mitgliedstaates zu verlegen und Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften zu gründen.
Nach der im deutschen Gesellschaftsrecht vorherrschenden Sitztheorie richtet sich die Bestimmung des Gesellschaftsstatuts nach dem Ort, an welchem die Gesellschaft ihren tatsächlichen Verwaltungssitz hat. Im Gegensatz dazu steht die Gründungstheorie, nach der sich die Bestimmung des Gesellschaftsstatuts ausschließlich nach dem Ort der Gründung der Gesellschaft richtet.
Der EugH erklärte in dem Fall „Daily Mail“ die nationalen Rechtsordnungen des Gründungsstaates für die Existenz der Gesellschaft als maßgeblich und Wegzugsbeschränkungen für zulässig. In dem Fall „Centros“ hat der EuGH entschieden, dass es gegen die Niederlassungsfreiheit verstößt, wenn ein Zuzugsstaat die Eintragung einer Tochtergesellschaft verweigert, auch wenn diese nationale Beschränkungen umgeht. In dem Fall „Überseering“ entschied der EuGH, dass jede Gesellschaft, die ihren Satzungs- und Verwaltungssitz in einen anderen Staat verlegt, ihre volle Rechts- und Parteifähigkeit beibehält. Dies wurde durch das Urteil im Fall „Inspire Art“ bekräftigt, da jede Gesellschaft, die nach ausländischem Recht ordnungsgemäß gegründet wurden, im Zuzugsstaat genauso wie im Gründungsstaat behandelt werden muss und die Anerkennung nicht durch strengere gesellschaftsrechtliche Regelungen abhängig gemacht werden darf.
Damit verstoßen staatliche Zuzugsbeschränkungen gegen die Niederlassungsfreiheit, Wegzugsbeschränkungen sind aber weiterhin zulässig. Ob die Möglichkeit eines Umzugs besteht, richtet sich nach dem Recht des Wegzugstaates.
Damit läßt sich feststellen, dass die Sitztheorie in Deutschland nur noch für den Wegzug, in Deutschland gegründeten Gesellschaften, anwendbar ist. Im Zuzugsfall ausländischer Gesellschaften nach Deutschland ist hingegen die Gründungstheorie anzuwenden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Grundlagen und Begriffsbestimmung
- 1.1. Niederlassungsfreiheit
- 1.2. Sitz der Gesellschaft
- 1.2.1. Satzungssitz
- 1.2.2. Verwaltungssitz
- 1.3. Gesellschaftsstatut und Bestimmung
- 1.3.1. Gesellschaftsstatut
- 1.3.2. Sitztheorie
- 1.3.3. Gründungstheorie (Inkorporationstheorie)
- 2. Aktuelle Rechtsprechungen des EuGH zur Niederlassungsfreiheit und Gesellschaftsstatut
- 2.1. Entscheidung des EuGH zu „Daily Mail“, vom 27.09.1988, RS. 81/87
- 2.1.1. Sachverhalt
- 2.1.2. Urteil
- 2.2. Entscheidung des EuGH zu „Centros“, vom 09.03.1999, RS. C-212/97
- 2.2.1. Sachverhalt
- 2.2.2. Urteil
- 2.3. Entscheidung des EuGH zu „Überseering“, vom 05.11.2002, RS. C-208/00
- 2.3.1. Sachverhalt
- 2.3.2. Urteil
- 2.4. Entscheidung des EuGH zu „Inspire Art“, vom 30.09.2003, RS. C-167/01
- 2.4.1. Sachverhalt
- 2.4.2. Urteil
- 3. Auswirkung der europäischen und deutschen Rechtsprechung auf den Umzug von Gesellschaften im europäischen Binnenmarkt
- 3.1. Sitzverlegung im europäischen Binnenmarkt
- 3.2. Zusammenfassung
- 3.3. Zuzugs- und Wegzugsbeschränkungen
- 4. Fazit: Verdrängung der Sitz- durch die Gründungstheorie?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die aktuelle Rechtslage bezüglich der Sitztheorie und der Gründungstheorie im Gesellschaftsrecht, insbesondere im Kontext der Rechtsprechung des EuGH und der deutschen Gerichte. Ziel ist es, die Unterschiede beider Theorien zu erläutern und ihre Auswirkungen auf die Verlegung von Gesellschaftssitzen innerhalb des europäischen Binnenmarktes zu analysieren.
- Niederlassungsfreiheit im europäischen Recht
- Unterschiede zwischen Sitztheorie und Gründungstheorie
- Auswirkungen der Rechtsprechung des EuGH auf die Gesellschaftsgründung und -verlegung
- Sitzverlegung im europäischen Binnenmarkt
- Zuzugs- und Wegzugsbeschränkungen von Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
1. Grundlagen und Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis der Thematik. Es definiert die Niederlassungsfreiheit gemäß EU-Recht und differenziert zwischen primärer und sekundärer Niederlassungsfreiheit. Es werden die zentralen Begriffe "Satzungssitz" und "Verwaltungssitz" im Zusammenhang mit der Rechtsform der Gesellschaft eingeführt und die beiden zentralen Theorien – die Sitztheorie und die Gründungstheorie (Inkorporationstheorie) – vorgestellt. Der Abschnitt dient als essentielle Einführung in die unterschiedlichen rechtlichen Ansätze und bildet die Basis für die Analyse der Rechtsprechungen im folgenden Kapitel. Die Unterscheidung zwischen den beiden Theorien wird anhand konkreter Beispiele erläutert, welche die Bedeutung der jeweiligen Kriterien für die Rechtsfähigkeit und den rechtlichen Status der Gesellschaft hervorheben.
2. Aktuelle Rechtsprechungen des EuGH zur Niederlassungsfreiheit und Gesellschaftsstatut: Dieses Kapitel analysiert vier wegweisende Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu den Themen Niederlassungsfreiheit und Gesellschaftsstatut. Die Urteile in den Fällen „Daily Mail“, „Centros“, „Überseering“ und „Inspire Art“ werden detailliert dargestellt und hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Anwendung der Sitz- und Gründungstheorie bewertet. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH und der damit einhergehenden Veränderungen im Verständnis von Gesellschaftsgründung und -verlegung innerhalb der EU. Die jeweiligen Sachverhalte werden prägnant beschrieben, gefolgt von einer detaillierten Auseinandersetzung mit den jeweiligen Urteilen und deren Begründung. Die Analyse der Urteile zeigt die schrittweise Verschiebung der Rechtsprechung des EuGH von der Sitztheorie hin zur Gründungstheorie auf.
3. Auswirkung der europäischen und deutschen Rechtsprechung auf den Umzug von Gesellschaften im europäischen Binnenmarkt: Dieses Kapitel untersucht die praktischen Folgen der dargestellten Rechtsprechung auf den Umzug von Gesellschaften innerhalb des europäischen Binnenmarktes. Es analysiert verschiedene Szenarien, darunter den Zuzug und den Wegzug von Gesellschaften aus/nach EU-Mitgliedsstaaten, die unterschiedlichen Theorien verfolgen (Sitz- oder Gründungstheorie). Die verschiedenen Konstellationen bezüglich der Verlegung des Satzungs- und/oder Verwaltungssitzes werden detailliert beleuchtet und deren rechtliche Implikationen erörtert. Das Kapitel gipfelt in einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und einer Diskussion möglicher Zuzugs- und Wegzugsbeschränkungen.
Schlüsselwörter
Sitztheorie, Gründungstheorie (Inkorporationstheorie), Niederlassungsfreiheit, EuGH-Rechtsprechung, Gesellschaftsstatut, Satzungssitz, Verwaltungssitz, europäischer Binnenmarkt, Rechtsfähigkeit, Kapitalgesellschaften.
FAQ: Seminararbeit - Sitztheorie vs. Gründungstheorie im Gesellschaftsrecht
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die aktuelle Rechtslage bezüglich der Sitztheorie und der Gründungstheorie im Gesellschaftsrecht, insbesondere im Kontext der Rechtsprechung des EuGH und der deutschen Gerichte. Ziel ist die Erläuterung der Unterschiede beider Theorien und die Analyse ihrer Auswirkungen auf die Verlegung von Gesellschaftssitzen innerhalb des europäischen Binnenmarktes.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Niederlassungsfreiheit im europäischen Recht, die Unterschiede zwischen Sitztheorie und Gründungstheorie, die Auswirkungen der EuGH-Rechtsprechung auf Gesellschaftsgründung und -verlegung, Sitzverlegungen im europäischen Binnenmarkt sowie Zuzugs- und Wegzugsbeschränkungen von Gesellschaften.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Grundlagen und Begriffsbestimmung (inkl. Niederlassungsfreiheit, Satzungs- und Verwaltungssitz, Sitz- und Gründungstheorie); 2. Aktuelle Rechtsprechungen des EuGH (Analyse der Urteile in den Fällen „Daily Mail“, „Centros“, „Überseering“ und „Inspire Art“); 3. Auswirkung der europäischen und deutschen Rechtsprechung auf den Umzug von Gesellschaften im europäischen Binnenmarkt (inkl. Sitzverlegung und Zuzugs-/Wegzugsbeschränkungen); 4. Fazit: Verdrängung der Sitz- durch die Gründungstheorie?
Was wird unter Sitztheorie und Gründungstheorie verstanden?
Die Seminararbeit definiert und unterscheidet die Sitztheorie und die Gründungstheorie (Inkorporationstheorie). Es werden die jeweiligen Kriterien für die Rechtsfähigkeit und den rechtlichen Status der Gesellschaft erläutert und anhand von Beispielen verdeutlicht.
Welche Rolle spielt die Rechtsprechung des EuGH?
Die Arbeit analysiert detailliert vier wegweisende Entscheidungen des EuGH („Daily Mail“, „Centros“, „Überseering“, „Inspire Art“), um die Entwicklung der Rechtsprechung und deren Auswirkungen auf die Anwendung der Sitz- und Gründungstheorie aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der schrittweisen Verschiebung der Rechtsprechung vom Sitz- hin zur Gründungstheorie.
Welche praktischen Auswirkungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die praktischen Folgen der dargestellten Rechtsprechung auf den Umzug von Gesellschaften innerhalb des europäischen Binnenmarktes, analysiert verschiedene Szenarien (Zuzug und Wegzug) und erörtert die rechtlichen Implikationen unterschiedlicher Konstellationen bezüglich der Verlegung des Satzungs- und/oder Verwaltungssitzes.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Das vierte Kapitel zieht ein Fazit und diskutiert die Frage, ob die Gründungstheorie die Sitztheorie verdrängt.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Sitztheorie, Gründungstheorie (Inkorporationstheorie), Niederlassungsfreiheit, EuGH-Rechtsprechung, Gesellschaftsstatut, Satzungssitz, Verwaltungssitz, europäischer Binnenmarkt, Rechtsfähigkeit, Kapitalgesellschaften.
- Quote paper
- Thomas Graf (Author), 2005, Sitztheorie versus Gründungstheorie. Die aktuelle Rechtslage auf Grund der Rechtsprechung des EuGH und der deutschen Rechtsprechung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54547