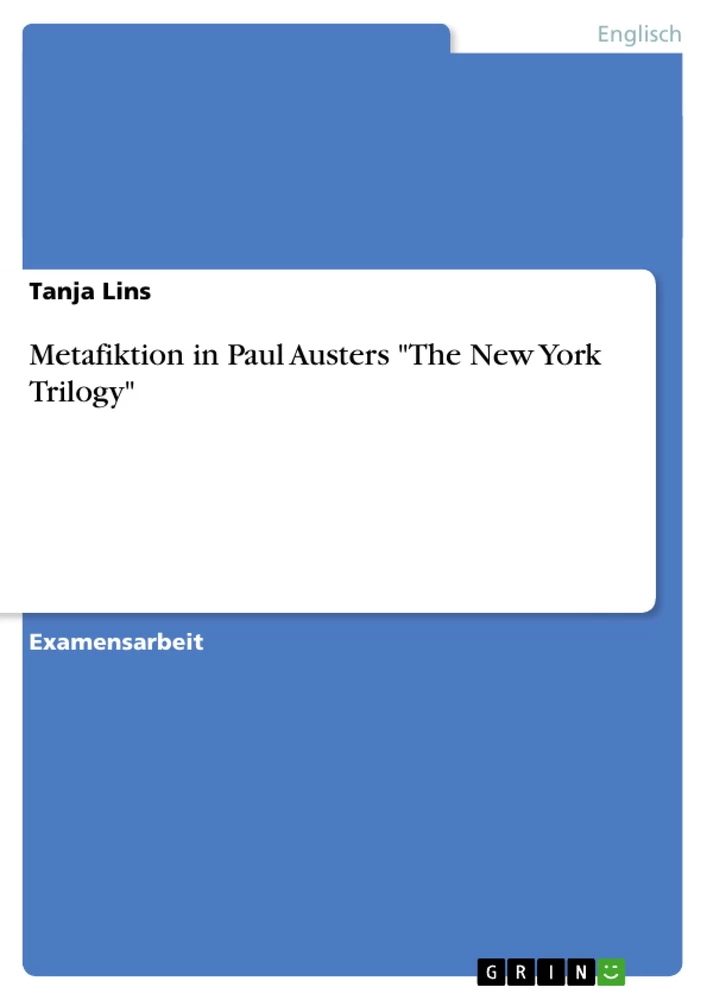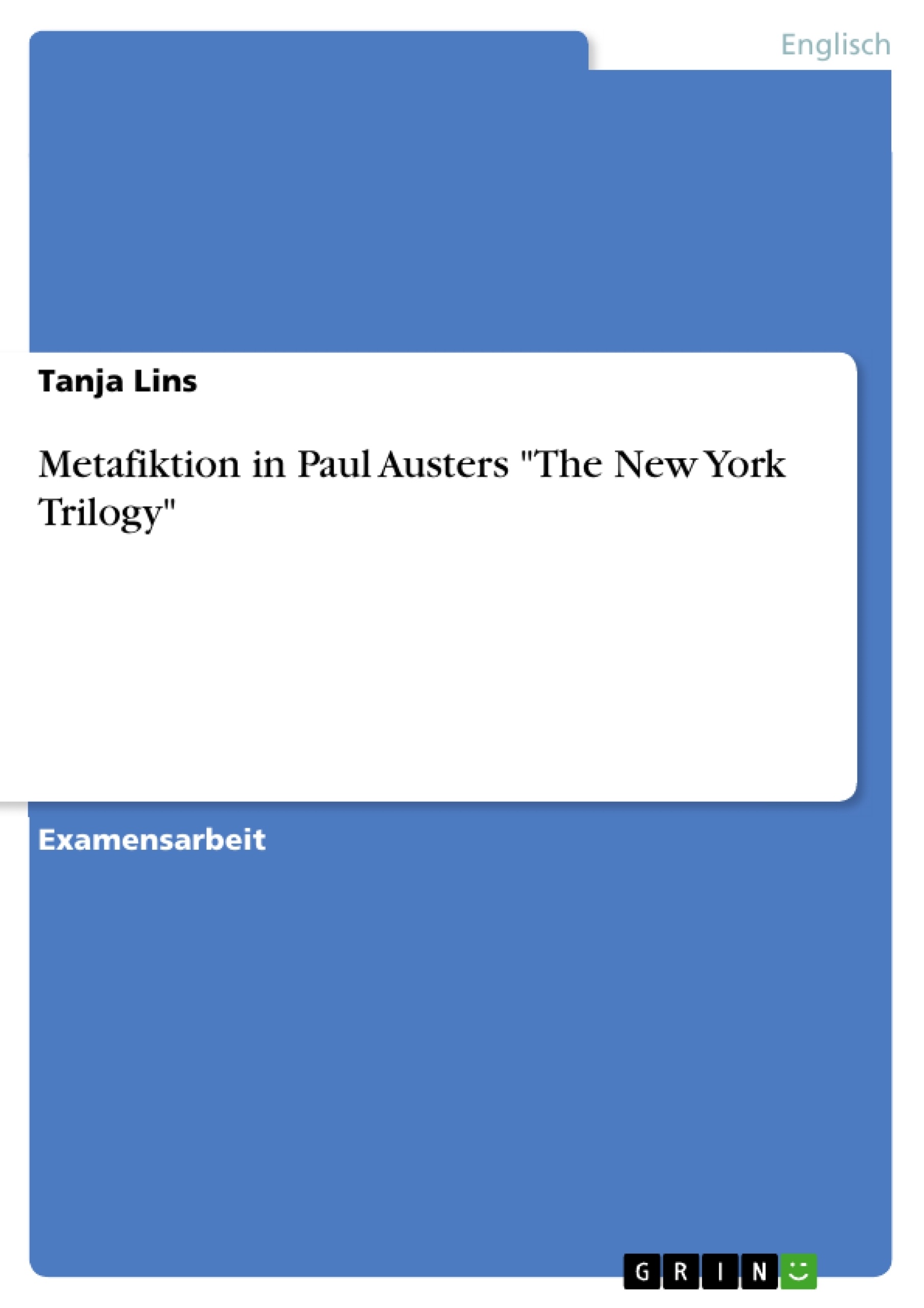Die vorliegende Arbeit gibt einen sehr guten Überblick über den Sinn und Zweck der verwendeten metafiktionalen Elemente in Austers bekanntestem Werk "The New York Trilogy". So spielen Sprachtheorien, Intertextualität und die Implementierung Austers auf der Erzählebene eine zentrale Rolle, um postmodernes Gedankengut zu transportieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Was ist Metafiktion?
- 2. Allgemeinmetafiktion am Beispiel der Sprachtheorie
- 2.1 Sprachtheorie in The New York Trilogy
- 2.1.1 City of Glass
- 2.1.2 Ghosts
- 2.1.3 The Locked Room
- 2.1.4 Zusammenfassung
- 3. Fremdmetafiktion: Intertextualität
- 3.1 Intertextualität in The New York Trilogy
- 3.1.1 Austers Trilogie als Parodie und Echo auf Hawthornes „Wakefield“
- 3.1.2 Austers Trilogie und Thoreaus Walden
- 3.2 Zusammenfassung
- 4. Eigenmetafiktion am Beispiel des Autors in City of Glass
- 4.1 City of Glass: Wer konstruiert hier wen?
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Metafiktion im Kontext von Paul Austers The New York Trilogy. Sie untersucht, wie metafiktionale Elemente die Konstruktionen von Realität, Identität und Sprache in den drei Romanen City of Glass, Ghosts und The Locked Room beeinflussen.
- Die Bedeutung von Sprachreflexionen in der Trilogie
- Intertextualität und die Beziehung zu anderen Werken
- Die Autorproblematik und die Rolle des Autors im fiktiven Kontext
- Metafiktion als Mittel der Dekonstruktion literarischer Konventionen
- Die Rolle der Metafiktion im Kontext der postmodernen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Metafiktion und ihre Relevanz in der Postmoderne ein. Das erste Kapitel definiert den Begriff Metafiktion und erläutert verschiedene Forschungsansätze. Es wird außerdem eine Skala zur graduellen Unterteilung der Erscheinungsformen nach Waugh (1984) vorgestellt. Das zweite Kapitel untersucht die Bedeutung von Sprachreflexionen in den drei Romanen der Trilogie. Dabei werden die Sprachtheorien der einzelnen Protagonisten analysiert. Im dritten Kapitel wird die intertextuelle Dimension der Trilogie beleuchtet und die Beziehung zu anderen Werken wie „Wakefield“ von Hawthorne und „Walden“ von Thoreau untersucht. Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Autorproblematik in City of Glass und die metafiktionale Dekonstruktion der Autorrolle.
Schlüsselwörter
Metafiktion, Postmoderne, The New York Trilogy, Paul Auster, Sprachtheorie, Intertextualität, Autorproblematik, Dekonstruktion, Realität, Identität, Konstruktionen, Literaturtheorie, Philosophische Theorien, Detektivgeschichte, Metaphysical detective stories.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Metafiktion?
Metafiktion bezeichnet Literatur, die ihre eigene Fiktionalität thematisiert und die Grenzen zwischen Realität und Erfindung bewusst verwischt.
Wie nutzt Paul Auster Metafiktion in der New York Trilogie?
Auster setzt Sprachtheorien, Intertextualität und das Auftreten des Autors als Figur im Buch ein, um postmoderne Fragen nach Identität und Wahrheit zu stellen.
Worum geht es in „City of Glass“?
Ein Krimiautor wird durch einen Telefonanruf mit einem Privatdetektiv verwechselt und verliert sich bei der Beschattung eines Mannes in einer obsessiven Suche nach Identität.
Was ist Intertextualität bei Auster?
Auster bezieht sich auf klassische Werke wie Thoreaus „Walden“ oder Hawthornes „Wakefield“, um seine eigenen Erzählungen als Parodien oder Echos der Literaturgeschichte zu gestalten.
Warum gilt die Trilogie als „metaphysischer Detektivroman“?
Weil die klassische Detektivarbeit nicht zur Lösung eines Falls führt, sondern zur Auflösung der Persönlichkeit des Ermittlers und zur Hinterfragung der Sprache selbst.
- Quote paper
- Tanja Lins (Author), 2006, Metafiktion in Paul Austers "The New York Trilogy", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54474