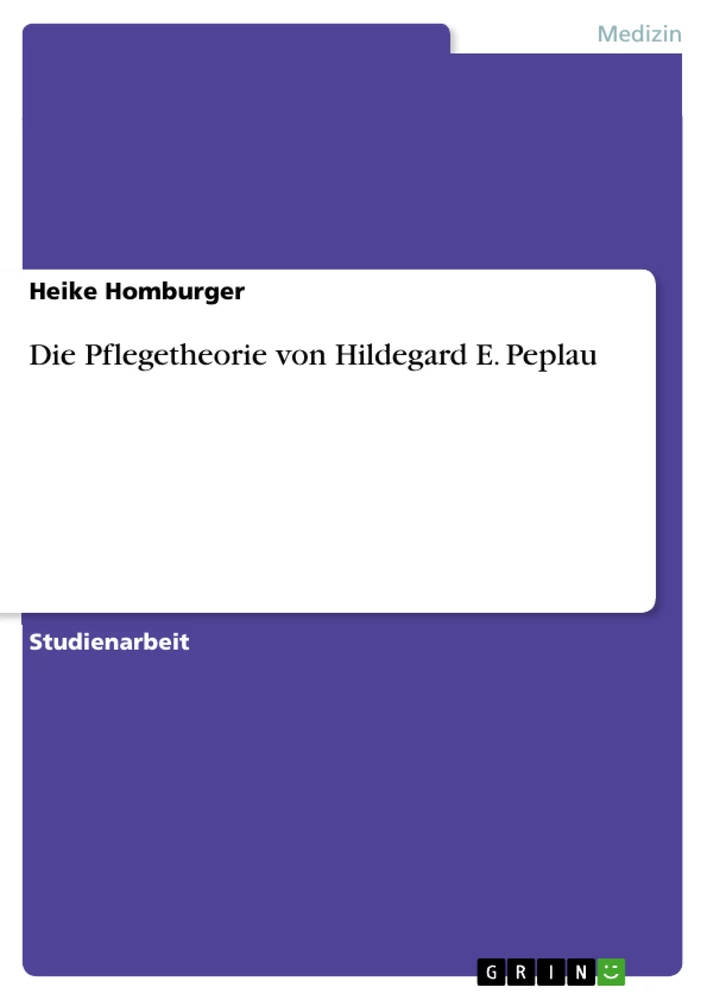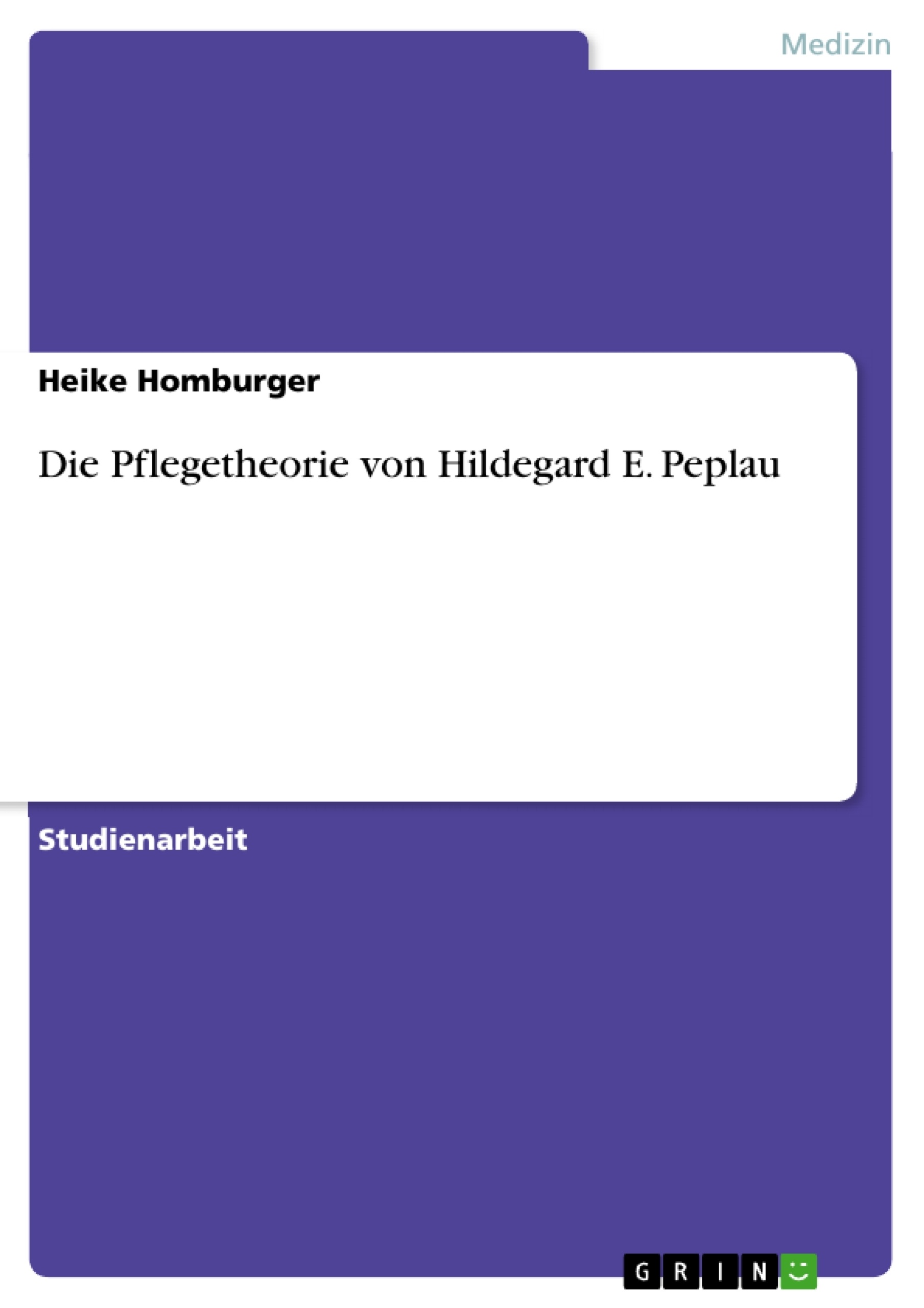Zu Beginn dieses Jahrhunderts fanden in den USA erste Bemühungen statt, die Pflege zu akademisieren, nachdem sich führende Pflegekräfte wie Florence Nightingale (1820-1910) für eine Neugestaltung der Krankenpflegeausbildung eingesetzt hatten. Als Folge des Zweiten Weltkrieges kam es mit der Schaffung von universitären Studienangeboten für Lehr- und Leitungsaufgaben zu einer Verlagerung der beruflichen Bildung in den tertiären Bildungsbereich. Mit der Veröffentlichung von Hildegard Peplaus grundlegendem Werk „Interpersonal Relations in Nursing“ im Jahr 1952 wurde sodann eine eigentliche Neustrukturierung der Pflegepraxis hervorgerufen. In ihrem Buch bezieht sie sich auf viele Psychologen und Psychiater, unter anderem auf Freud, Fromm und Sullivan. Um zu einer spezifischen Beschreibung von Krankenpflege zu kommen, nutzte sie deren psychologische, verhaltenstheoretische und psychoanalytische Theorien. Ihr Bestreben bestand darin, der Pflege zu einem neuen Paradigma zu verhelfen, welches auf der Grundlage einer interpersonalen Theorie basierte. Die Formulierung ihres „Psychodynamischen Modells der Pflege“ geschah zu einer Zeit, in der es unüblich war, theoretische Erkenntnisse anderer Disziplinen in die Pflege zu integrieren und dadurch etwas „Neues“ zu gestalten. Bereits 1949 hatte die Autorin erstmals ihr Manuskript einem Verlag zur Veröffentlichung angeboten. Zu dieser Zeit dachte man jedoch, „es sei für eine Krankenschwester zu revolutionär, ein Buch ohne einen Arzt als Koautor herauszubringen“ (Barker 2000)“, sodass die Veröffentlichung verzögert wurde. Im Mittelpunkt ihrer Theorie steht die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Patient und Pflegekraft, welche zur Grundlage des pflegerischen Handelns wird. Ihr Augenmerk galt nicht den medizinischen Aspekten der pflegerischen Versorgung, sondern vielmehr einer prozessorientierten und evolutionären Pflegepraxis.„Peplau entwickelt das Modell durch die Beschreibung der strukturellen Konzepte des zwischenmenschlichen Prozesses, welche die Phasen der Krankenschwester-Patient-Beziehung darstellen und definiert darüber hinaus die Rolle der Krankenschwestern in dieser Beziehung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Werdegang und Hintergrund der Theoretikerin
- Die Struktur der Pflegetheorie
- Die Hauptannahmen Peplaus Theorie
- Phasen interpersonaler Beziehungen
- Überblick
- Die Phase der Orientierung
- Die Phase der Identifikation
- Die Phase der Nutzung
- Die Phase der Ablösung
- Mögliche Rollen der Pflegenden
- Überblick
- Die Pflegende als Fremde
- Die Pflegende als Informationsquelle
- Die Pflegende als Lehrende
- Die Pflegende als Führungspersönlichkeit
- Die Pflegende als Beraterin
- Die Pflegende als Stellvertreterin
- Einflüsse auf die Pflegende-Patient-Beziehung
- Psychobiologische Erfahrungen
- Menschliche Bedürfnisse
- Frustrationen
- Konflikte
- Ängste
- Psychologische Fähigkeiten, die die Beziehung beeinflussen
- Ziel
- Lernen, sich auf andere zu verlassen
- Lernen, die Befriedigung aufzuschieben
- Sich selbst identifizieren
- Die Fähigkeit zur Partizipation entwickeln
- Die Pflegetheorie in der Praxis
- Bezugsrahmen für die Praxis
- Die Anwendung auf die psychiatrische Pflege
- Mögliche Schwierigkeiten bei der Anwendung auf die Pflegepraxis
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Pflegetheorie von Hildegard E. Peplau, einer Schlüsselfigur der modernen Pflege, die sich besonders für die Entwicklung der psychiatrischen Krankenpflege einsetzte. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Beschreibung und Analyse von Peplaus „Psychodynamischen Modell der Pflege“, das die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Patient und Pflegekraft in den Vordergrund stellt. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die theoretischen Grundlagen der Pflegetheorie und ihre praktische Anwendung im Bereich der psychiatrischen Pflege zu ermöglichen.
- Interpersonale Beziehungen in der Pflege
- Phasen der Krankenschwester-Patient-Beziehung
- Rollen der Pflegenden in der Beziehung
- Einflüsse und psychologische Fähigkeiten in der Beziehung
- Praktische Anwendung der Theorie in der psychiatrischen Pflege
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Pflegetheorie von Hildegard E. Peplau ein und beleuchtet deren Bedeutung für die Entwicklung der Pflegepraxis im 20. Jahrhundert. Das zweite Kapitel widmet sich dem Werdegang und dem Hintergrund der Theoretikerin, wobei ihr Leben und ihre beruflichen Stationen dargestellt werden, die ihre Arbeit geprägt haben. In Kapitel 3 wird die Struktur von Peplaus Pflegetheorie ausführlich erläutert, inklusive der zentralen Annahmen, der Phasen der interpersonellen Beziehungen und den verschiedenen Rollen, die die Pflegende in diesen Beziehungen einnehmen kann. Darüber hinaus werden Einflüsse auf die Pflegende-Patient-Beziehung und psychologische Fähigkeiten, die diese beeinflussen, beleuchtet. Kapitel 4 befasst sich mit der Anwendung von Peplaus Theorie in der Praxis, wobei der Bezug zur psychiatrischen Pflege und mögliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung in den Fokus gerückt werden. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbemerkung ab, die die Bedeutung von Peplaus Werk und deren Weiterentwicklung in der heutigen Pflegepraxis beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselbegriffe der Arbeit umfassen die Pflegetheorie von Hildegard E. Peplau, das „Psychodynamische Modell der Pflege“, interpersonale Beziehungen, Phasen der Krankenschwester-Patient-Beziehung, Rollen der Pflegenden, Einflüsse auf die Pflegende-Patient-Beziehung, psychologische Fähigkeiten, Anwendung in der Praxis und psychiatrische Pflege.
- Citar trabajo
- Heike Homburger (Autor), 2005, Die Pflegetheorie von Hildegard E. Peplau, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54357