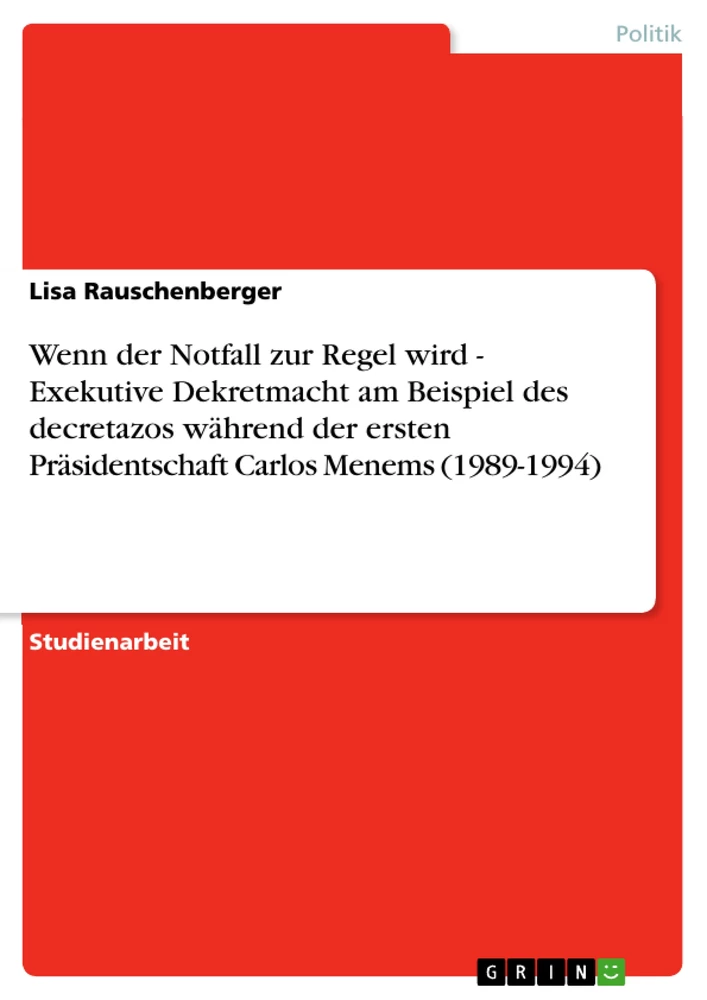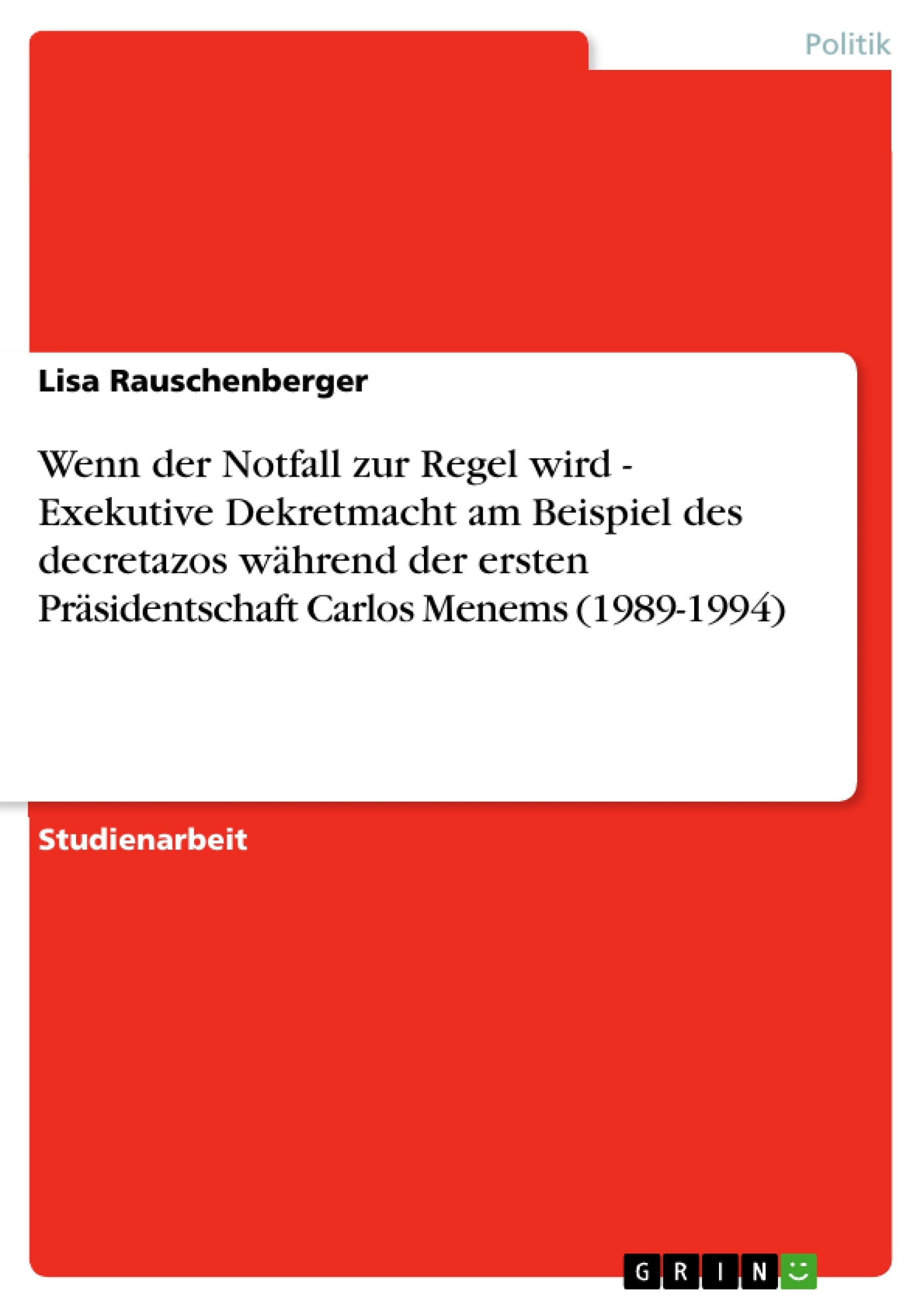1. Einleitung
Im Jahr 1983 begann in Argentinien ein neues Zeitalter - das Zeitalter der Demokratie. Nach über sieben Jahren der Militärdiktatur wurde mit Raúl Alfonsín erstmals wieder ein demokratischer Präsident gewählt und eine wahre Demokratieeuphorie machte sich breit. Dies beschönigte allerdings nicht die Tatsache, dass die junge Demokratie auf wackeligen Füßen stand. Die Militärs hatten das Land in einem katastrophalen Zustand hinterlassen, was sich bald in ernstzunehmenden wirtschaftlichen und sozialen Problemen bemerkbar machte. Die Regierung Alfonsín scheiterte an der Bewältigung dieser Krise und die argentinische Demokratie stand vor einer Zerreißprobe.
1989 trat Alfonsíns Nachfolger Carlos Menem das Präsidentenamt an und begann sogleich mit einer radikalen marktwirtschaftlichen Umstrukturierung der Wirtschaft. Diese implementierte er größtenteils per Dekret, was ihm einen sehr zweifelhaften Ruf einbrachte und nicht zuletzt eine hitzige Debatte in der politischen Wissenschaft anregte. Ich möchte mich in dieser Arbeit mit den konstitutionellen Kompetenzen der Exekutive in Präsidialdemokratien beschäftigen. Diese werde ich zunächst theoretisch und dann anhand der Präsidentschaft Menems zwischen 1989 und 1994 erläutern. Dieser Fall ist deshalb besonders interessant, weil sich der Präsident Kompetenzen angeeignete, die zu einer Umgehung der Legislative und einer Machtkonzentration in der Exekutive führten. Ich möchte die Hintergründe dieses decretazos beleuchten und herausfinden, welche Vorraussetzungen diese Umverteilung der Macht ermöglichten und einschätzen, inwieweit sie angesichts der Lage gerechtfertigt war. Dabei richte ich besonderes Augenmerk auf die beiden anderen Gewalten und darauf, welche Rolle sie beim menemistischen Dekretismus spielten. Agierten sie als Gegengewicht zum Präsidenten oder tolerierten sie dessen Entscheidungsmonopol in gewisser Weise sogar?
Der decretazo ist sehr kontrovers diskutiert worden. Während einige Autoren die Position einnehmen, das Regieren per Dekret sei bar jeder konstitutionellen Legitimation und schlicht illegal, behaupten andere, angesichts der dramatischen wirtschaftlichen Umstände sei es die einzige Lösung gewesen.
Ich selber habe während eines einjährigen Aufenthalts in Argentinien oftmals hasserfüllte Reaktionen der Menschen auf die Person Menems und seine neoliberale Politik erlebt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Legislative Kompetenzen der Exekutive
- Reactive powers - Veto-Recht
- Proactive powers - Dekretrecht
- Legislative Zustimmungserfordernisse
- Legislative Toleranz gegenüber exekutiven Dekreten
- Starkes Dekret / schwaches Dekret
- Fallbeispiel Argentinien unter Carlos Menem (1989-1994)
- Politischer Hintergrund
- Der decretazo
- Die Verfassungsreform 1994
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den konstitutionellen Kompetenzen der Exekutive in Präsidialdemokratien. Der Fokus liegt dabei auf der Exekutivgewalt in Argentinien während der Präsidentschaft von Carlos Menem (1989-1994), insbesondere auf dem sogenannten "decretazo".
- Die theoretischen Grundlagen der legislativen Kompetenzen der Exekutive in präsidentiellen Systemen
- Die Analyse des "decretazo" unter Carlos Menem, ein Beispiel für die Umgehung der Legislative und Machtkonzentration in der Exekutive
- Die Hintergründe und Voraussetzungen des "decretazo", insbesondere die Rolle der anderen Staatsgewalten
- Die Rechtfertigung des "decretazo" im Kontext der damaligen wirtschaftlichen und politischen Situation Argentiniens
- Die Kontroverse um die Rechtmäßigkeit und Legitimität des Regierens per Dekret
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die problematische Situation in Argentinien nach der Militärdiktatur und die Herausforderungen, vor denen die junge Demokratie stand. Sie stellt Carlos Menem als Nachfolger von Raúl Alfonsín vor und erläutert dessen radikale marktwirtschaftliche Politik, die größtenteils per Dekret implementiert wurde.
- Theorie: Dieses Kapitel behandelt die Trennung der Gewalten nach Montesquieu und das Prinzip der "checks and balances". Es erläutert die "reactive powers" und "proactive powers" der Exekutive und fokussiert dabei auf das Veto-Recht und das Dekretrecht.
- Fallbeispiel Argentinien unter Carlos Menem (1989-1994): Dieses Kapitel behandelt den politischen Hintergrund des "decretazo" in Argentinien und beschreibt die Umstände, die zu dieser Politik führten. Es analysiert die Verfassungsreform von 1994 und die Rolle der anderen Staatsgewalten.
Schlüsselwörter
Präsidentialismus, Lateinamerika, Argentinien, Carlos Menem, decretazo, Exekutive, Legislative, Gewaltenteilung, Veto-Recht, Dekretrecht, checks and balances, neoliberale Politik, Wirtschaftskrise, Verfassungsreform
- Quote paper
- Lisa Rauschenberger (Author), 2006, Wenn der Notfall zur Regel wird - Exekutive Dekretmacht am Beispiel des decretazos während der ersten Präsidentschaft Carlos Menems (1989-1994), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54289