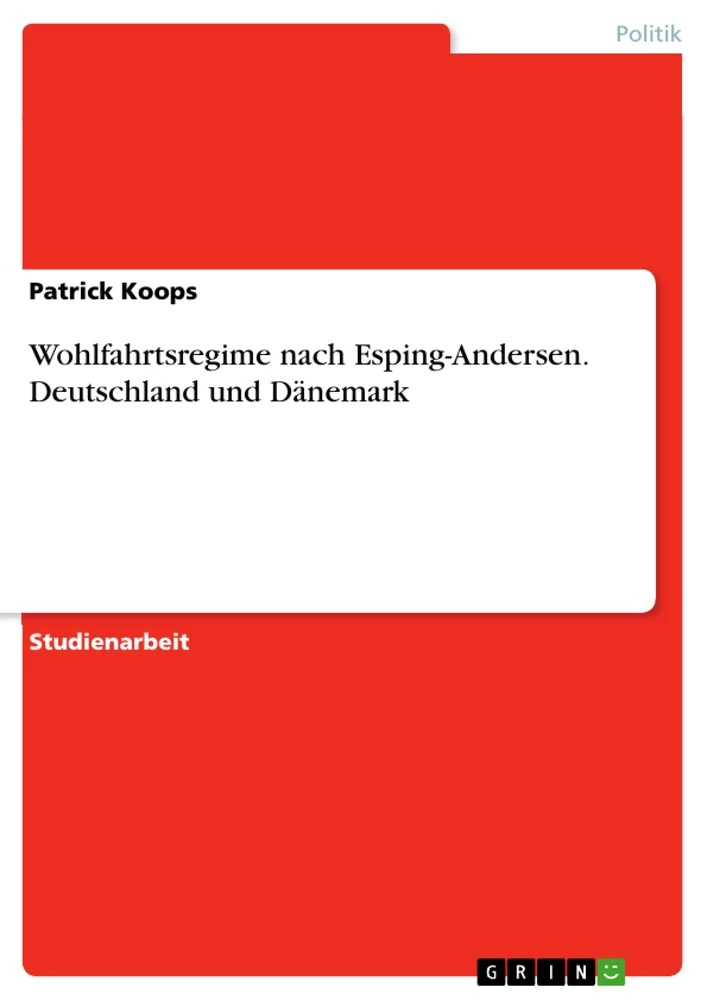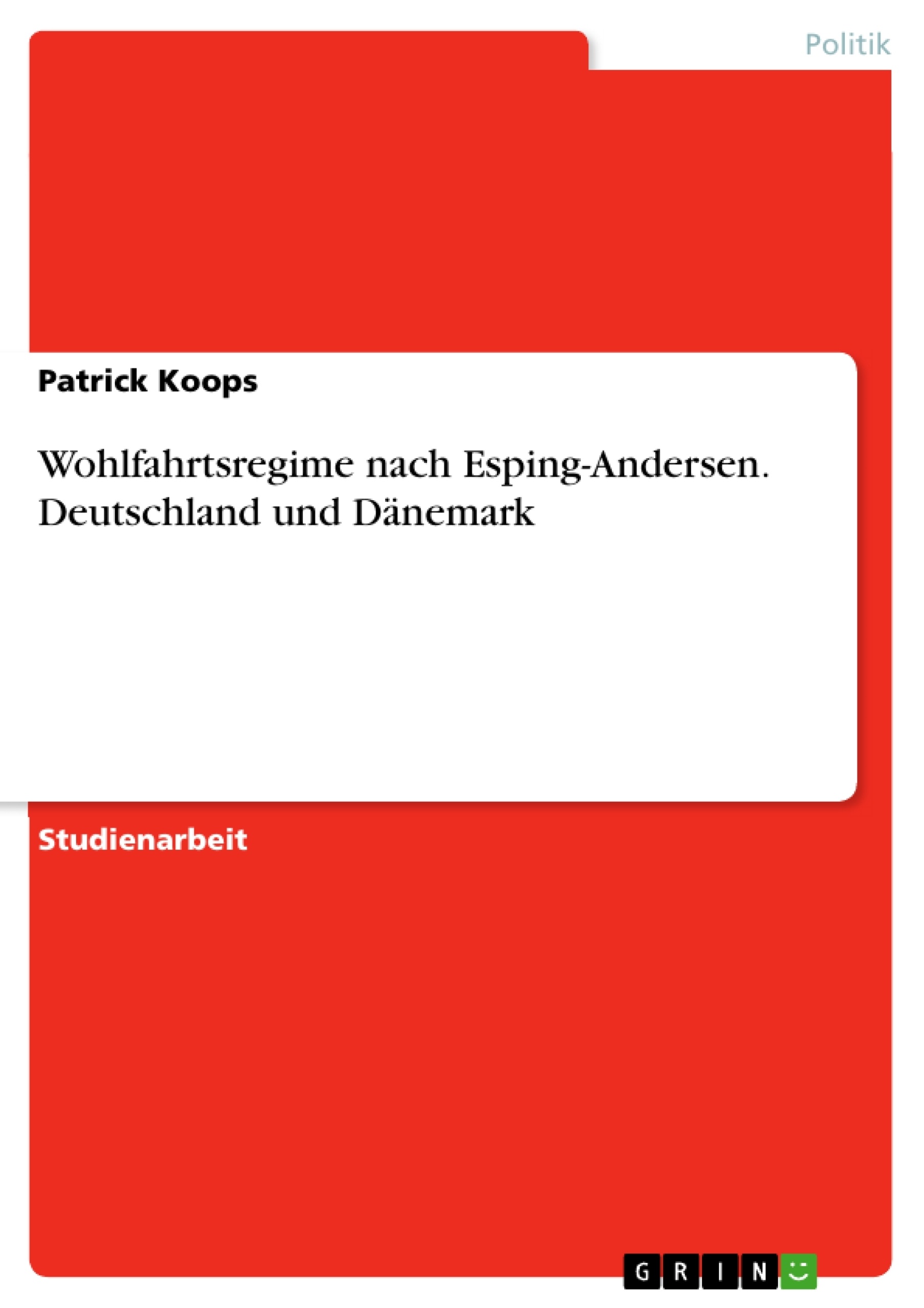Seit den neunziger Jahren hat Gøsta Esping-Andersen (1990) sein Konzept der Wohlfahrtsregime entwickelt. Bis dahin war das Niveau der Sozialausgaben die gängige Variable zur Bestimmung der Wohlfahrtsstaatlichkeit. Esping-Andersen versucht die Auswirkungen der Wohlfahrtsregime auf die Bürger durch eine theoretisch-empirische Analyse zu veranschaulichen. Zu diesem Zweck charakterisiert er drei Wohlfahrtsstaatstypen, und zwar das liberale, sozialdemokratische und konservative Modell. In diesem Kontext ist Dänemark dem sozialdemokratischen Modell und Deutschland dem konservativen Modell zuzuordnen. Lessenich und Ostner (1998) jedoch bezeichnen beispielsweise das konservative Wohlfahrtsregime als einen bunten „Flickenteppich“ , dem Esping-Andersen die Wohlfahrtsstaaten zugeordnet hat, die nicht zu den anderen beiden Modellen passten. Gegenstand dieser Arbeit ist es, die Typologie Esping-Andersens und die berücksichtigten Variablen bei dessen Bildung darzustellen. Wie lassen sich das dänische und deutsche Wohlfahrtssystem nach Esping-Andersen charakterisieren und typologisieren? Was sind die Unterschiede dieser beiden Wohlfahrtsstaaten? Inwiefern greift in diesem Zusammenhang Esping-Andersens These der Pfadabhängigkeit in Deutschland und Dänemark?
Diese Studienarbeit beschäftigt sich mit den Wohlfahrtsregimen in Deutschland und Dänemark aus einer historischen und vergleichenden Sicht. Die Darstellung soll nach dem Vorbild Esping-Andersens geschehen, der bei der Bildung seiner idealtypischen Wohlfahrtsregime versucht hat, die Dimensionen polity, politics und policy unter einen Hut zu bringen.
Zunächst wird die Typologie der von Esping-Andersen entworfenen Wohlfahrtsregime dargestellt. Die von Esping-Andersen berücksichtigten Variablen bei der Bildung seiner idealtypischen Wohlfahrtsregime werden näher erläutert, um dann die drei Wohlfahrtsregime selbst darzustellen. Anschließend wird auf die Weiterentwicklung dieses Modells durch Esping-Andersen aufgrund von aktuellen Entwicklungen, wie beispielsweise die Globalisierung, eingegangen. Auf die europäische Dimension des Wohlfahrtsstaates soll jedoch nicht weiter eingegangen werden. Im nächsten Teil werden der dänische und deutsche Wohlfahrtsstaat verglichen, sowohl nach ihrer Entwicklung, als auch nach Prinzipien bei deren Ausgestaltung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsbestimmung: Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat
- 3 Typologie der Wohlfahrtsregime
- 3.1 Die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus nach Esping-Andersen
- 3.1.1 Dekommodifizierung
- 3.1.2 Stratifizierung
- 3.1.3 Staat, Markt, Familie
- 3.2 Wohlfahrtsregime nach Esping-Andersen
- 3.2.1 Liberales Modell
- 3.2.2 Konservatives Modell
- 3.2.3 Sozialdemokratisches Modell
- 3.3 Ausweitung der drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus
- 3.3.1 Globalisierung
- 3.3.2 Private Haushalte
- 3.1 Die drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus nach Esping-Andersen
- 4 Deutschland und Dänemark
- 4.1 Historischer Vergleich
- 4.1.1 Die Anfänge des Wohlfahrtsstaates in Deutschland bis 1920
- 4.1.2 Die Anfänge des Wohlfahrtsstaates in Dänemark bis 1920
- 4.1.3 Wohlfahrtsstaatsentwicklung 1920 bis 1945 in Deutschland
- 4.1.4 Wohlfahrtsstaatsentwicklung 1920 bis 1945 in Dänemark
- 4.1.5 Wohlfahrtsstaatsentwicklung in der BRD ab 1945
- 4.1.6 Wohlfahrtsstaatsentwicklung in Dänemark ab 1945
- 4.2 Die Verankerung des Wohlfahrtsstaates im deutschen Grundgesetz
- 4.3 Die Verankerung des Wohlfahrtsstaates in der dänischen Verfassung
- 4.4 Politische Gestaltungsprinzipien
- 4.5 Pfadabhängigkeit
- 4.6 Der Machtressourcen-Ansatz
- 4.7 Social Policies - Typologie der Versicherungsmodelle
- 4.7.1 Rentenversicherung
- 4.7.2 Krankenversicherung
- 4.8 Charakterisierung der Wohlfahrtsregime (D, DK)
- 4.1 Historischer Vergleich
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wohlfahrtsregime Deutschlands und Dänemarks im Vergleich, basierend auf dem Modell von Esping-Andersen. Ziel ist es, die historischen Entwicklungen beider Systeme zu beleuchten und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in ihrer Gestaltung und ihren Prinzipien herauszuarbeiten. Die Analyse konzentriert sich auf die verschiedenen Versicherungsmodelle und die Rolle des Staates, des Marktes und der Familie.
- Historische Entwicklung der Wohlfahrtsstaaten in Deutschland und Dänemark
- Vergleich der Wohlfahrtsregime nach Esping-Andersen
- Analyse der politischen Gestaltungsprinzipien
- Untersuchung verschiedener Versicherungsmodelle (z.B. Renten-, Krankenversicherung)
- Rolle von Staat, Markt und Familie im jeweiligen System
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Wohlfahrtsregime nach Esping-Andersen ein und beschreibt den Fokus der Arbeit auf den Vergleich zwischen Deutschland und Dänemark. Sie umreißt die Methodik und die Struktur der Arbeit.
2 Begriffsbestimmung: Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe „Sozialstaat“ und „Wohlfahrtsstaat“ und legt die theoretischen Grundlagen für die weitere Analyse. Es definiert die jeweiligen Konzepte und differenziert zwischen den Begriffen.
3 Typologie der Wohlfahrtsregime: Dieses Kapitel beschreibt die Typologie der Wohlfahrtsregime nach Esping-Andersen, detailliert die drei Modelle (liberal, konservativ, sozialdemokratisch) und diskutiert deren Charakteristika hinsichtlich Dekommodifizierung, Stratifizierung und der Interaktion von Staat, Markt und Familie. Es wird auch auf die Ausweitung und Modifikation der drei Welten im Kontext von Globalisierung und der Rolle privater Haushalte eingegangen.
4 Deutschland und Dänemark: Dieses Kapitel stellt einen umfassenden Vergleich der Wohlfahrtsregime Deutschlands und Dänemarks dar. Es analysiert die historische Entwicklung beider Systeme, beginnend mit ihren Anfängen bis zur Gegenwart, wobei die jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen berücksichtigt werden. Der Vergleich umfasst die Verankerung der Wohlfahrtsstaaten in den jeweiligen Verfassungen, politische Gestaltungsprinzipien, Pfadabhängigkeiten und den Machtressourcen-Ansatz. Es werden verschiedene Versicherungsmodelle detailliert analysiert und die jeweiligen Charakteristika der Wohlfahrtsregime herausgestellt.
Schlüsselwörter
Wohlfahrtsregime, Esping-Andersen, Deutschland, Dänemark, Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat, Dekommodifizierung, Stratifizierung, Versicherungsmodelle, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Historischer Vergleich, Politische Gestaltungsprinzipien, Pfadabhängigkeit, Machtressourcen-Ansatz, Staat, Markt, Familie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Vergleich der Wohlfahrtsregime Deutschlands und Dänemarks
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text analysiert und vergleicht die Wohlfahrtsregime Deutschlands und Dänemarks. Er basiert auf dem Modell von Esping-Andersen und untersucht die historischen Entwicklungen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Gestaltung und den Prinzipien beider Systeme.
Welche Aspekte der Wohlfahrtsregime werden untersucht?
Der Text beleuchtet verschiedene Aspekte, darunter die historische Entwicklung beider Systeme, die Verankerung im Grundgesetz (Deutschland) und in der dänischen Verfassung, politische Gestaltungsprinzipien, Pfadabhängigkeiten und den Machtressourcen-Ansatz. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich verschiedener Versicherungsmodelle (z.B. Renten- und Krankenversicherung) und der Rolle von Staat, Markt und Familie.
Welches Modell dient als theoretische Grundlage?
Die Analyse basiert auf dem Modell der drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus von Esping-Andersen. Der Text beschreibt detailliert die drei Modelle (liberal, konservativ, sozialdemokratisch) und deren Charakteristika (Dekommodifizierung, Stratifizierung, Interaktion von Staat, Markt und Familie).
Wie wird der historische Vergleich durchgeführt?
Der historische Vergleich umfasst die Entwicklung der Wohlfahrtsstaaten in Deutschland und Dänemark von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Die Analyse berücksichtigt die jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen und betrachtet die Entwicklung in verschiedenen Phasen (bis 1920, 1920-1945, nach 1945).
Welche Versicherungsmodelle werden im Detail analysiert?
Der Text analysiert im Detail die Renten- und Krankenversicherungsmodelle in Deutschland und Dänemark, um Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und sie im Kontext der jeweiligen Wohlfahrtsregime einzuordnen.
Welche Rolle spielen Staat, Markt und Familie?
Der Text untersucht die Rolle von Staat, Markt und Familie in den jeweiligen Wohlfahrtsregimen und analysiert, wie diese Akteure die Gestaltung und Funktionalität der Systeme beeinflussen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für den Text?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Wohlfahrtsregime, Esping-Andersen, Deutschland, Dänemark, Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat, Dekommodifizierung, Stratifizierung, Versicherungsmodelle, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Historischer Vergleich, Politische Gestaltungsprinzipien, Pfadabhängigkeit, Machtressourcen-Ansatz, Staat, Markt und Familie.
Was ist das Fazit des Textes?
(Das Fazit ist im bereitgestellten HTML-Code nicht explizit zusammengefasst, aber es wird implizit durch den Vergleich der Kapitel 1-4 angedeutet. Ein explizites Fazit würde einen direkten Vergleich der deutschen und dänischen Wohlfahrtsmodelle und die Schlussfolgerungen aus dem Vergleich enthalten.)
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist strukturiert in eine Einleitung, Begriffsbestimmungen, eine Typologie der Wohlfahrtsregime nach Esping-Andersen, einen detaillierten Vergleich von Deutschland und Dänemark und ein Fazit. Zusätzlich enthält er eine Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
- Citar trabajo
- Patrick Koops (Autor), 2006, Wohlfahrtsregime nach Esping-Andersen. Deutschland und Dänemark, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/54251