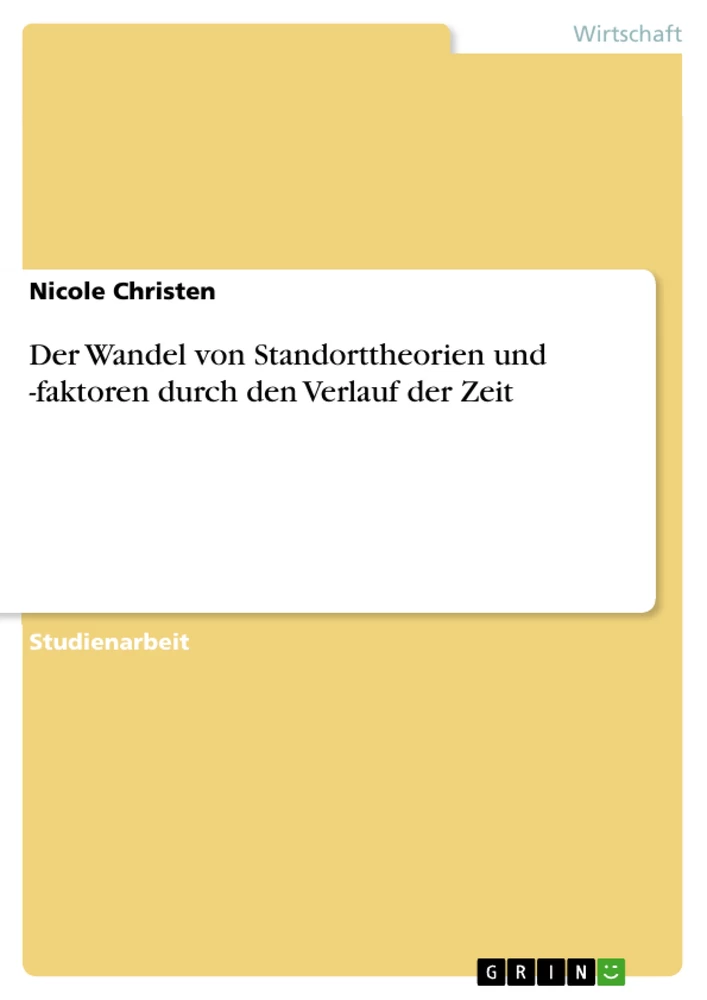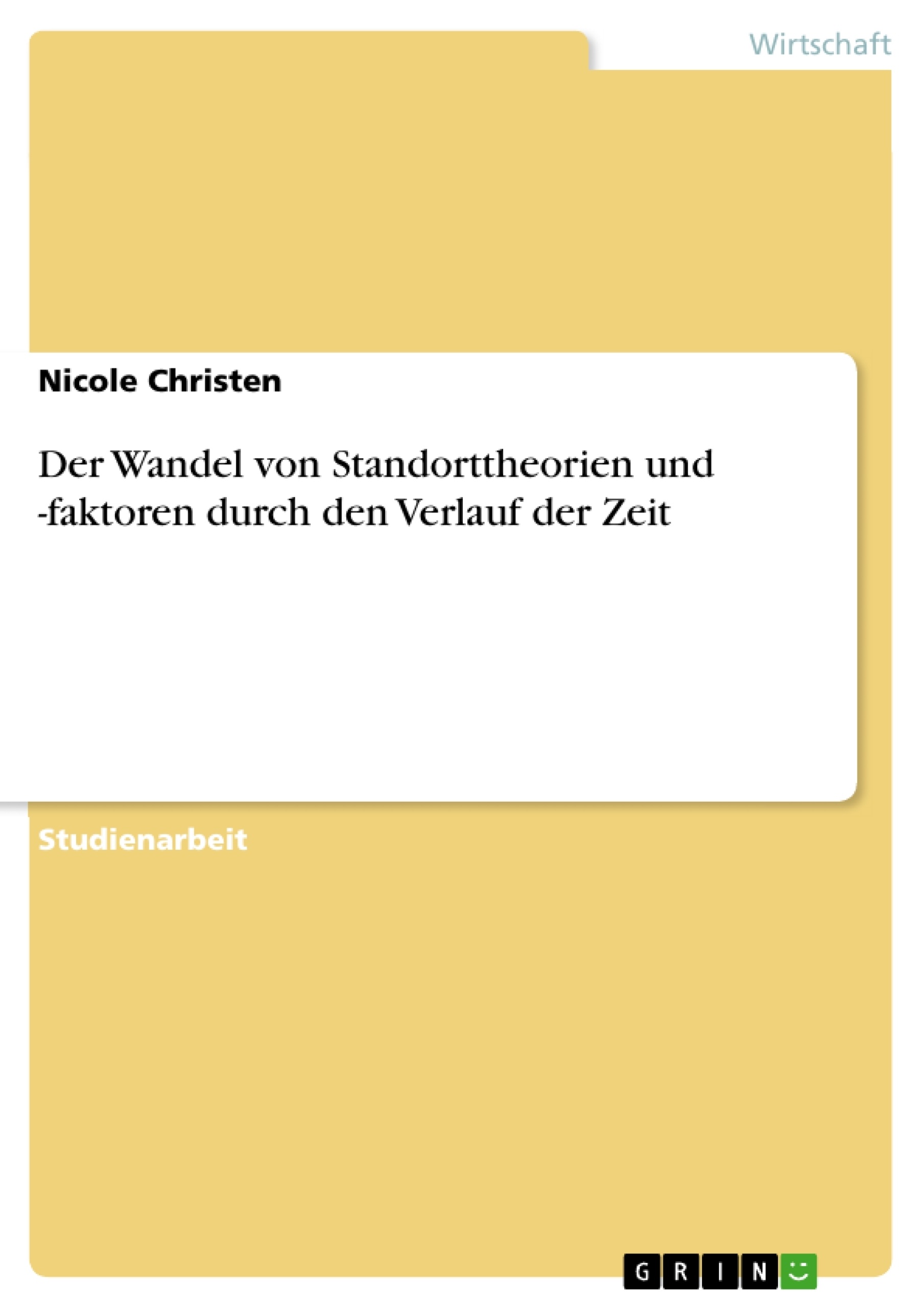Diese Hausarbeit beschäftigt sich zu nächst mit zwei traditionellen Standorttheorien, welche Ende des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts als Mitbegründer der Regionalökonomie gelten. Anschließend wird eine neoklassische Standorttheorie, sowie die Bedeutung von Standortfaktoren näher betrachtet. Abschließend werden Zusammenhänge zwischen den der vorgestellten Standorttheorien und Marktveränderungen untersucht.
Der Standort eines Unternehmens ist der geografische Ort, an welchem dieses seine Produktionsfaktoren zur Erstellung betrieblicher Leistungen einsetzt. Standortentscheidungen haben einen nicht zu vernachlässigen Einfluss auf den Unternehmenserfolg, sie sind insbesondere in Bezug auf Neugründung und Expansionsstrategien relevant und somit ein Bestandteil der strategischen Unternehmensplanung.
Es lässt sich daraus schließen, dass Standortentscheidungen gut überlegt sein sollten. Mit der Frage, welche Faktoren und Umwelteinflüsse bei der Entscheidungsfindung zu beachten sind und durch welche Herangehensweise diese determiniert und priorisiert werden sollten, befassen sich viele Standorttheorien. Mit dem Verlauf der Zeit verändert sich die Umwelt und somit auch dessen Einflüsse auf die Standortwahl.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Traditionelle Standorttheorien
- 2.1 Industriestandorttheorie
- 2.2 Theorie zentraler Orte
- 3. Neoklassische Standorttheorien
- 3.1 Diamant-Modell
- 4. Standortfaktoren
- 5. Standorttheorien und die Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Wandel von Standorttheorien und -faktoren im Laufe der Zeit. Sie analysiert traditionelle und neoklassische Ansätze und beleuchtet deren Bedeutung für die Standortwahl von Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Theoriebildung und dem Einfluss veränderter Umweltbedingungen auf die Entscheidungsfindung.
- Entwicklung traditioneller Standorttheorien (Weber, Christaller)
- Einführung und Erklärung neoklassischer Standorttheorien
- Bedeutung von Standortfaktoren für Unternehmen
- Der Einfluss von Zeit und Marktveränderungen auf Standortentscheidungen
- Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis der Standortwahl
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Standortwahl ein und betont deren strategische Bedeutung für Unternehmenserfolg. Sie beschreibt den Einfluss von Umweltfaktoren und stellt den Aufbau der Arbeit vor, der sich mit traditionellen und neoklassischen Standorttheorien, relevanten Standortfaktoren und dem Einfluss der Zeit auf diese beschäftigt. Die Einleitung unterstreicht die Notwendigkeit einer fundierten Standortwahl und die Relevanz des Verständnisses der verschiedenen Standorttheorien, um strategische Entscheidungen treffen zu können.
2. Traditionelle Standorttheorien: Dieses Kapitel befasst sich mit traditionellen Standorttheorien, die sich hauptsächlich auf einzelwirtschaftliche und gesamtwirtschaftliche Ansätze konzentrieren. Es werden die unternehmerische Mikroperspektive (Standortwahl einzelner Unternehmen) und die Makroperspektive (Standortstruktur) beleuchtet. Die Betonung liegt dabei auf der Berücksichtigung von Transportkosten für die Gewinnmaximierung. Die Kapitel führt die Industriestandorttheorie von Alfred Weber und die Theorie zentraler Orte von Walter Christaller und August Lösch ein, die als Fundament regionalökonomischer Fragestellungen gelten. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Entscheidungsprozesse einzelner Unternehmen und der daraus resultierenden räumlichen Strukturen.
2.1 Industriestandorttheorie: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf Alfred Webers Industriestandorttheorie aus dem Jahr 1909. Webers Modell analysiert die entscheidungsrelevanten Faktoren wie Transport- und Arbeitskosten sowie Agglomerationsvorteile und -nachteile zur Bestimmung des optimalen Produktionsstandorts. Die Theorie betrachtet die Lage von Rohstoffen, Produktionsstätte und Absatzmarkt in Relation zu den Transportkosten. Sie vereinfacht die Produktionsstruktur und geht von zwei Rohstoffen und einem finalen Gut aus, um die Transportkostenoptimierung zu modellieren. Das Modell dient als Basis zur Analyse der räumlichen Verteilung von Industriebetrieben und der Einflussfaktoren auf die Standortwahl.
2.2 Theorie zentraler Orte: Dieser Abschnitt widmet sich der Theorie zentraler Orte von Walter Christaller und August Lösch. Im Gegensatz zur Industriestandorttheorie liegt hier der Fokus auf der Makroperspektive und der Analyse von Mustern und Systemen der Landnutzung, die sich aus individuellen Standortentscheidungen ergeben. Es wird untersucht, wie sich die individuellen Entscheidungen und Verhaltensweisen der Wirtschaftssubjekte auf die Gesamtstruktur der Landnutzung auswirken. Die Theorie erklärt die hierarchische Anordnung von Städten und deren Einzugsgebiete anhand von zentralen Versorgungsfunktionen.
3. Neoklassische Standorttheorien: Dieses Kapitel behandelt neoklassische Standorttheorien und geht über die rein kostenorientierten Ansätze der traditionellen Theorien hinaus. Es wird das Diamant-Modell erläutert, welches Faktoren wie Innovationsfähigkeit, Qualifikation der Arbeitskräfte und Infrastruktur berücksichtigt. Die neoklassischen Ansätze betrachten die dynamischen Aspekte der Standortwahl und die Bedeutung von immateriellen Faktoren für den Unternehmenserfolg.
3.1 Diamant-Modell: Dieser Abschnitt fokussiert sich auf das Diamant-Modell des dynamischen nationalen Vorteils. Im Gegensatz zu den traditionellen Ansätzen werden hier zusätzliche Faktoren wie staatliche Politik, Zufall und Wettbewerb in die Standortwahl einbezogen. Das Modell hebt die Bedeutung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit hervor und erklärt, wie diese Faktoren die Standortentscheidung beeinflussen.
4. Standortfaktoren: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Standortfaktoren, die bei der Entscheidung über einen Unternehmensstandort eine Rolle spielen. Es werden sowohl traditionelle Faktoren wie Transportkosten und Arbeitskosten als auch neuere Faktoren wie Infrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und politische Rahmenbedingungen betrachtet. Die Interaktion und Gewichtung dieser Faktoren werden analysiert.
5. Standorttheorien und die Zeit: Dieses Kapitel analysiert den Wandel von Standorttheorien und -faktoren im Laufe der Zeit. Es zeigt, wie sich die Bedeutung verschiedener Faktoren im Laufe der wirtschaftlichen Entwicklung geändert hat. Dieser Abschnitt beleuchtet die Anpassung von Theorien an veränderte Rahmenbedingungen und die Herausforderungen für Unternehmen in einer dynamischen Welt.
Schlüsselwörter
Standorttheorien, Standortfaktoren, Industriestandorttheorie, Theorie zentraler Orte, Neoklassische Standorttheorien, Diamant-Modell, Transportkosten, Arbeitskosten, Agglomeration, Regionalökonomie, Standortwahl, Unternehmenserfolg, Marktveränderungen, Zeitlicher Wandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wandel von Standorttheorien und -faktoren
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Wandel von Standorttheorien und -faktoren im Laufe der Zeit. Sie untersucht traditionelle und neoklassische Ansätze und deren Bedeutung für die Standortwahl von Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Theoriebildung und dem Einfluss veränderter Umweltbedingungen auf die Entscheidungsfindung. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu traditionellen (Industriestandorttheorie, Theorie zentraler Orte) und neoklassischen Standorttheorien (Diamant-Modell), ein Kapitel zu Standortfaktoren und ein Kapitel zum Einfluss des Zeitfaktors auf Standortentscheidungen.
Welche traditionellen Standorttheorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Industriestandorttheorie von Alfred Weber, die die Transportkostenoptimierung zwischen Rohstoffen, Produktionsstätte und Absatzmarkt im Fokus hat, und die Theorie zentraler Orte von Walter Christaller und August Lösch, die die hierarchische Anordnung von Städten und deren Einzugsgebiete aufgrund zentraler Versorgungsfunktionen erklärt.
Was sind neoklassische Standorttheorien und welches Modell wird behandelt?
Neoklassische Standorttheorien gehen über rein kostenorientierte Ansätze hinaus und berücksichtigen immaterielle Faktoren. Die Arbeit erläutert das Diamant-Modell, welches neben traditionellen Faktoren auch Innovationsfähigkeit, Qualifikation der Arbeitskräfte, Infrastruktur, staatliche Politik, Zufall und Wettbewerb in die Standortwahl einbezieht.
Welche Standortfaktoren werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert sowohl traditionelle Standortfaktoren wie Transportkosten und Arbeitskosten als auch neuere Faktoren wie Infrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und politische Rahmenbedingungen und deren Interaktion.
Wie wird der Einfluss der Zeit auf Standortentscheidungen betrachtet?
Die Arbeit analysiert den Wandel von Standorttheorien und -faktoren im Laufe der Zeit und zeigt, wie sich die Bedeutung verschiedener Faktoren im Laufe der wirtschaftlichen Entwicklung verändert hat. Sie beleuchtet die Anpassung von Theorien an veränderte Rahmenbedingungen und die Herausforderungen für Unternehmen in einer dynamischen Welt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Standorttheorien, Standortfaktoren, Industriestandorttheorie, Theorie zentraler Orte, Neoklassische Standorttheorien, Diamant-Modell, Transportkosten, Arbeitskosten, Agglomeration, Regionalökonomie, Standortwahl, Unternehmenserfolg, Marktveränderungen, Zeitlicher Wandel.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu traditionellen und neoklassischen Standorttheorien (mit Unterkapiteln zu den jeweiligen Modellen), ein Kapitel zu Standortfaktoren und ein Kapitel zum Einfluss der Zeit auf Standortentscheidungen. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der behandelten Inhalte.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung des Wandels von Standorttheorien und -faktoren im Laufe der Zeit, die Analyse traditioneller und neoklassischer Ansätze und die Beleuchtung deren Bedeutung für die Standortwahl von Unternehmen.
- Quote paper
- Nicole Christen (Author), 2020, Der Wandel von Standorttheorien und -faktoren durch den Verlauf der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/542202