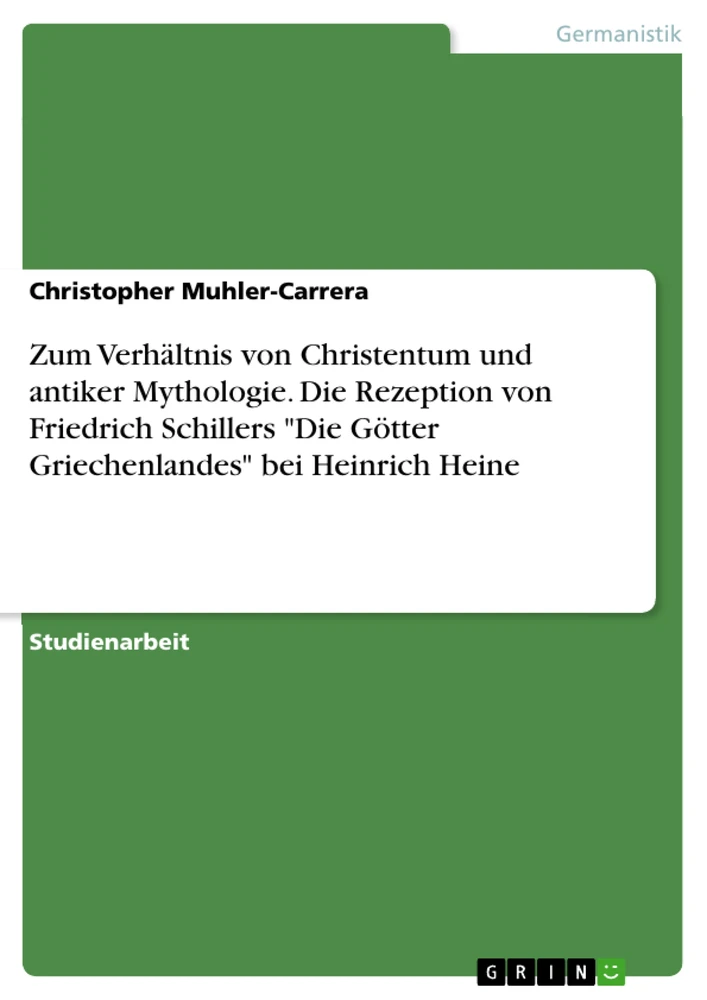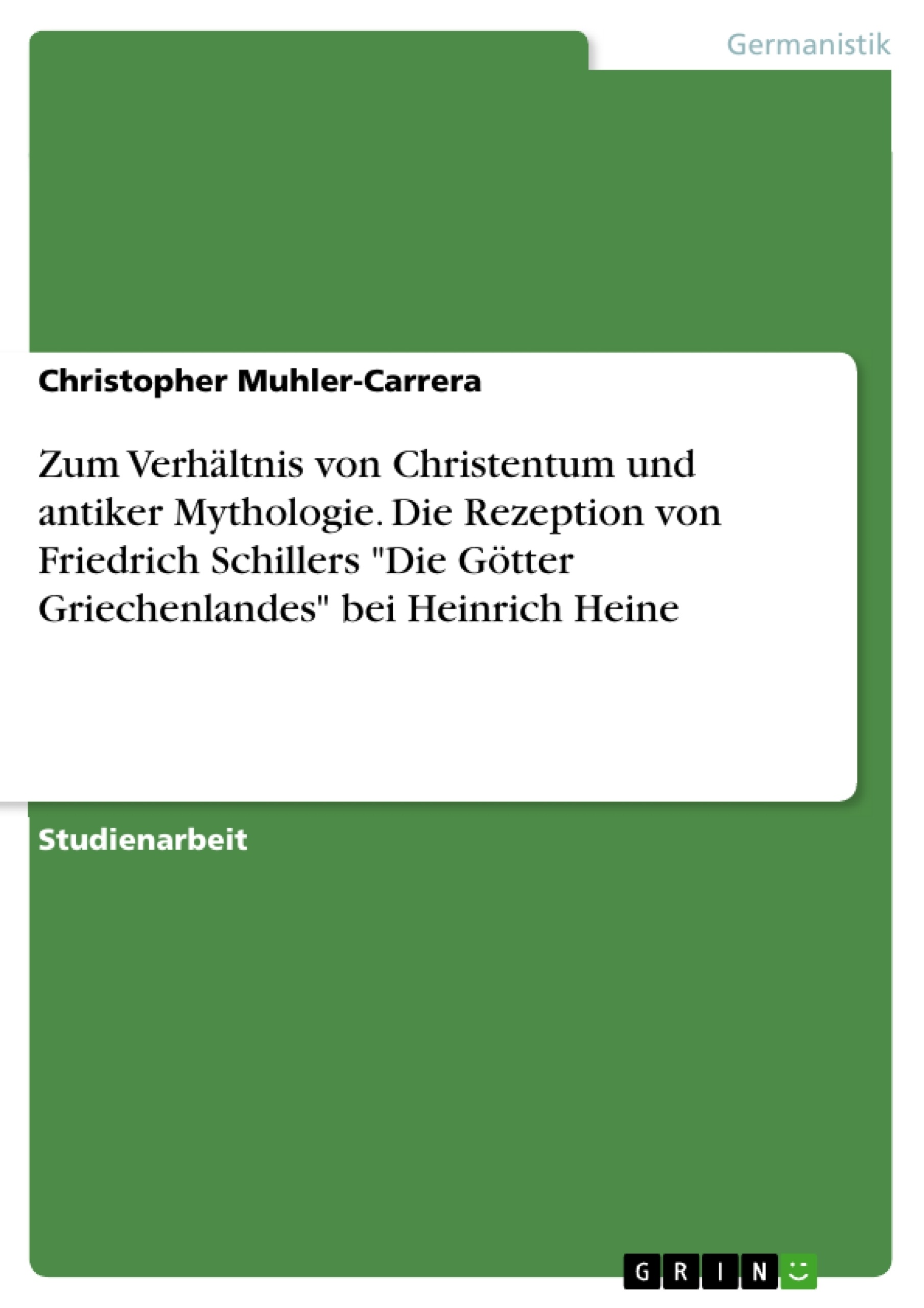Die Frage nach dem Verhältnis von Göttern und Menschen zeigte sich schon immer in vielen Bereichen unseres Lebens: Sei es die Verehrung der Götter durch den Bau von Tempeln, die Durchführung von Ritualen oder die Errichtung von Statuen in der antiken Welt, das Thema der Götterdämmerung in der musikalischen Umsetzung durch Richard Wagner oder die Verarbeitung der griechischen Mythologie in der Literatur, wie sie bei Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe und Heinrich Heine zu finden ist. In der folgenden Arbeit untersuche ich am Beispiel von Heinrich Heines Elegie "Die Götter Griechenlands" dessen literarische Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen und Motiven wie der apokryphen Präsenz der Götter, der Entgötterung der Natur, der Götterdämmerung (Kampf und Tod der Götter) und dem daraus resultierenden Machtverlust sowie dem Prometheusmotiv, welches für die Auflehnung des Menschen gegen die Götter steht. Von großer Bedeutung ist hierbei der historische Kontext.
Wie in Kapitel II erläutert werden wird, war nach der Restauration 1815 eine Rechristianisierung im Gange, die andere Glaubensrichtungen wie die antike Mythologie verteufelte. So lässt sich auch auf Basis der Forschungsliteratur belegen, dass die genannten Themen und Motive das Verhältnis von Christentum und Mythologie widerspiegeln und nicht der Kampf der Götter untereinander im Vordergrund steht.
Ausgehend von einer Zusammenfassung des historischen Kontextes und Heines Sicht auf Mythologie und Religion, wird anschließend Friedrich Schillers Die Götter Griechenlandes in seinen Kernaussagen zusammengefasst und interpretiert, da die Dichtung als Vorlage für Heines Die Götter Griechenlands diente. Dessen Rezeption bildet sodann den Hauptteil der Arbeit und umfasst die Entstehungsgeschichte, die formale und inhaltliche Analyse sowie die Interpretation der Götter Griechenlands im Hinblick auf die oben genannten Themen und Motive. Zuletzt sollen in einem Fazit die Kernaussagen von Heines Gedicht zusammengefasst und dem Werk Schillers gegenübergestellt werden, um aufzuzeigen, wie dasselbe Thema durchaus unterschiedliche Ausprägungen annehmen kann.
Die Grundlagen der Ausführungen bilden zu allererst die jeweiligen historisch-kritischen Werkausgaben der Dichtungen, hier speziell die Düsseldorfer Heine-Ausgabe sowie die Nationalausgabe von Schillers Werken. Im späteren Verlauf wird außerdem Bezug auf Johann Wolfgang von Goethes Prometheus nach der Hamburger Ausgabe genommen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung.
- II. Heines Verhältnis zu Religion und Mythologie.
- III. Die Inspiration Heinrich Heines. Friedrich Schillers Die Götter Griechenlandes im Vergleich der Fassungen.
- 4.1: Entstehung und Überlieferung.
- 4.2: Formale Analyse.
- 4.3: Interpretation
- V. Fazit: Die Götter Griechenland(e)s im Werkvergleich.
- VI. Bibliographie.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Heinrich Heines Elegie „Die Götter Griechenlands“ im Kontext der religiösen und mythologischen Auseinandersetzungen des 19. Jahrhunderts. Die Untersuchung konzentriert sich auf die literarische Auseinandersetzung mit Themen und Motiven wie der apokryphen Präsenz der Götter, der Entgötterung der Natur, der Götterdämmerung und dem daraus resultierenden Machtverlust sowie dem Prometheusmotiv.
- Heines Sicht auf Mythologie und Religion im Kontext des religiösen Wandels des 19. Jahrhunderts
- Die Bedeutung des historischen Kontextes und der Rechristianisierung nach der Restauration von 1815
- Der Einfluss von Friedrich Schillers „Die Götter Griechenlands“ auf Heines Werk
- Die Rezeption der griechischen Mythologie bei Heine, insbesondere die Themen Götterdämmerung und Prometheusmotiv
- Der Vergleich von Heines und Schillers Sicht auf die Götter Griechenlands
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den historischen Kontext und die Bedeutung der griechischen Mythologie in verschiedenen Kulturepochen beleuchtet. Anschließend wird Heines Verhältnis zu Religion und Mythologie, insbesondere seine Verehrung der antiken Götterwelt, im Kontext der religiösen Veränderungen des 19. Jahrhunderts dargestellt. Darauf folgt eine Zusammenfassung und Interpretation von Friedrich Schillers „Die Götter Griechenlands“, die als Vorlage für Heines Werk diente.
Der Hauptteil der Arbeit widmet sich der Rezeption der Götter Griechenlands bei Heine. Es werden die Entstehungsgeschichte, die formale und inhaltliche Analyse sowie die Interpretation der Elegie im Hinblick auf die zuvor genannten Themen und Motive behandelt. Dabei wird auch auf die Bedeutung des Prometheusmotivs und der Götterdämmerung eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Schlüsselbegriffen: Heinrich Heine, Friedrich Schiller, Die Götter Griechenlands, antike Mythologie, Religion, Götterdämmerung, Prometheusmotiv, Rechristianisierung, Entgötterung der Natur, apokryphe Präsenz, historische Kontext.
- Quote paper
- Christopher Muhler-Carrera (Author), 2013, Zum Verhältnis von Christentum und antiker Mythologie. Die Rezeption von Friedrich Schillers "Die Götter Griechenlandes" bei Heinrich Heine, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/541813