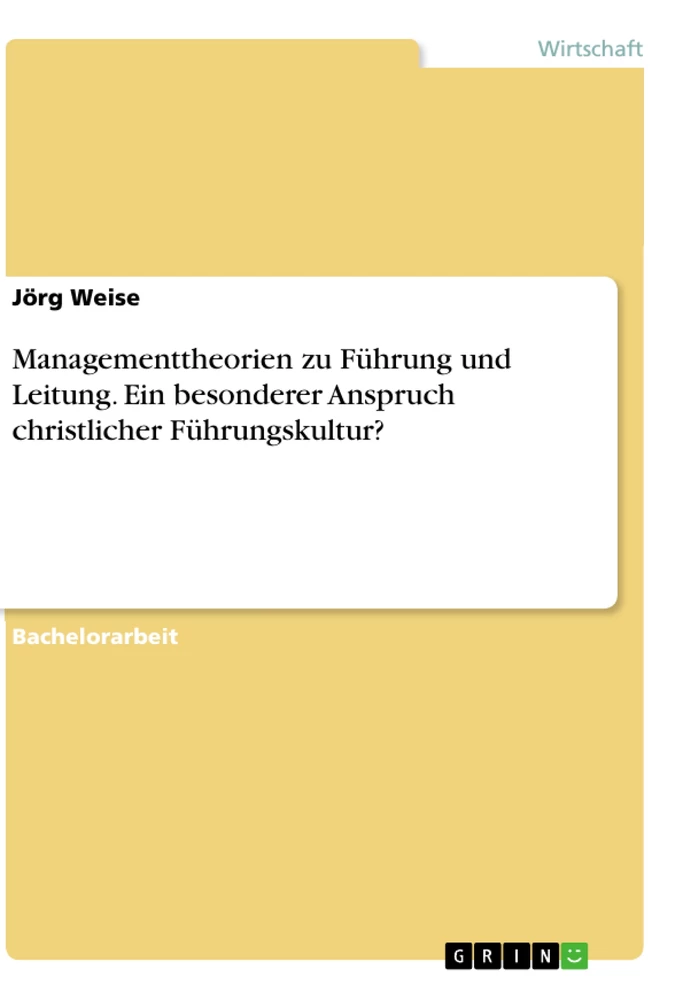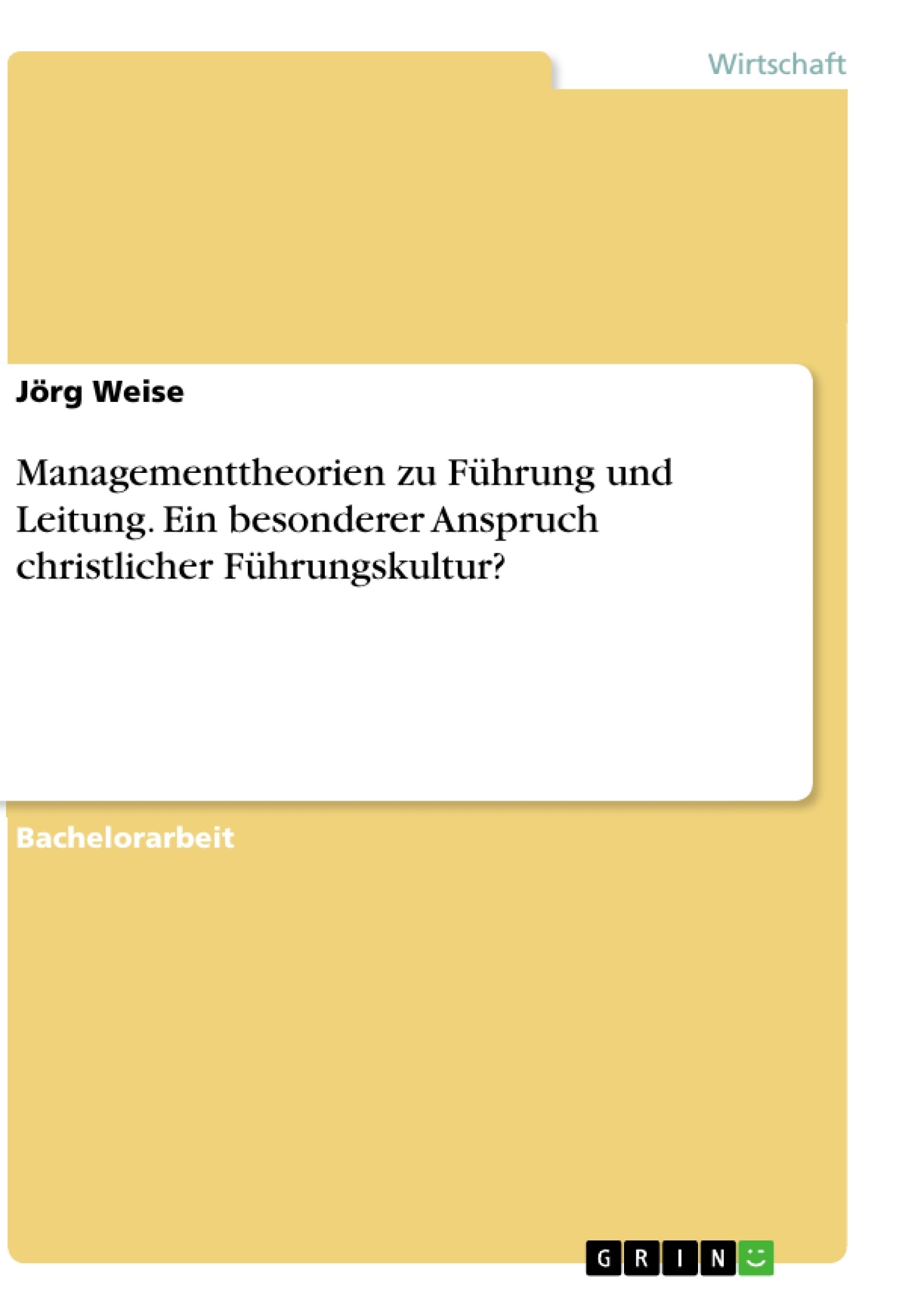In Deutschland ist mit den Wohlfahrtsverbänden ein soziales Netz gewachsen, das bislang einzigartig auf derWelt ist. Mit über 1,4 Millionen Arbeitnehmern und über 2 Millionen ehrenamtlichen Mitarbeitern sind diese einer der größten privaten Arbeitgeberverbände. Ihre Wurzeln liegen meist in der christlichen Kultur des Alten und Neuen Testamentes, in dem Gebot: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ (Gal. 5,14) begründet.
Die Moderne hingegen ist geprägt von Pluralisierung und Säkularisierung. Diese Strömungen können als konträr zu den Werten konfessionsorientierter Unternehmen erlebt werden. Für diese wird es daher zunehmend wichtiger, ihr eigenes Profil zu stärken und ihre Inhalte, Satzungen, Konzepte, Grundsatzprogramme et al. mit neuem Leben zu füllen. Dies ist besonders in Zeiten von demografischem Wandel, Multikulturalismus und Fachkräftemangel ein umso relevanterer Aspekt.
Es stellt sich daher nicht mehr nur die Frage nach qualifizierten Mitarbeitern. Für konfessionsorientierte Unternehmen drängt sich stattdessen vielmehr die Frage auf: „Welche Überzeugungen prägen unsere Unternehmen und wie realisieren wir sie in einem veränderten Personalmarkt?“. Es ist die Frage, ob „Konfessionsorientierung als Merkmal und Gestaltungsaufgabe der christlichen Unternehmen […] zu sehen sind“ und welchen Einfluss diese identitätsstiftenden Organisationsmerkmale auf die Mitarbeiter haben.
Diese Arbeit stellt eine Grundlegung eines partnerschaftlichen Diskurses von Ökonomie und Theologie dar, jenseits von Dominanzmodellen oder einer Vermischung der jeweiligen Fachlichkeiten. Der Fokus liegt dabei auf der Bewältigung komplexer Managementaufgaben innerhalb diakonischer bzw. caritativer Einrichtungen.
Inhaltsverzeichnis
- Exposé
- 1 Theorien zu Führung und Leitung
- 1.1 Begriffsklärung
- 1.1.1 Was verstehen wir unter Führung?
- 1.1.2 Historische Entwicklung von Führungsmodellen
- 1.2 Grundlagen der Führungsmodelle
- 1.2.1 Führungsstil nach Max Weber
- 1.2.2 Führungsstil nach Kurt Lewin
- 1.2.3 Vom Eigenschaftsmodell (Oswald Neuberger) zum Attributionsmodell der Führung
- 1.1 Begriffsklärung
- 2 Führungsmodelle im systemischen Kontext
- 2.1 säkulare Führungsmodelle
- 2.1.1 Transaktionale und Transformationale Führung (James MacGregor Burns)
- 2.1.2 Das neue Sangt Gallener Führungsmodell
- 2.2 Führungsmodell des Benedict von Nursia
- 2.2.1 Kerngedanken der Regula Benedicti
- 2.2.1 Hierarchie und Teamgedanke in der Regula Benedicti
- 2.2.3 Ökonomische Arbeit in spiritueller Haltung
- 2.1 säkulare Führungsmodelle
- 3 Dimensionen und Gestaltungsebenen diakonischer und caritativer Praxis
- 3.1 Vor welchen Herausforderungen stehen konfessionelle Unternehmen?
- 3.2 Identität vs. Diversität konfessioneller Unternehmen
- 3.3 Schwerpunktthemen aus der Praxis
- 3.3.2 Leitbild
- 3.3.3 Führung
- 3.3.4 Entscheidungsmanagement
- 4 Validierung des St. Gallener Managementmodells auf die christl. Führungskultur
- 4.1 Umweltsphären
- 4.2 Anspruchsgruppen
- 4.2.1 Strategisches Anspruchsgruppenkonzept
- 4.2.2 Theologisches Anspruchsgruppenkonzept
- 4.3 Managementebenen als reflexive Gestaltungspraxis
- 4.3.1 Prozesse (Managementprozesse, Geschäftsprozesse, Unterstützungsprozesse)
- 4.3.2 Ordnungsmomente (Strategie, Strukturen, Kultur)
- 4.3.3 Entwicklungsmodi (Erneuerung, Optimierung)
- 5 Zusammenfassung der Ergebnisse, Fazit der Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die diakonische Unternehmenskultur als Managementkonzept den Versuch darstellt, spirituelle Traditionen durch Elemente organisationalen Handelns in Einrichtungen zu verorten.
- Die Arbeit untersucht die Kompatibilität von Managementtheorien zu Führung und Leitung mit dem besonderen Anspruch christlicher Führungskultur.
- Dabei werden sowohl säkulare als auch konfessionelle Führungsmodelle beleuchtet.
- Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Gestaltungsebenen diakonischer und caritativer Unternehmen.
- Im Fokus steht die Validierung des St. Gallener Managementmodells auf die christliche Führungskultur.
- Die Arbeit trägt zum Diskurs über die Verbindung von Ökonomie und Theologie in konfessionsgebundenen Unternehmen bei.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Begriffsklärung des Begriffs "Führung" und beleuchtet dessen historische Entwicklung. Anschließend werden verschiedene Grundlagenmodelle von Führung und Leitung vorgestellt, darunter die Ansätze von Max Weber, Kurt Lewin und Oswald Neuberger. Im zweiten Kapitel werden säkulare Führungsmodelle, insbesondere das St. Gallener Modell, betrachtet. Im Kontrast dazu wird das Führungsmodell des heiligen Benedict von Nursia vorgestellt. Das dritte Kapitel analysiert die Herausforderungen und Gestaltungsebenen diakonischer und caritativer Unternehmen, wobei Schwerpunktthemen wie Leitbild, Führung und Entscheidungsmanagement beleuchtet werden. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Validierung des St. Gallener Managementmodells auf die christliche Führungskultur, wobei die Umweltsphären und Anspruchsgruppen betrachtet werden. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und zieht ein Fazit der Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Führung und Leitung, christliche Unternehmenskultur, diakonische Unternehmen, Managementtheorien, St. Gallener Modell, Benedict von Nursia, Leitbild, Entscheidungsmanagement, Identität, Diversität, Ökonomie und Theologie.
- Quote paper
- Jörg Weise (Author), 2019, Managementtheorien zu Führung und Leitung. Ein besonderer Anspruch christlicher Führungskultur?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/540728