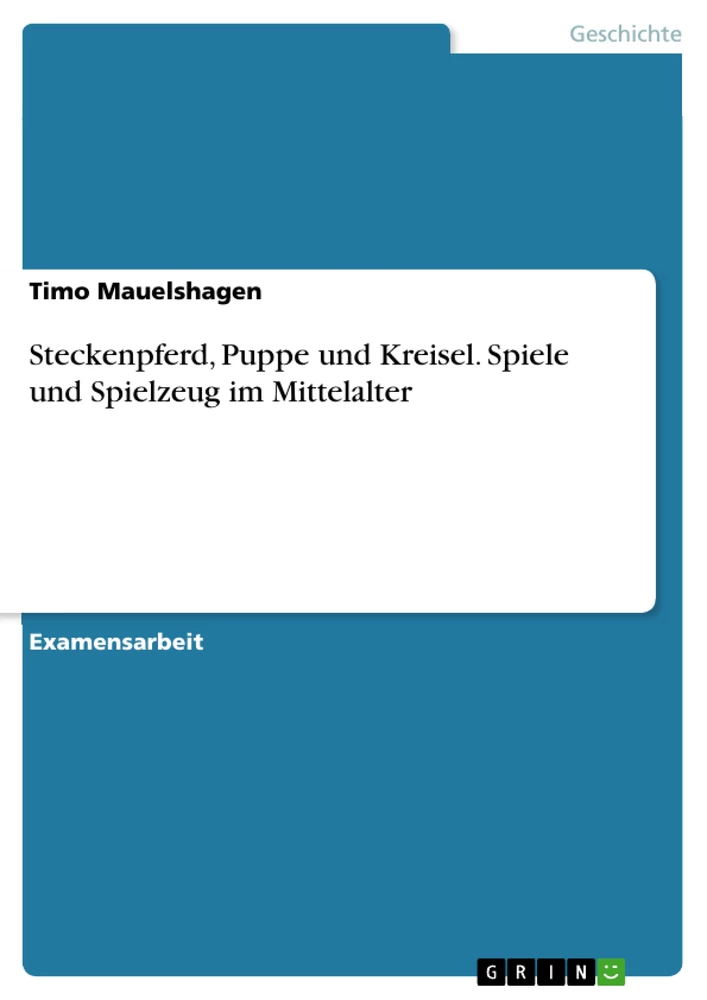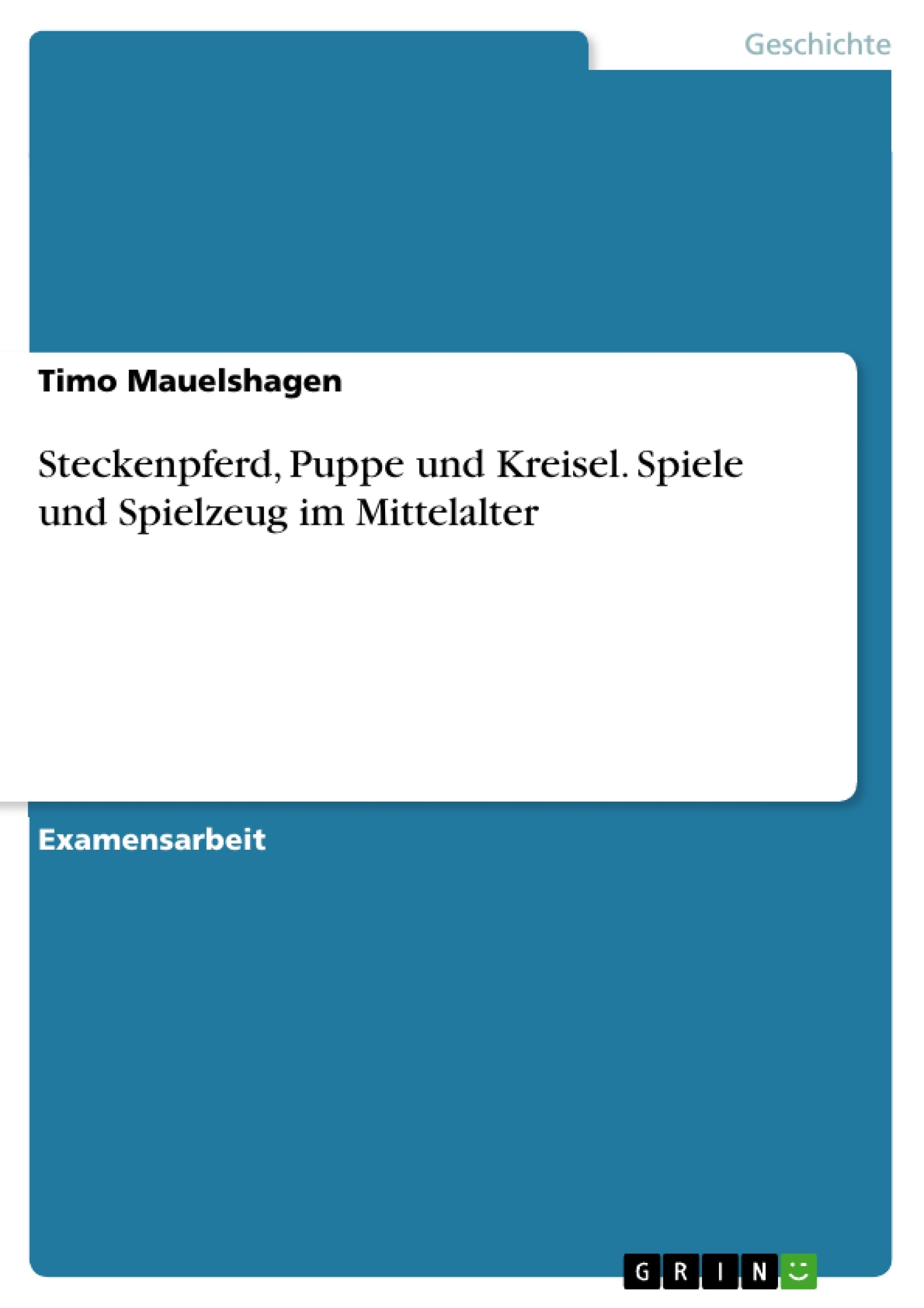Wie betrachteten etwa die Menschen des Mittelalters Spiel und Spielzeug?
Auch noch in jüngeren Publikationen und insbesondere in gebräuchlichen Redewendungen finden wir hierzu, obwohl durch zahlreiche neuere Erkenntnisse bereits deutlich wurde, dass „sich das Leben und Verhalten der Menschen vor siebenhundert Jahren in vielen Bereichen gar nicht so sehr von dem der Neuzeit unterschied“, die Floskel vom ach so “finsteren“ Mittelalter.
Nicht zuletzt Philippe Ariès und Lloyd deMause prägten das Negativbild vom Leben der Kinder im Mittelalter, deren Existenz als ein einziger Alptraum geschildert wird. Würde man diesen Überlegungen folgen, so ergäbe sich insgesamt ein sehr düsteres Bild für diese Zeit - nicht nur für die Kindheit.
Doch insbesondere die vielen Funde von Spielzeug und Spielgerät werfen einen hellen Schein auf die menschlichen Tätigkeiten im Mittelalter. Dieser Aspekt lässt die Welt der Kinder zur damaligen Zeit wieder lebendig erscheinen. Mehr als bei anderen Gegenständen erhält der Betrachter den Eindruck, in einen direkten Kontakt mit den mittelalterlichen Menschen zu kommen. Es gilt, diese Überlegungen umso mehr zu berücksichtigen, als dass Kinder in der Geschichte der “Großen“ zumeist nur am Rande vorkommen, da sie für die Geschichtsschreiber keinerlei Stellenwert besitzen. Dieser “helle Schein“ soll nun in der vorliegenden Ausarbeitung aufgegriffen werden, um die Facetten des mittelalterlichen Spiels für heutige pädagogische und curriculare Überlegungen fruchtbar zu machen. „Das Licht, das Spielsachen auf das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben einer Zeit werfen, ist äußerst bedeutsam und für viele vielleicht die ergiebigste Seite an der Geschichte des Spielzeugs, nachdem dieses seinen eigentlichen Gebrauchszweck eindeutig verloren hat und einem Museum oder einer Sammlung einverleibt wurde“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegende Anmerkungen
- Anmerkungen zum Begriff "Kindheit"
- Lebensalter und Kindheit im Mittelalter - Definitionen
- Einstellung gegenüber dem Kind
- Das Spiel als gesellschaftlicher Allgemeinplatz
- Eine kurze Definition des Spiels
- Der Begriff des Spiels
- Das Wesen des Spiels: Spiel und Ernst
- Erwachsene und Kinder
- Einstellung zum Spiel
- Funktion des Spiels
- Spiel und Spielzeug als Erziehungsmittel
- Neuere Denk- und Betrachtungsweisen – Gender Aspects?
- Zeitvertreib in einer Zeit, in der die Zeit nicht bekannt war
- Quellenlage
- Archäologische Funde
- Bildliche Darstellungen
- Zeitlicher Rahmen
- Bildquellen
- Schriftliche Quellen
- Schwierigkeiten bei der Auswertung von schriftlichen Quellen
- Abschließende Betrachtung der Quellen
- Das breite Spektrum mittelalterlichen Spielzeugs
- Exemplarischer Abriss über mittelalterliches Spielzeug
- Klappern und Rasseln
- Steckenpferd
- Windrädchen
- Kreisel
- Puppe
- Gewerbsmäßige Herstellung von Holzpuppen
- Gewerbsmäßige Herstellung von Puppen aus Ton
- Ein Geschenk zur Taufe?
- Puppengeschirr und anderes Zubehör
- Reiterfiguren
- Abschließende Überlegungen
- Mittelalterlicher Spielzeugmarkt
- Die Spielwelt der Erwachsenen
- Lauter kleine Kugeln
- Ein gar königliches Spiel
- Spielsucht und -leidenschaft
- Was bieten Spiel und Spielzeug für die Schule?
- Eine erste didaktische Begründung
- Weitere Überlegungen – Veränderungen in der Geschichte
- Wie bringe ich das Thema in den Unterricht? – Rahmenrichtlinien
- Ziele der Unterrichtseinheit
- Ein Bild als Mittelpunkt der Thematik – Pieter Bruegels "Kinderspiele"
- Eine Zeitreise in die Vergangenheit
- Die Vielzahl der Spiele und Spielmöglichkeiten
- Weitere Fragestellungen an das Bild
- Anknüpfungspunkte an Bruegel
- Alte Spiele - Neu entdeckt
- Murmeln auf dem Pausenhof
- Kreisel im Unterricht
- Wir basteln ein Steckenpferd
- Der krönende Abschluss – Ein Besuch im Museum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Spiel und Spielzeug im Mittelalter. Ziel ist es, ein umfassenderes Bild vom kindlichen Alltag und den gesellschaftlichen Aspekten des Spiels in dieser Epoche zu zeichnen, die gängigen Klischees vom "finsteren Mittelalter" zu hinterfragen und didaktische Implikationen für den heutigen Schulunterricht aufzuzeigen.
- Das Bild der Kindheit im Mittelalter
- Die Bedeutung des Spiels im mittelalterlichen Alltag
- Arten und Verbreitung von mittelalterlichem Spielzeug
- Die Quellenlage zur Erforschung des Themas
- Didaktische Anwendung im Schulunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und betont die Aktualität des Mittelalters in der heutigen Gesellschaft, hebt jedoch gleichzeitig die Forschungslücke bezüglich des Spiels und Spielzeugs im mittelalterlichen kindlichen Alltag hervor. Sie stellt die gängigen, negativen Klischees über das Mittelalter in Frage und kündigt die Zielsetzung der Arbeit an: eine differenzierte Betrachtung der Thematik.
Grundlegende Anmerkungen: Dieses Kapitel dient als Grundlage für die spätere Diskussion. Es werden wichtige Begriffe und Konzepte eingeführt und die methodische Vorgehensweise der Arbeit skizziert.
Anmerkungen zum Begriff "Kindheit": Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Auffassungen von Kindheit im Mittelalter im Vergleich zur Neuzeit. Es werden verschiedene Definitionen von Lebensaltern diskutiert und die Einstellungen gegenüber Kindern analysiert.
Das Spiel als gesellschaftlicher Allgemeinplatz: In diesem Kapitel wird der Begriff „Spiel“ definiert und seine Bedeutung im mittelalterlichen Kontext untersucht. Die verschiedenen Funktionen des Spiels für Kinder und Erwachsene werden beleuchtet sowie die gesellschaftlichen Einstellungen zum Spiel thematisiert.
Funktion des Spiels: Dieses Kapitel erörtert die verschiedenen Funktionen von Spiel und Spielzeug. Es werden pädagogische Aspekte, Gender-Aspekte und die Rolle des Spiels als Zeitvertreib diskutiert. Die Perspektive wird geweitet, indem neuere Denk- und Betrachtungsweisen mit einbezogen werden.
Quellenlage: Dieses Kapitel beschreibt die Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Erforschung des Themas aufgrund der begrenzten und unterschiedlichartigen Quellenlage. Archäologische Funde, bildliche Darstellungen und schriftliche Quellen werden kritisch gewürdigt. Die Grenzen und Möglichkeiten der verschiedenen Quellenarten werden ausführlich dargestellt.
Das breite Spektrum mittelalterlichen Spielzeugs: Hier wird die Vielfalt an Spielzeug im Mittelalter behandelt, wobei ein Überblick über die verschiedenen Spielzeugtypen gegeben wird. Die Kapitel dienen als Grundlage für die detaillierte Betrachtung im folgenden Kapitel.
Exemplarischer Abriss über mittelalterliches Spielzeug: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung verschiedener Spielzeuge, wie z.B. Klappern, Rasseln, Steckenpferde, Kreisel und Puppen. Für jedes Spielzeug werden Herstellungsverfahren, Verwendung und gesellschaftliche Bedeutung diskutiert. Es wird deutlich, dass Spielzeug nicht nur zum Vergnügen, sondern auch zur Erziehung und zur Entwicklung von Fähigkeiten diente.
Mittelalterlicher Spielzeugmarkt: Dieses Kapitel behandelt den Aspekt des Handels mit Spielzeug im Mittelalter, beleuchtet die Herstellung und den Vertrieb von Spielzeug, und die damit verbundenen wirtschaftlichen Aspekte.
Die Spielwelt der Erwachsenen: Dieses Kapitel untersucht den Stellenwert von Spielen auch unter Erwachsenen, unter anderem den Aspekt der Spielsucht und -leidenschaft.
Was bieten Spiel und Spielzeug für die Schule?: Dieses Kapitel widmet sich der didaktischen Bedeutung des Themas für den Schulunterricht. Es werden Möglichkeiten zur Umsetzung im Unterricht, didaktische Überlegungen und die Einbindung der Thematik in die Rahmenrichtlinien diskutiert.
Ein Bild als Mittelpunkt der Thematik – Pieter Bruegels "Kinderspiele": Dieses Kapitel analysiert das berühmte Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren "Kinderspiele" als Quelle und als Beispiel für die Vielfalt der mittelalterlichen Spiele und Spielzeug.
Alte Spiele - Neu entdeckt: In diesem Kapitel werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie mittelalterliche Spiele in den heutigen Unterricht integriert werden können. Es werden konkrete Beispiele wie Murmelspiele, Kreisel und das Basteln von Steckenpferden gegeben.
Der krönende Abschluss – Ein Besuch im Museum: Dieses Kapitel schlägt einen Museumsbesuch vor, um die Thematik zu vertiefen.
Schlüsselwörter
Mittelalter, Kindheit, Spiel, Spielzeug, Pädagogik, Geschichte, Quellenlage, Archäologie, Bildquellen, Schriftquellen, Didaktik, Schulunterricht, Pieter Bruegel, Kinderspiele.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Spiel und Spielzeug im Mittelalter"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über das Thema "Spiel und Spielzeug im Mittelalter". Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Erforschung des kindlichen Alltags im Mittelalter, der Bedeutung des Spiels in dieser Epoche und der didaktischen Anwendung des Themas im Schulunterricht.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Grundlegende Anmerkungen, Anmerkungen zum Begriff "Kindheit", Das Spiel als gesellschaftlicher Allgemeinplatz, Funktion des Spiels, Quellenlage, Das breite Spektrum mittelalterlichen Spielzeugs, Exemplarischer Abriss über mittelalterliches Spielzeug, Mittelalterlicher Spielzeugmarkt, Die Spielwelt der Erwachsenen, Was bieten Spiel und Spielzeug für die Schule?, Ein Bild als Mittelpunkt der Thematik – Pieter Bruegels "Kinderspiele", Alte Spiele - Neu entdeckt, und Der krönende Abschluss – Ein Besuch im Museum.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Ziel des Dokuments ist es, ein umfassenderes Bild vom kindlichen Alltag und den gesellschaftlichen Aspekten des Spiels im Mittelalter zu zeichnen. Es möchte gängige Klischees vom "finsteren Mittelalter" hinterfragen und didaktische Implikationen für den heutigen Schulunterricht aufzeigen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen das Bild der Kindheit im Mittelalter, die Bedeutung des Spiels im mittelalterlichen Alltag, Arten und Verbreitung von mittelalterlichem Spielzeug, die Quellenlage zur Erforschung des Themas und die didaktische Anwendung im Schulunterricht.
Welche Arten von Spielzeug werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt eine Vielzahl von mittelalterlichem Spielzeug, darunter Klappern, Rasseln, Steckenpferde, Kreisel und Puppen. Es werden auch die Herstellungsverfahren und die gesellschaftliche Bedeutung der einzelnen Spielzeuge diskutiert.
Welche Quellen wurden verwendet?
Das Dokument analysiert verschiedene Quellenarten, darunter archäologische Funde, bildliche Darstellungen (insbesondere das Gemälde "Kinderspiele" von Pieter Bruegel dem Älteren) und schriftliche Quellen. Es werden auch die Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Auswertung dieser Quellen angesprochen.
Wie kann das Thema im Schulunterricht eingesetzt werden?
Das Dokument bietet didaktische Überlegungen und konkrete Vorschläge zur Integration des Themas "Spiel und Spielzeug im Mittelalter" in den Schulunterricht. Es werden Möglichkeiten zur Umsetzung im Unterricht, didaktische Überlegungen und die Einbindung der Thematik in die Rahmenrichtlinien diskutiert. Beispiele für praktische Aktivitäten wie das Basteln von Steckenpferden oder das Spielen mit Murmeln werden gegeben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Dokuments beschreiben, sind: Mittelalter, Kindheit, Spiel, Spielzeug, Pädagogik, Geschichte, Quellenlage, Archäologie, Bildquellen, Schriftquellen, Didaktik, Schulunterricht, Pieter Bruegel, Kinderspiele.
- Quote paper
- Timo Mauelshagen (Author), 2005, Steckenpferd, Puppe und Kreisel. Spiele und Spielzeug im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53995