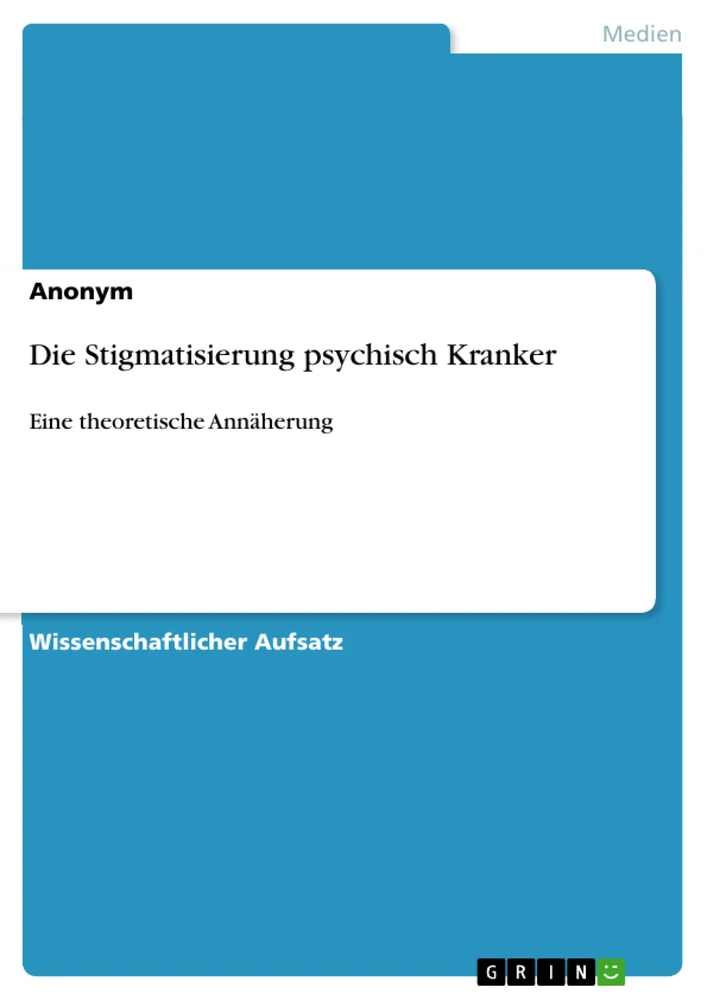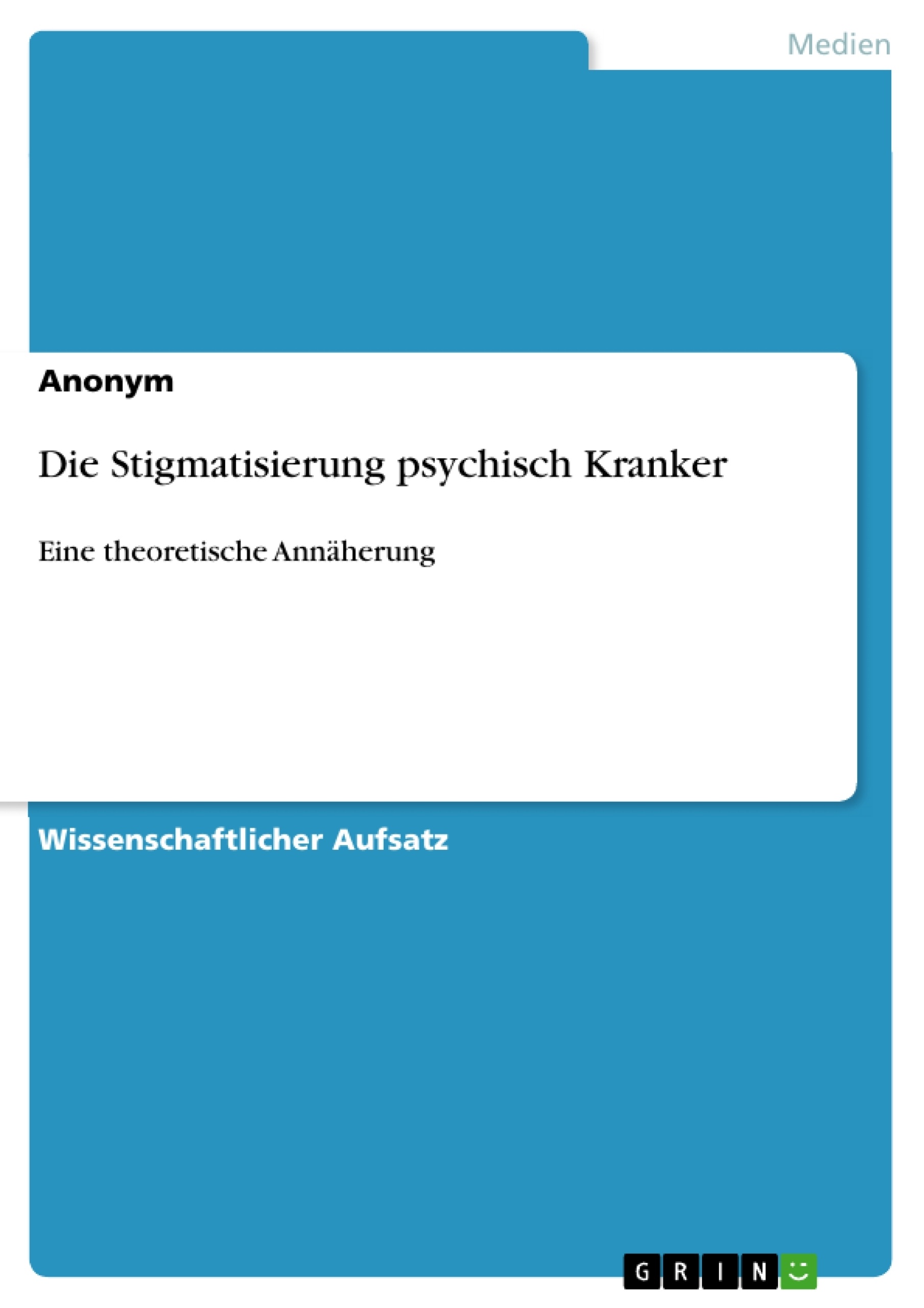Dieses wissenschaftliche Projekt folgt dem Versuch, eine möglichst umfassende und breit aufgestellte, theoretische Übersicht über die Stigmatisierung psychisch Kranker zu liefern. Dafür werden anfangs grundlegende Begriffe wie „Stigma“ und „Stigmatisierung“, „Stereotyp“ und „Vorurteil“ erläutert und voneinander abgegrenzt. Die Definitionen deuten bereits vereinzelt Funktionen von Stigmata an, die im darauffolgenden Kapitel geschildert werden. Nachdem die Darstellung einiger grundlegender Hypothesen für die Herausbildung von Stigmata erfolgt, werden ausgewählte Modelle des Stigmatisierungsprozesses in verkürztem Umfang vorgestellt.
Aufgrund der Vielzahl unterschiedlichster Erklärungsansätze liegt der Fokus dieser Arbeit auf einigen wegweisenden und frühen Erklärungsmodellen, auf die die heutige einschlägige Literatur noch immer verweist. Nachdem die Grundlagen rund um den Begriff „Stigma“ geschaffen wurden, ist es das weitere Bestreben des Projektes, darüber aufzuklären, was eine „psychische Krankheit“ bzw. „psychische Störung“ ist. Wie es in der Theorie häufig der Fall ist, bestehen nahezu unzählige Definitionsversuche für diese Termini, sodass man sich diesen Begrifflichkeiten im Rahmen der Arbeit nur annähern kann. Wie eingangs erläutert, wurde durch den 1975 hervorgerufenen Reformprozess der Psychiatrie eine wesentliche Grundlage für die bis heute andauernde Verbesserung der psychiatrischen Behandlung in Gang gesetzt. Auf dieses außerordentlich bedeutsame Ereignis in der Geschichte der Psychiatrie wird anschließend eingegangen. Der folgende Abschnitt zeigt die Bedeutung subjektiver Krankheitstheorien im Hinblick auf die Stigmatisierung auf und folgt dem Versuch, einige „typische“ Auffassungen über psychische Störungen darzustellen. In den abschließenden Passagen werden die schwerwiegenden Folgen der Stigmatisierung für Erkrankte in vier stigmatisierten und stigmatisierenden Bereichen beschrieben und diese Erkenntnisse in der Zwei-Faktoren-Theorie nach Rüsch et al. verortet. Bevor auf Grundlage des erarbeiteten Wissens ein Fazit zur Stigmatisierung psychisch Kranker gezogen wird, besteht das vorletzte Kapitel aus einer kritischen Reflexion der erarbeiteten Inhalte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erläuterung und Abgrenzung grundlegender Begriffe
- 2.1 Stigma
- 2.2 Stigmatisierung
- 2.3 Stereotyp
- 2.4 Vorurteil
- 3. Funktionen von Stigmata
- 4. Hypothesen zur Entstehung von Stigmata
- 5. Frühe Modelle des Stigmatisierungsprozesses
- 5.1 Das Stigma-Konzept nach Goffman
- 5.2 Der Labeling Approach
- 5.3 Der Etikettierungsansatz nach Scheff
- 5.4 Der modifizierte Etikettierungsansatz nach Link et al.
- 5.5 Das erweiterte Stigma-Konzept nach Link und Phelan
- 6. Annäherung an grundlegende Begriffe
- 6.1 Krankheit
- 6.2 Psychische Krankheit / Psychische Störung
- 6.3 Klassifikationssysteme psychischer Störungen
- 7. Die Psychiatrie-Enquête
- 7.1 Definition: Psychiatrie
- 7.2 Überblick über die Psychiatrie-Enquête
- 7.3 Entstehung und Entwicklung der Psychiatrie-Enquête
- 7.4 State of the Art
- 8. Zur Bedeutung subjektiver Krankheitstheorien
- 8.1 Historische Entwicklung öffentlicher Krankheitstheorien
- 8.2 Krankheitstheorien der Allgemeinbevölkerung
- 8.3 Ursachenvorstellungen von psychischen Erkrankungen
- 8.4 Behandlungsvorstellungen von psychischen Erkrankungen
- 9. Folgebereiche der Stigmatisierung
- 9.1 Interpersonelle Interaktion
- 9.2 Strukturelle Diskriminierung
- 9.3 Das Bild psychisch Erkrankter in der Öffentlichkeit
- 9.4 Zugang zu sozialen Rollen
- 10. Die Zwei-Faktoren-Theorie nach Rüsch et al.
- 10.1 Öffentliche Stigmatisierung
- 10.2 Selbststigmatisierung
- 11. Selbstkritische Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Stigmatisierung psychisch Kranker aus theoretischer Perspektive zu beleuchten. Es werden verschiedene Modelle und Ansätze zur Erklärung der Entstehung und Aufrechterhaltung von Stigmata vorgestellt und analysiert. Der Fokus liegt auf der Erörterung der gesellschaftlichen Auswirkungen und der individuellen Folgen der Stigmatisierung.
- Definition und Abgrenzung zentraler Begriffe wie Stigma, Stigmatisierung, Stereotyp und Vorurteil
- Analyse verschiedener theoretischer Modelle zur Erklärung der Stigmatisierung psychisch Kranker
- Untersuchung der Funktionen von Stigmata und ihrer Entstehungshypothesen
- Beschreibung der Folgen der Stigmatisierung auf interpersoneller und struktureller Ebene
- Die Rolle subjektiver Krankheitstheorien in Bezug auf psychische Erkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Stigmatisierung psychisch Kranker ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Forschungsfragen. Das Zitat von Albert Einstein verdeutlicht die anhaltende Herausforderung, Vorurteile zu überwinden.
2. Erläuterung und Abgrenzung grundlegender Begriffe: Dieses Kapitel definiert und differenziert die zentralen Begriffe Stigma, Stigmatisierung, Stereotyp und Vorurteil. Es werden die jeweiligen Bedeutungen erläutert und die Abgrenzungen zu verwandten Konzepten herausgearbeitet. Dies schafft die notwendige Grundlage für das Verständnis der weiteren Kapitel.
3. Funktionen von Stigmata: Dieses Kapitel befasst sich mit den Funktionen von Stigmata in sozialen Kontexten. Es analysiert, wie Stigmata soziale Ordnung aufrechterhalten und soziale Ungleichheit reproduzieren können. Dabei wird auf die verschiedenen Nutzen und Vorteile für die stigmatisierenden Gruppen eingegangen, sowie auf die Mechanismen der sozialen Kontrolle.
4. Hypothesen zur Entstehung von Stigmata: Hier werden verschiedene Hypothesen zur Entstehung von Stigmata präsentiert und diskutiert. Es wird untersucht, welche Faktoren zur Entwicklung und Perpetuierung von Stigmata beitragen, wie z.B. soziale Lernprozesse, Medienberichterstattung und gesellschaftliche Normen. Die Kapitel untersucht die Interaktion verschiedener Faktoren.
5. Frühe Modelle des Stigmatisierungsprozesses: Dieses Kapitel stellt verschiedene frühe Modelle des Stigmatisierungsprozesses vor, darunter das Stigma-Konzept nach Goffman, den Labeling Approach und den Etikettierungsansatz nach Scheff sowie Modifikationen und Erweiterungen. Die unterschiedlichen Perspektiven und ihre Stärken und Schwächen werden analysiert und verglichen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Verständnisses der Stigmatisierungsprozesse.
6. Annäherung an grundlegende Begriffe: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Krankheit im Allgemeinen und psychischer Erkrankung im Speziellen. Es werden verschiedene Klassifikationssysteme psychischer Störungen erläutert und ihre Bedeutung für die Diagnose und Behandlung diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Klärung der terminologischen Grundlagen.
7. Die Psychiatrie-Enquête: Das Kapitel gibt einen Überblick über die Psychiatrie-Enquête, ihre Entstehung, Entwicklung und den aktuellen Forschungsstand (State of the Art). Es wird die Bedeutung dieser Studie für das Verständnis der psychischen Gesundheit in der Bevölkerung hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der methodischen Vorgehensweise und den wichtigsten Ergebnissen.
8. Zur Bedeutung subjektiver Krankheitstheorien: Dieses Kapitel untersucht die Rolle subjektiver Krankheitstheorien in Bezug auf psychische Erkrankungen. Es wird die historische Entwicklung öffentlicher Krankheitstheorien, die Krankheitstheorien der Allgemeinbevölkerung sowie Ursachenvorstellungen und Behandlungsvorstellungen von psychischen Erkrankungen analysiert. Die Kapitel beleuchtet den Einfluss von Laienwissen auf die Stigmatisierung.
9. Folgebereiche der Stigmatisierung: Dieses Kapitel beschreibt die Folgen der Stigmatisierung psychisch Kranker auf verschiedenen Ebenen: interpersonelle Interaktion, strukturelle Diskriminierung, öffentliches Bild und Zugang zu sozialen Rollen. Es wird aufgezeigt, wie Stigmatisierung zu Benachteiligung und Ausgrenzung führt.
10. Die Zwei-Faktoren-Theorie nach Rüsch et al.: Das Kapitel stellt die Zwei-Faktoren-Theorie der Stigmatisierung vor, die öffentliche und Selbststigmatisierung unterscheidet. Die beiden Faktoren werden detailliert erläutert, und ihr Zusammenwirken wird analysiert. Es wird auf die Bedeutung der individuellen Wahrnehmung eingegangen.
Schlüsselwörter
Stigmatisierung, psychische Krankheit, Vorurteil, Stereotyp, Goffman, Labeling Approach, Psychiatrie-Enquête, Krankheitstheorien, soziale Diskriminierung, Selbststigmatisierung.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Stigmatisierung psychisch Kranker
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit dem Thema der Stigmatisierung psychisch Kranker. Er analysiert theoretische Modelle, die Entstehung und Aufrechterhaltung von Stigmata, sowie die gesellschaftlichen und individuellen Folgen.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in elf Kapitel. Diese behandeln die Definition und Abgrenzung zentraler Begriffe (Stigma, Stigmatisierung, Stereotyp, Vorurteil), Funktionen von Stigmata, Hypothesen zur Entstehung, frühe Modelle des Stigmatisierungsprozesses (Goffman, Labeling Approach etc.), grundlegende Begriffe wie Krankheit und psychische Erkrankung, die Psychiatrie-Enquête, subjektive Krankheitstheorien, Folgebereiche der Stigmatisierung, und die Zwei-Faktoren-Theorie nach Rüsch et al. Der Text schließt mit einer selbstkritischen Reflexion.
Welche zentralen Begriffe werden definiert und abgegrenzt?
Der Text definiert und differenziert die Schlüsselbegriffe Stigma, Stigmatisierung, Stereotyp und Vorurteil. Er erläutert deren jeweilige Bedeutung und Abgrenzung zueinander, um ein fundiertes Verständnis der Thematik zu schaffen.
Welche theoretischen Modelle zur Stigmatisierung werden vorgestellt?
Der Text präsentiert und analysiert verschiedene theoretische Modelle zur Erklärung der Stigmatisierung psychisch Kranker. Dies beinhaltet das Stigma-Konzept nach Goffman, den Labeling Approach, den Etikettierungsansatz nach Scheff, den modifizierten Etikettierungsansatz nach Link et al., das erweiterte Stigma-Konzept nach Link und Phelan und die Zwei-Faktoren-Theorie nach Rüsch et al.
Welche Funktionen von Stigmata werden beschrieben?
Der Text untersucht die Funktionen von Stigmata in sozialen Kontexten. Er analysiert, wie Stigmata soziale Ordnung aufrechterhalten und soziale Ungleichheit reproduzieren können, und betrachtet dabei die Vorteile für stigmatisierende Gruppen und Mechanismen der sozialen Kontrolle.
Welche Hypothesen zur Entstehung von Stigmata werden diskutiert?
Der Text diskutiert verschiedene Hypothesen zur Entstehung von Stigmata, wie z.B. soziale Lernprozesse, Medienberichterstattung und gesellschaftliche Normen, und analysiert die Interaktion verschiedener Faktoren.
Welche Rolle spielen subjektive Krankheitstheorien?
Der Text analysiert die Rolle subjektiver Krankheitstheorien in Bezug auf psychische Erkrankungen. Dies umfasst die historische Entwicklung öffentlicher Krankheitstheorien, Krankheitstheorien der Allgemeinbevölkerung, sowie Ursachenvorstellungen und Behandlungsvorstellungen von psychischen Erkrankungen.
Welche Folgen der Stigmatisierung werden beschrieben?
Der Text beschreibt die Folgen der Stigmatisierung auf verschiedenen Ebenen: interpersonelle Interaktion, strukturelle Diskriminierung, das öffentliche Bild psychisch Erkrankter und den Zugang zu sozialen Rollen.
Was ist die Zwei-Faktoren-Theorie nach Rüsch et al.?
Die Zwei-Faktoren-Theorie unterscheidet zwischen öffentlicher Stigmatisierung und Selbststigmatisierung. Der Text erläutert beide Faktoren detailliert und analysiert deren Zusammenwirken.
Welche Bedeutung hat die Psychiatrie-Enquête im Text?
Der Text gibt einen Überblick über die Psychiatrie-Enquête, ihre Entstehung, Entwicklung und den aktuellen Forschungsstand. Die Bedeutung dieser Studie für das Verständnis der psychischen Gesundheit in der Bevölkerung und ihre methodische Vorgehensweise werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter des Textes sind: Stigmatisierung, psychische Krankheit, Vorurteil, Stereotyp, Goffman, Labeling Approach, Psychiatrie-Enquête, Krankheitstheorien, soziale Diskriminierung, Selbststigmatisierung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Die Stigmatisierung psychisch Kranker, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539561