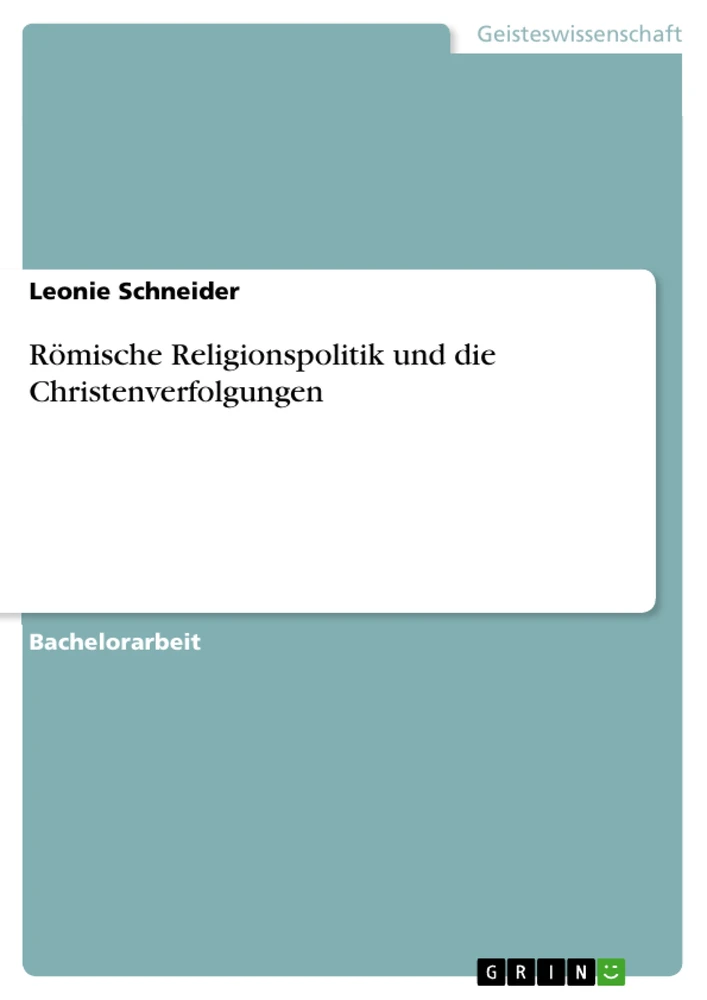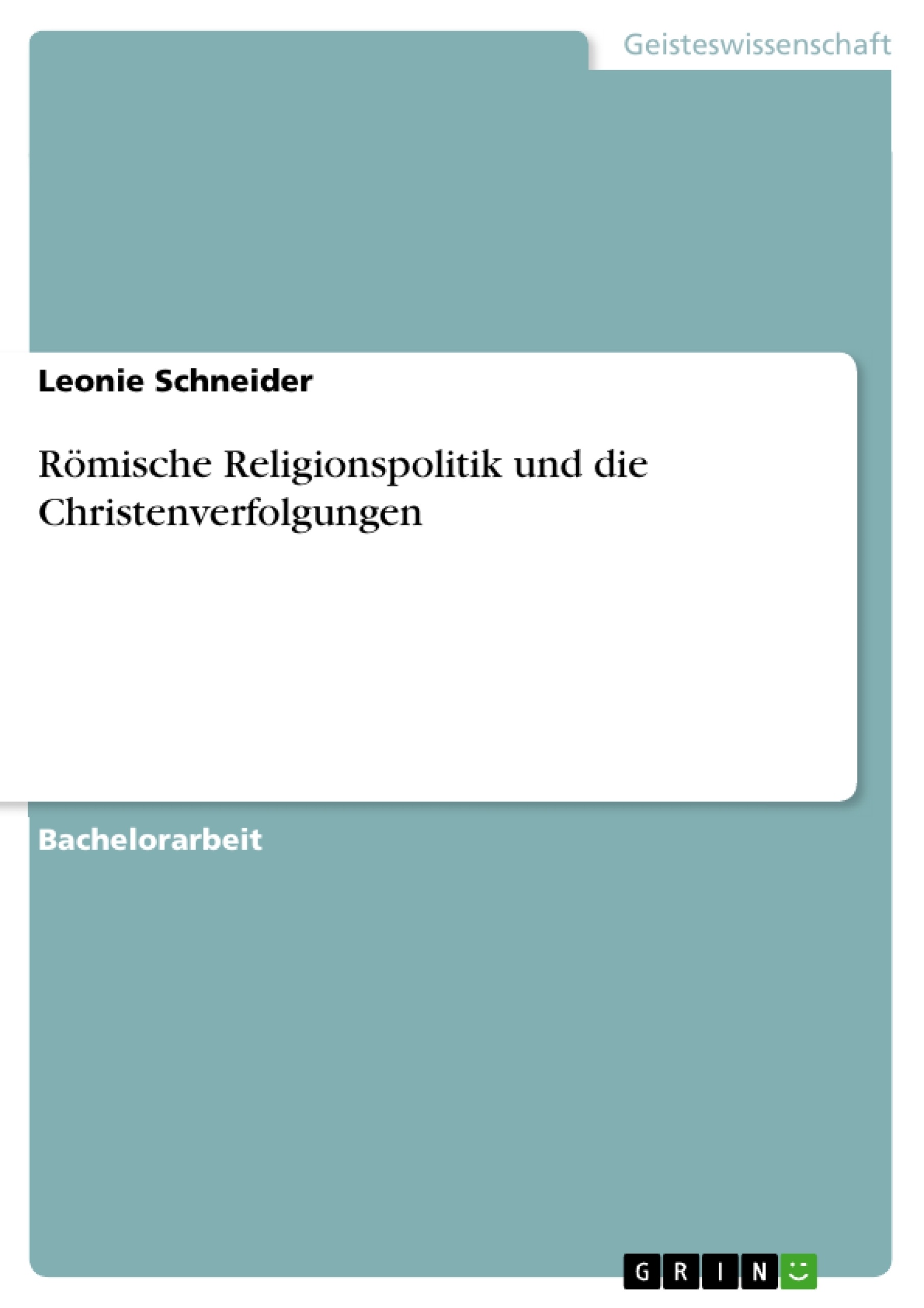Die Christenverfolgung im Imperium Romanum war kein linearer Prozess, der von allen Kaisern gleichermaßen verfolgt wurde. In dieser Arbeit wird eine Zeitspanne von knapp drei Jahrhunderten behandelt, in denen die Römer zunächst lokal und später reichsweit Christen verfolgten.
Grob lassen sich die Verfolgungen in drei Phasen unterteilen: Die erste Phase bildet die Frühzeit der Entstehung des Christentums (circa 30-100 nach Christus), in der es noch nicht als eine vom Judentum gesondert zu betrachtende Religion unterschieden wurde. Erst unter Kaiser Nero kam es im Jahr 64 zu einer gezielten Verfolgung und Hinrichtung der Christen. Die zweite Phase umfasst den Zeitraum von ca. 100-250, in dem das bloße Christsein zu einem rechtlichen Strafbestand erklärt wurde, es zwar noch keine aktive Verfolgung der Behörden gab, jedoch schon einzelne Pogrome und Prozesse gegen Christen aufkamen. In der dritten Phase (250-311) kam es durch ein Opferedikt zu ersten reichsweiten und gezielten Verfolgungen und Verurteilungen von Christen, welche erst unter dem Toleranzedikt von Kaiser Galerius ein Ende fanden.
Um die Beweggründe der Christenverfolgungen durch die Römer besser nachvollziehen zu können, werden in einem ersten Schritt die Grundsätze des römischen Kults beschrieben, um in einem weiteren Schritt darauf einzugehen, wie die Religionspolitik der Römer gegenüber anderen Religionen und Kulten vor dem Auftreten des Christentums vertreten war. Im Anschluss wird darauf eingegangen wie der populus Romanus im Allgemeinen zu der christlichen Minderheit stand, da sich gezeigt hat, dass die Einstellung der paganen Bevölkerung Einfluss auf die religionspolitischen Stimmungen im Imperium haben konnte. Die religionspolitischen Hintergründe der Christenverfolgungen werden dann in ihren jeweiligen Phasen untersucht, welche dabei meist mit der Regierung eines einzelnen Kaisers in Verbindung gebracht werden können.
Dabei wurde versucht, solange die Quellenlage dies erlaubt, sowohl die römische als auch die christliche Sicht auf die Geschehnisse zu berücksichtigen. In den Unterkapiteln zu den einzelnen Kaisern wird dargelegt, was die jeweiligen Motive, Rechtfertigungen und Rechtsgrundlagen der Christenverfolgungen waren und inwiefern sich diese von der sonstigen Religionspolitik der Römer unterschieden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der römische Kult
- 2.1 Kaiserkult
- 2.2 Römische Religionspolitik vor dem Aufkommen des Christentums
- 2.3 Die Wahrnehmung des Christentums vom populus Romanus
- III. Die Christenverfolgungen
- 3.1 Nero als Auslöser und Ursprung der Christenverfolgungen?
- 3.2 Das Trajanreskript als juristische Grundlage
- 3.3 Vereinzelte lokale Christenprozesse zwischen 117 und 249
- 3.4 Das Opferedikt des Decius
- 3.4.1 Exkurs: Die Befreiung der Juden vom Opferedikt
- 3.5 Valerians Vorgehen gegen die Christen: Erst Freund dann Feind?
- 3.6 Die große Verfolgung unter den Kaisern der Tetrarchie
- IV. Ausblick: Vom Toleranzedikt zur Staatsreligion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der römischen Religionspolitik und den Christenverfolgungen in der Zeit von ca. 30-311 n. Chr. Sie analysiert die verschiedenen Phasen der Verfolgungen und untersucht die Beweggründe der Römer für ihre Vorgehensweise gegen die Christen.
- Die Entwicklung des römischen Kults und seine Bedeutung für das Selbstverständnis des Imperiums
- Die Wahrnehmung des Christentums durch die römische Gesellschaft und die Rolle der öffentlichen Meinung
- Die juristischen Grundlagen und die verschiedenen Phasen der Christenverfolgungen
- Die Sonderstellung der Juden im Römischen Reich im Vergleich zu den Christen
- Die Ursachen und möglichen Beweggründe der römischen Religionspolitik gegenüber den Christen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung des Christentums und die Herausforderungen, denen die Alte Kirche begegnete. Es skizziert die drei Phasen der Christenverfolgungen im Römischen Reich. Das zweite Kapitel analysiert den römischen Kult, seine Bedeutung für das öffentliche und private Leben sowie die enge Verknüpfung von Religion und Politik. Es zeigt, dass die Römer ihren Erfolg der Götter zugeschrieben haben und Tradition und Brauchtum hochhielten. Im dritten Kapitel werden die Christenverfolgungen in ihren unterschiedlichen Phasen betrachtet. Dabei wird auf die Rolle von Nero, das Trajanreskript, das Opferedikt des Decius sowie die Verfolgungen unter Valerian und den Kaisern der Tetrarchie eingegangen. Es werden die Motive, Rechtfertigungen und Rechtsgrundlagen der Verfolgungen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Römische Religionspolitik, Christenverfolgungen, Kaiserkult, populus Romanus, Trajanreskript, Opferedikt, Toleranzedikt, Staatsreligion, pietas, religio, sacra publica, sacra privata, Judentum, Sonderstellung.
- Quote paper
- Leonie Schneider (Author), 2019, Römische Religionspolitik und die Christenverfolgungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539545