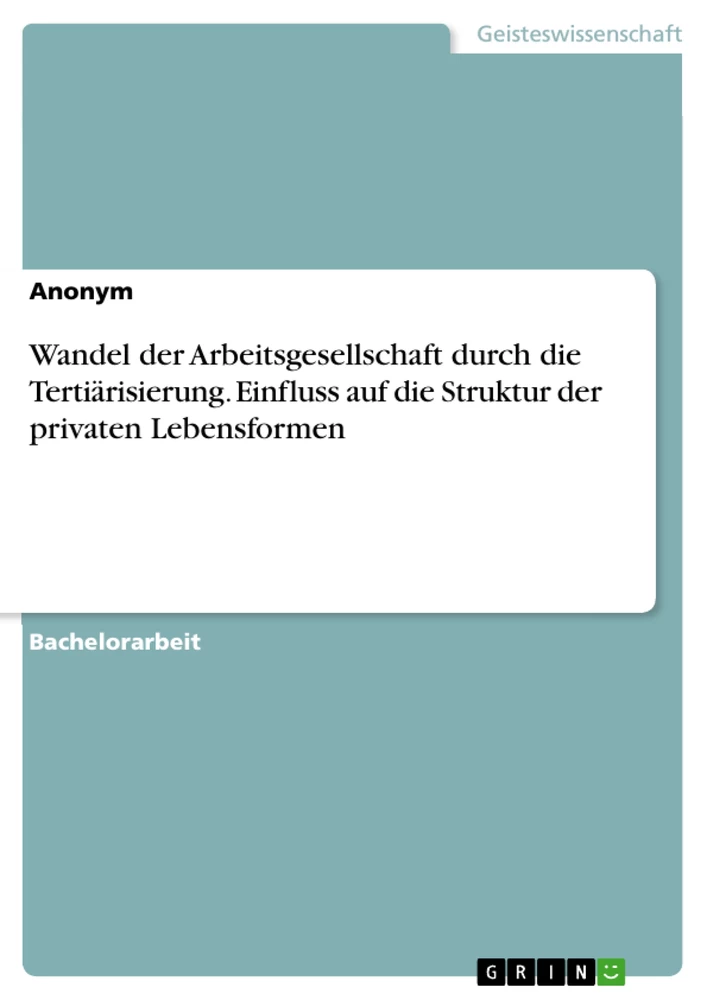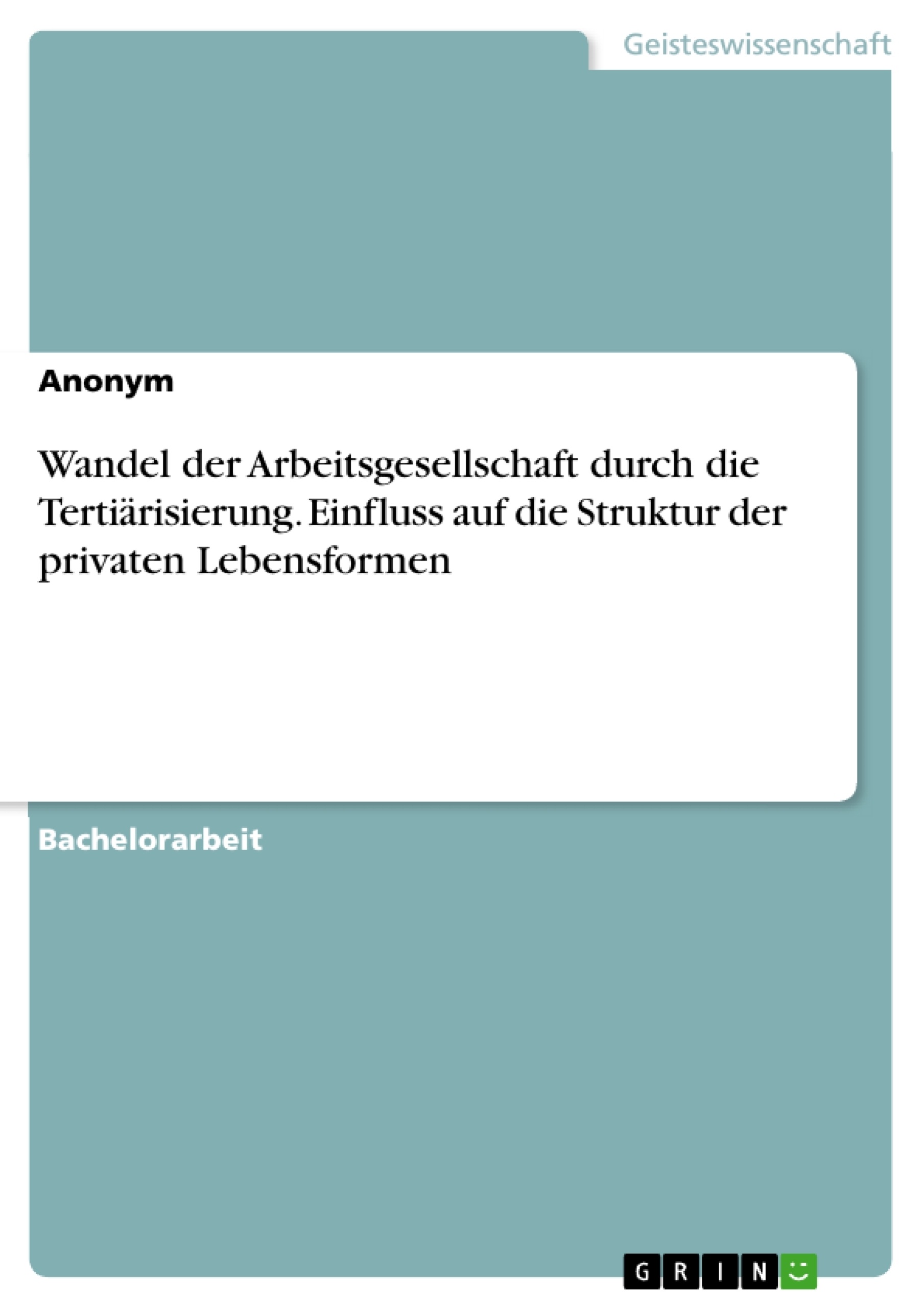Diese Arbeit beschäftigt sich mit folgender Fragestellung: Wie hat sich die Arbeitsgesellschaft im Zuge der Tertiärisierung, also dem Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, verändert und wie wirkte sich dieser Wandel auf die Struktur der privaten Lebensformen aus?
Das zweite Kapitel dieser Arbeit behandelt die Veränderungen in der Wirtschaft seit 1950. Dabei betrachtet es den Wandel der Sektoren, die Globalisierung sowie den Neoliberalismus und bezieht Erscheinungen mit ein, die den wirtschaftlichen Wandel begleiteten. In Kapitel 3 werden demographische Indikatoren und Trends beschrieben, die sich auf Familie und Lebensform auswirken. Anschließend werden die wichtigsten Lebensformen neben der Ehe mit Kindern aufgeführt. Der Einfluss wirtschaftlicher Veränderungen wird bei den demographischen Trends und der Beleuchtung der Lebensformen aufgedeckt.
Die Familie ist eine soziale Institution, die durch die kulturellen Bedingungen der jeweiligen Gesellschaft geformt wird. Häufig besteht sie aus Mutter, Vater und Kindern, die alle zusammen in einem Haushalt leben. Dieses konservative Verständnis einer Familie ist in der Gesellschaft weit verbreitet. Doch vor allem im Zuge des Wandels der deutschen Gesellschaft von der Induastrie- zur Dienstleistungsgesellschaft um circa 1970, entwickelten sich manche Formen des Zusammenlebens, die von diesem Verständnis abweichen. Dieser Wandel hat die Familie zweifelsohne verändert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wandel der Arbeitsgesellschaft
- 2.1 Sektorenwandel
- 2.1.1 Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft
- 2.1.2 Industriegesellschaft
- 2.1.2.1 Fordismus
- 2.1.2.2 Normalarbeitsverhältnis
- 2.1.3 Von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft
- 2.1.3.1 Dienstleistungen
- 2.1.3.2 Postfordismus
- 2.1.4 Tertiärisierungsrückstand der Deutschen Demokratischen Republik
- 2.1.5 Begleiterscheinungen der Dienstleistungsgesellschaft
- 2.1.5.1 Bildungsexpansion
- 2.1.5.2 Wertewandel
- 2.1.5.3 Erhöhte Erwerbsbeteiligung der Frau
- 2.2 Globalisierung
- 2.3 Neoliberalismus
- 2.3.1 Entstandardisierung
- 2.3.2 Prekarisierung
- 3. Lebensformen und Familie
- 3.1 Familiendemographische Indikatoren und Trends
- 3.1.1 Geburtenentwicklung
- 3.1.2 Kinderlosigkeit
- 3.1.3 Ehe
- 3.1.4 Scheidung
- 3.2 Konflikte innerhalb von Familien
- 3.3 Monopolverlust der Normalfamilie
- 3.4 Pluralisierung der Lebensformen
- 3.4.1 Nichteheliche Lebensgemeinschaften
- 3.4.2 Living-Apart-Together und Commuter-Beziehungen
- 3.4.3 Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften
- 3.4.4 Alleinerziehende
- 3.4.5 Alleinwohnende und Alleinlebende
- 3.4.6 Familien mit Migrationshintergrund
- 3.5 Erklärungsversuche
- 3.6 Relativierung der Pluralisierungsthese
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Arbeitsgesellschaft im Zuge der Tertiärisierung und dessen Auswirkungen auf die Struktur privater Lebensformen. Die Analyse betrachtet den Zeitraum seit etwa 1950.
- Wandel der Arbeitsgesellschaft durch Sektorenwandel (Agrar- zu Industrie- zu Dienstleistungsgesellschaft)
- Einfluss von Globalisierung und Neoliberalismus auf die Arbeitswelt
- Demographische Veränderungen und Trends im familiären Kontext
- Pluralisierung der Lebensformen und der Rückgang der traditionellen Kernfamilie
- Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Veränderungen und der Entwicklung von Lebensformen
Zusammenfassung der Kapitel
2. Wandel der Arbeitsgesellschaft: Dieses Kapitel analysiert die Transformation der deutschen Arbeitsgesellschaft seit 1950. Es unterteilt den Wandel in drei wesentliche Phasen: den Sektorenwandel (vom primären zum sekundären und schließlich zum tertiären Sektor), die Globalisierung und den Neoliberalismus. Die Analyse beleuchtet die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Arbeitsorganisation, die Arbeitsmärkte und die gesellschaftlichen Strukturen. Der Sektorenwandel wird im Detail anhand der Drei-Sektoren-Hypothese nach Fourastié erklärt, wobei die Verschiebung von der Agrar- über die Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft im Mittelpunkt steht. Die Globalisierung und der Neoliberalismus werden als wichtige treibende Kräfte des Wandels dargestellt, die zu Entstandardisierung und Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse geführt haben. Das Kapitel legt die Grundlagen für die spätere Analyse des Zusammenhangs zwischen diesen wirtschaftlichen Veränderungen und den sich verändernden privaten Lebensformen.
3. Lebensformen und Familie: Kapitel 3 befasst sich mit den demographischen Veränderungen und Trends, die die Familienstrukturen und Lebensformen in Deutschland beeinflussen. Es untersucht Indikatoren wie Geburtenentwicklung, Kinderlosigkeit, Ehe- und Scheidungsraten, um den Wandel von der traditionellen Kernfamilie hin zu einer Vielzahl unterschiedlicher Lebensformen aufzuzeigen. Neben der traditionellen Familie werden nichteheliche Lebensgemeinschaften, Living-Apart-Together Beziehungen, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Alleinerziehende und Alleinlebende als bedeutende Lebensmodelle beleuchtet. Der Einfluss wirtschaftlicher Veränderungen, wie sie in Kapitel 2 beschrieben wurden, auf diese demographischen Trends und die Entwicklung alternativer Lebensformen wird analysiert. Das Kapitel diskutiert die Gründe für die Pluralisierung der Lebensformen und relativiert gleichzeitig die These einer vollständigen Auflösung der traditionellen Familie.
Schlüsselwörter
Tertiärisierung, Arbeitsgesellschaft, Sektorenwandel, Globalisierung, Neoliberalismus, Lebensformen, Familie, Pluralisierung, Demographie, Industriegesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft, Prekarisierung, Entstandardisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Wandel der Arbeitsgesellschaft und seine Auswirkungen auf private Lebensformen
Was ist der Hauptfokus dieses Textes?
Der Text analysiert den Wandel der Arbeitsgesellschaft seit etwa 1950 und dessen Auswirkungen auf die Strukturen privater Lebensformen. Im Mittelpunkt stehen die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Veränderungen (Tertiärisierung, Globalisierung, Neoliberalismus) und der Pluralisierung von Lebensformen.
Welche Phasen des Wandels der Arbeitsgesellschaft werden beschrieben?
Der Text unterteilt den Wandel der Arbeitsgesellschaft in drei Phasen: den Sektorenwandel (von der Agrar- über die Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft), die Globalisierung und den Neoliberalismus. Diese Phasen werden im Detail erläutert und ihre Auswirkungen auf Arbeitsorganisation, Arbeitsmärkte und gesellschaftliche Strukturen analysiert.
Wie wird der Sektorenwandel im Detail erklärt?
Der Sektorenwandel wird anhand der Drei-Sektoren-Hypothese nach Fourastié erklärt, die die Verschiebung von der Agrar- über die Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft beschreibt. Der Text beleuchtet den Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft, die Charakteristika der Industriegesellschaft (einschließlich Fordismus und Normalarbeitsverhältnis), und den Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft (mit Postfordismus). Auch der Tertiärisierungsrückstand der DDR wird thematisiert.
Welche Rolle spielen Globalisierung und Neoliberalismus?
Globalisierung und Neoliberalismus werden als wichtige treibende Kräfte des Wandels in der Arbeitsgesellschaft dargestellt. Sie haben zu einer Entstandardisierung und Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse geführt.
Welche demographischen Veränderungen und Trends werden im familiären Kontext betrachtet?
Der Text analysiert demographische Indikatoren wie Geburtenentwicklung, Kinderlosigkeit, Ehe- und Scheidungsraten, um den Wandel der Familienstrukturen aufzuzeigen. Es wird der Rückgang der traditionellen Kernfamilie und der Aufstieg verschiedener alternativer Lebensformen beschrieben.
Welche verschiedenen Lebensformen werden behandelt?
Der Text beleuchtet neben der traditionellen Familie auch nichteheliche Lebensgemeinschaften, Living-Apart-Together Beziehungen, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Alleinerziehende, Alleinlebende und Familien mit Migrationshintergrund.
Wie wird der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Veränderungen und der Entwicklung von Lebensformen hergestellt?
Der Text analysiert den Zusammenhang zwischen den in Kapitel 2 beschriebenen wirtschaftlichen Veränderungen (Sektorenwandel, Globalisierung, Neoliberalismus) und den in Kapitel 3 beschriebenen demographischen Trends und der Entwicklung alternativer Lebensformen. Es wird untersucht, wie wirtschaftliche Faktoren die Pluralisierung der Lebensformen beeinflusst haben.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Text?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass die wirtschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Familienstrukturen und Lebensformen hatten, was zu einer Pluralisierung der Lebensformen geführt hat. Gleichzeitig wird die These einer vollständigen Auflösung der traditionellen Familie relativiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig für das Verständnis des Textes?
Schlüsselbegriffe sind: Tertiärisierung, Arbeitsgesellschaft, Sektorenwandel, Globalisierung, Neoliberalismus, Lebensformen, Familie, Pluralisierung, Demographie, Industriegesellschaft, Dienstleistungsgesellschaft, Prekarisierung, Entstandardisierung.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Wandel der Arbeitsgesellschaft durch die Tertiärisierung. Einfluss auf die Struktur der privaten Lebensformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/539040