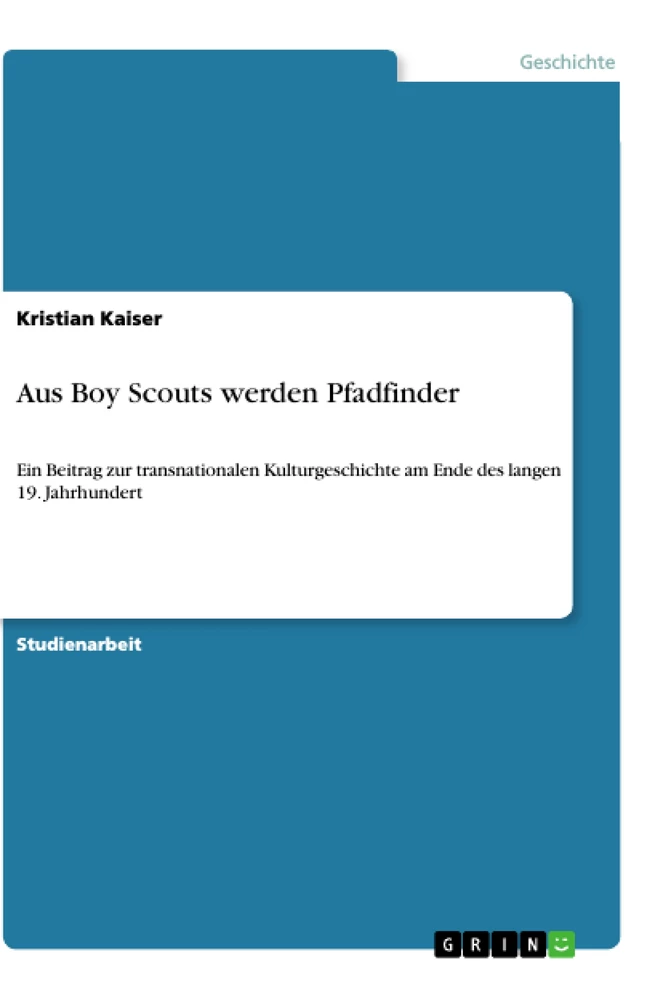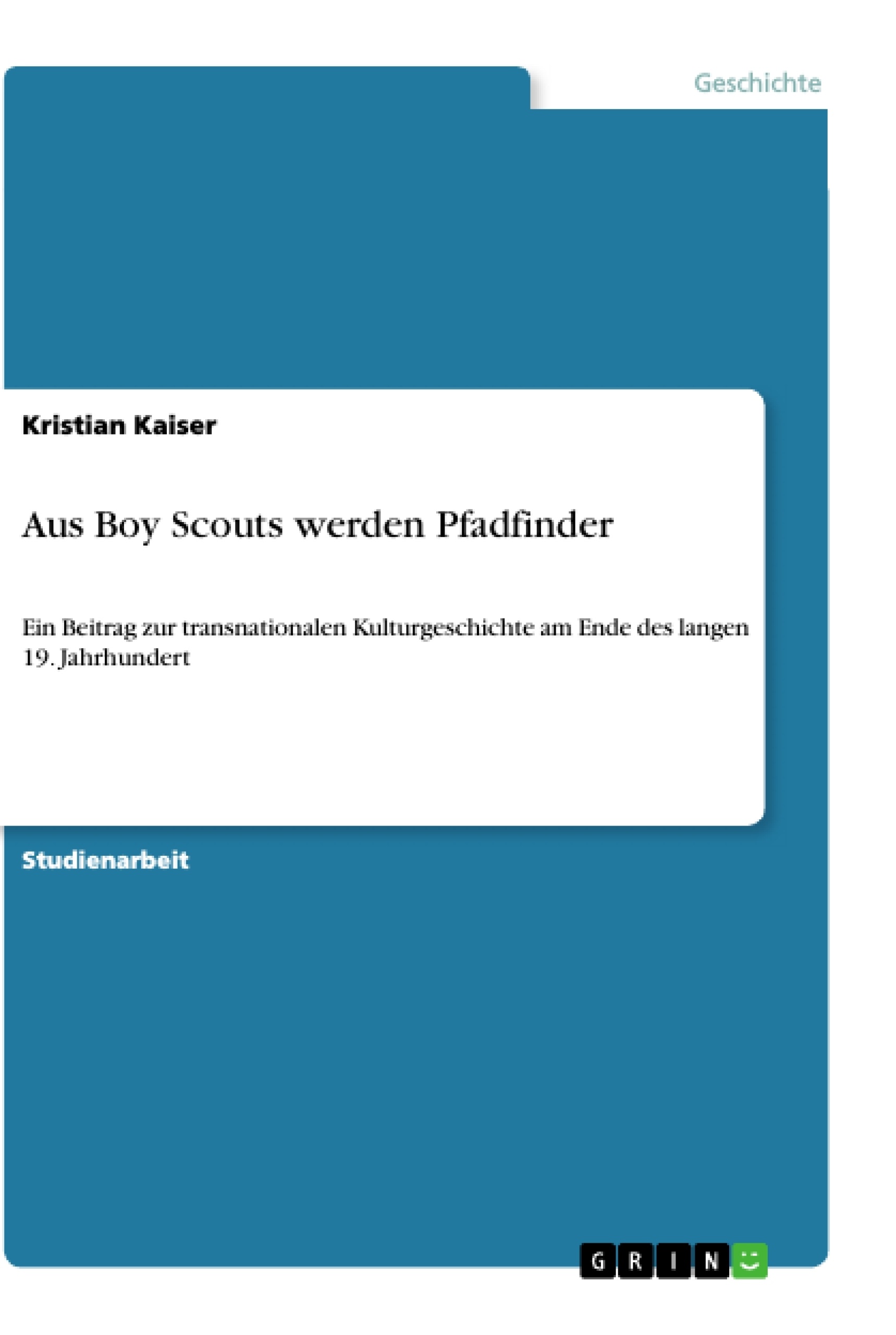Im Jahre 1938 blickt Winston S. Churchill in einer Art Ahnengalerie des späten 19. Jahrhunderts mit dem Titel Great Contemporaries auf prägende Akteure dieser Zeit zurück und schildert ihr Vermächtnis: In die Reihe der ihm persönlich bekannten berühmtesten Generale rückt er den Gründer des boy scout movements, Robert Baden-Powell, B.P. genannt.
Aus britischer Perspektive schildert er die Stationen, die zur Gründung dieser Bewegung im Jahr 1908 führten: Baden-Powells Militärdienst im Empire und sein Kommando bei der Belagerung von Mafeking (1899-1900) im Zweiten Burenkrieg, was zu seinem Status eines „outstanding hero of war“ führt, den die Massen in ihm erblickten. Doch Churchill erkennt, dass das boy scout movement auch im Deutschen Reich vor dem Großen Krieg imitiert worden sei und auch dort „little troops [of boy scouts] began to march along the roads al-ready trampled by the legions“. Und tatsächlich war am 18. Januar 1911 der Deutsche Pfadfinderbund gegründet worden und das nicht zufällig auf den Tag genau 40 Jahre nach der Proklamation des Deutschen Reiches. Es war auch in keiner Weise ein Zufall, dass am gleichen Tag das Preußische Kultusministerium die „Vaterländische Jugendpflege“ per Erlass geregelt hatte.
Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, unter welchen Bedingungen das Boy Scout movement entstand und sich verbreitete, wie daraus im Deutschen Reich das Konzept Pfadfinder wurde und mit welcher Intention dabei spezifische Anpassungen vorgenommen worden sind.
Diese Arbeit stützt sich dabei auf das durch den US-amerikanischen Historiker Charles S. Maier vorgestellte Konzept von Territorialität, in dem er die Räume für einen Staat als „decision space“ kennzeichnet, den die politischen Machthaber durch ihre Entscheidungen zu kontrollieren glauben, und den „indentity space“, als öffentliche Arenen, über die Loyalität und Identität hergestellt wurde.
Hier geht es nun um die grenzüberschreitende Verflechtungsgeschichte des kulturellen Konzepts Boy Scout und dessen Adaption als Pfadfinderbewegung im Deutschen Reich in der Zeit zwischen 1900 und 1914. Damit soll „eine verfremdete Perspektive […] auf vermeintlich wohlbekannte Phänomene eröffnet“ werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Aus scouts werden boy scouts
2.1. Im decision space des Imperium Britannicum
2.2. Aids to Scouting - Entstehung und Inhalt eines militärischen Konzeptes
2.3. Die Belagerung von Mafeking als formativer Mythos
2.4. Scouting for boys - ein pädagogisches Konzept zur Stärkung des Empire
3. Aus Boy Scouts werden Pfadfinder
3.1. Entdeckung, Entdecker und Propagandisten einer Idee
3.2. Koloniales Handeln und Publizieren
3.3. Nationalistische Kritik und ideologische Flexibilität
4. Fazit
Quellen- und Literaturverzeichnis
A Quellen
B Literatur
1. Einleitung
Im Jahre 1938 blickt Winston S. Churchill in einer Art Ahnengalerie des späten 19. Jahrhunderts mit dem Titel Great Contemporaries auf prägende Akteure dieser Zeit zurück und schildert ihr Vermächtnis: In die Reihe der ihm persönlich bekannten berühmtesten Generale rückt er den Gründer des boy scout movements, Robert Baden-Powell, B.P. genannt.1 Aus britischer Perspektive schildert er die Stationen, die zur Gründung dieser Bewegung im Jahr 1908 führten: Baden-Powells Militärdienst im Empire und sein Kommando bei der Belagerung von Mafeking (1899-1900) im Zweiten Burenkrieg, was zu seinem Status eines „ outstanding hero of war “ führt, den die Massen in ihm erblickten. Doch Churchill erkennt, dass das boy scout movement auch im Deutschen Reich vor dem Großen Krieg imitiert worden sei und auch dort „ little troops [of boy scouts] began to march along the roads already trampled by the legions “.2 Und tatsächlich war am 18. Januar 1911 der Deutsche Pfadfinderbund gegründet worden und das nicht zufällig auf den Tag genau 40 Jahre nach der Proklamation des Deutschen Reiches.3 Es war auch in keiner Weise ein Zufall, dass am gleichen Tag das Preußische Kultusministerium die „Vaterländische Jugendpflege“ per Erlass geregelt hatte.4
Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, unter welchen Bedingungen das Boy Scout movement entstand und sich verbreitete, wie daraus im Deutschen Reich das Konzept Pfadfinder wurde und mit welcher Intention dabei spezifische Anpassungen vorgenommen worden sind. Der Quellen- und Litertaturbestand ist umfangreich und im Rahmen dieser Arbeit nicht erschöpfend auszuwerten. Die Geschichte der boy scouts und der Pfadfinder sind aus jeweils nationaler Perspektive umfangreich geschildert worden; insbesondere für den Bereich der Pfadfinderbewegung kann sich diese Arbeit auf umfangreiche Vorarbeiten des Pädagogen Christoph Schubert-Weller stützen.5 In neuerer Zeit sind im Rahmen des einhundertjährigen Bestehens der Weltpfadfinderbewegung 2007 im Umfeld des Archivs der deutschen Jugendbewegung zwei Tagungssammelbände unter der Herausgeberschaft von Eckart Conze und Matthias D. Witte erschienen.6 Diese Arbeiten thematisieren jeweils unterschiedliche Aspekte des Boy Scout movement und der Pfadfinderbewegung, diskutieren aber häufig entweder konzeptionelle Fragestellungen in der Entwicklung der Pädagogik oder lassen zwei entscheidende historische Rahmenbedingungen in der Entstehung erstaunlich unberücksichtigt: den Imperialismus und die Entstehung im kolonialen Kontext.7 Diese Lücke zu schließen, soll die vorliegende Arbeit ein Beitrag sein. Sie stützt sich dabei auf das durch den US-amerikanischen Historiker Charles S. Maier vorgestellte Konzept von Territorialität, in dem er die Räume für einen Staat als „ decision space “ kennzeichnet, den die politischen Machthaber durch ihre Entscheidungen zu kontrollieren glauben, und den „ indentity space “, als öffentliche Arenen, über die Loyalität und Identität hergestellt wurde.8
Hier geht es nun um die grenzüberschreitende Verflechtungsgeschichte des kulturellen Konzepts Boy Scout und dessen Adaption als Pfadfinderbewegung im Deutschen Reich in der Zeit zwischen 1900 und 1914. Damit soll „eine verfremdete Perspektive [...] auf vermeintlich wohlbekannte Phänomene eröffnet“ werden.9
2. Aus scouts werden boy scouts
2.1. Im decision space des Imperium Britannicum
Das 19. Jahrhundert wird aus mancher nationalstaatlicher Perspektive als das „Jahrhundert des Nationalstaats“ aufgefasst, was beispielsweise für die Entstehung des modernen deutschen Nationalstaats mit einiger Berechtigung vertreten werden kann. Betrachtet man die Welt der staatlichen Ordnung um 1900 jedoch aus einer globalgeschichtlichen Perspektive, wird deutlich, dass sich neben den Imperien alten Stils (z.B. Russisches Reich) der Typ des „imperialen Nationalstaats“ etabliert hatte, also eines Imperiums mit einem modernen Nationalstaat als Zentrum.10 Das British Empire zählt zu letzterem und bildet gewissermaßen den Prototypen. Seit den 1760er Jahren dachte die britische Elite in globalen Maßstäben und die Vision eines zusammenhängenden Reiches entstand, das Empire, dessen Entstehung vielfach auch mit militärischer Gewalt vorangetrieben worden war.11 So erlebte die britische Kolonie Indien in den Jahren 1857/58 eine Erhebung der lokalen Bevölkerung, die als Great Mutiny in die (britische) Geschichtsschreibung einging.12 Neben Indien als mentaler Ankerpunkt imperialen Denkens bildete sich im Gefolge der sogenannten Berliner Westafrikakonferenz 1885 der afrikanische Kontinent als imperialer Expansionsraum für die europäischen Mächte heraus; zwischen Mitte der 1880er Jahre und 1900 vollzog sich das, was die Times im September 1884 als scramble for Africa, als Gerangel um Afrika, bezeichnete.13 Der Zweite Burenkrieg (1899-1902) sollte die Aufteilung Afrikas im Wesentlichen beenden.14
In diesem Kontext vollzieht sich der erste Teil der Biographie des späteren Gründers der Weltpfadfinderbewegung, Robert Stephenson Smyth Baden Powells; Baden-Powell wurde am 22. Februar 1857 in London als Bürgerlicher geboren.15 Um einen sozialen Aufstieg zu erreichen, plante seine Mutter Henrietta, dass Baden-Powell nach einer Universitätsausbildung in Oxford in die Armee eintreten solle.16 Dies verweist bereits auf die Funktion des Imperialismus als identity space in der britischen Gesellschaft: Das Empire wurde als Arena des eigenen gesellschaftlichen Aufstiegs verstanden, in dem das Militär die zentrale Rolle zur Durchsetzung politischer Ziele in den decision spaces darstellte. In den Worten Oster- hammels: „Das Empire eröffnete Optionen.“17 1876 scheiterte seine Aufnahme an die Universität Oxford; nach sehr erfolgreichen Militärprüfungen erfolgt seine Aufnahme in die Armee und er wurde ohne weitere militärische Ausbildung nach Indien versetzt.18
Baden-Powells Militärzeit ist Rahmen dieser Arbeit nur so weit von Belang, als dass gezeigt werden sollte, dass sich sein militärischer Aufstieg sowohl in den decision als auch den identity spaces des British Empires in der Zeit des Hochimperialismus vollzog.19 Hatten die Staatsmänner das Denken im Weltmaßstab erlernt (und ich füge hinzu: das Agieren), so galt das sicherlich in gleicher Weise für die Offiziere, die deren Denken vorformten, deren Entscheidungen vorbereiteten und am Ende ausfochten.20
2.2. Aids to Scouting - Entstehung und Inhalt eines militärischen Konzeptes
Baden-Powell gab im Jahr 1899 ein militärwissenschaftliches Werk heraus, das seine u.a. in Indien erworbenen Erfahrungen im Kundschafterwesen wiedergab.21 Das Buch selbst war als militärisches Manual gedacht, das praktische Fähigkeiten des Kundschafterwesens vermittelte, denn die Wichtigkeit des Scouting und der Aufklärung könne für eine Armee nicht überschätzt werden. Dies sei für nahezu jede Schlacht der Weltgeschichte entscheidend ge- wesen.22 Ein Scout sei daher „a special man [...] trainedfor one class of work only, and that is reconnaissance.”23 Er führt weiter aus, dass ein scout nicht nur im Kampf gegen zivilisierte Gegner nützlich sein müsse, sondern auch im Kampf gegen Afghanen in ihren Bergen, die Zulu in den südafrikanischen Ebenen, die Burmesen in ihren Festungen und auch die Sudanesen in der ägyptischen Wüste.24 Diese Aufzählung zeigt deutlich den Vorstellungsraum imperialen Handelns Baden-Powells und auch den seiner Leser, der sich durch Baden- Powells Einsatz als Offizier in den decision spaces des British Empires erklärt.
Es ist auch seine Zeit als Kolonialoffizier in Indien, auf die sich Churchill in der eingangs erwähnten Quelle als Zeitpunkt ihres Kennenlernens bezieht. Baden-Powell sei ihm als der Mann vorgestellt worden, der den Kadir-Cup, einen von zwei Wettbewerben im berittenen Speerstechen, gewonnen habe.25
2.3. Die Belagerung von Mafeking als formativer Mythos
Ab den 1870er Jahren erzeugten Diamantenfunde die erste Phase einer durch Bodenschätze induzierten ökonomischen Dynamik in Südafrika.26 Im Jahr 1881 stellte die Regierung Gladstone eine eingeschränkte Souveränität des Transvaal-Territoriums wieder her, nachdem die Briten 1877 das afrikanische Pedi-Reich und das bis dahin unabhängige Zulu-Reich niedergeworfen hatten. Ein Entschluss, der sich im Lichte kurz darauf eintretender Ereignisse als ungünstig herausstellen sollte, erklärte doch das Deutsche Reich 1884 die Südwestküste Afrikas zum deutschen „Schutzgebiet“ und wurden erhebliche Goldfunde am Witwatersrand gemacht, die die zweite Phase ökonomischer Dynamik einleiten sollten.27 Die Briten erkannten in einer möglichen Ostexpansion der deutschen Kolonie und dem Anschluss an die deutschfreundliche Burenrepublik einen kolonialen cauchemar des coalitions südafrikanischer Spielart, weil sie so an jeder weiteren Expansion in den Norden von Südafrika aus gehindert worden wären.28 Dies und die ökonomischen Gegensätze zwischen der Regierung der Republik Transvaal und den mit der englischen Oberschicht verwobenen Bergwerksunternehmen sorgte für politische Spannungen, die letztlich 1899 in den Zweiten Burenkrieg mündeten.29
Am 13. Oktober 1899 begann in den ersten Tagen des Burenkrieges die Belagerung des kleines Städtchens Mafeking, eines nördlichen Vorpostens des südafrikanischen Territoriums. Mafeking zählte zu dieser Zeit 6.700 Einwohner.30 Sie dauerte 217 Tage und endete am 17. Mai 1900.31 Das Kommando über die sie verteidigenden Truppen führte Baden-Powell.
Obwohl Baden-Powell die militärische Bedeutung der Verteidigung Mafekings selbst später als „unbedeutend“ eingeschätzt hatte, entfaltete sie doch in mindestens dreifacher Hinsicht eine nachhaltige Wirkung: Erstens konstituierte sie Baden-Powells Status eines Kriegshelden, zweitens führte siezu einer publizistischen Verbreitung seines Werkes Aids to scouting und drittens zeigte sie Baden-Powell die militärische Nützlichkeit organisierter Trupps Ju- gendlicher.32
Churchill erinnert sich in seinem Bericht, dass für die Millionen Untertanen des British Empires die Belagerung von Mafeking der entscheidende Indikator dafür war, wie es um den Burenkrieg stand, da sie sicherlich nicht in der Lage gewesen wären, die Fährnisse des Krieges angemessen beurteilen zu können.33 Er berichtet, dass die Nachricht vom Entsatz Mafe- kings eine größere Freude in den Straßen Londons auslöste als die Nachricht vom Waffenstillstand am Ende des Großen Krieges. Dass das Ereignis eine Signifikanz für sich beanspruchen kann, sieht an man zwei weiteren Belegen: In die englische Sprache ist das Verb to maffick eingegangen, das „ to celebrate with boisterous rejoicing and hilarious behavior “ bedeutet und etymologisch aus einer Veränderung des Wortes „Mafeking“ stammt.34 Die Times vom 21. Mai 1900 berichtet von „Imperial Rejoicings“ in allen Teilen des Empires.35 Die Belagerung von Mafeking machte Baden-Powell als Kriegshelden populär und im Urteil seines Biographen Tim Jeal zu einem der berühmtesten Männer des Empires.36
Nach dem Ende der Belagerung Mafekings, aber noch bevor der Burenkrieg beendet worden war, veröffentlichte der britische Publizist Howard Spicer mit der Einwilligung Baden- Powells in seinem Jungenmagazin Boys of the Empire ab dem 3. November 1900 unter dem Titel „The Boy Scout“ Baden-Powells Werk Aids to scouting als Seriendruck. Spencer wird von allen Herausgebern von Jungenzeitungen als “arguably the most jingoistic “ beschrie- ben.37 Er war der Gründer der Boys‘ Empire League, die unter der Präsidentschaft von Arthur Conan Doyle während des Burenkrieges über 10.000 Mitglieder hatte und Vorträge, Gesprächskreise und Vorlesungen mit imperialer Themensetzung anbot.38
Während der Belagerung Mafekings formierte sich unter der Anleitung von Baden-Powells Stabschef, Lord Edward Cecil, das Mafeking Cadet Corps. Es bestand aus den (weißen) Jungen der Stadt, die älter als neun Jahre waren, und trug durch die Verteidigung der Stadt unterstützende Tätigkeiten zum Erfolg der Verteidigung bei. Sie erhielten ein militärisches Training und übernahmen dann Boten- und Wachdienste, unterhielten den Postdienst zwischen den verschiedenen Forts und entlasteten so die mit der Waffe kämpfenden Männer.39 Das Mafeking Cadet Corps wurde später zum ersten Boy Scout Troop mythologisiert.
Mindestens diese drei Punkte führten dazu, was in dieser Arbeit als formativer Mythos „Mafeking“ bezeichnet wird. Der Erfolg Baden-Powells leuchtete vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Burenkrieg als solcher von den sonst vergleichsweise schnell gewonnen Kolonialkriegen so drastisch abwich, umso heller. Er führte dazu, dass der Vorstellungsraum der Nation als imaginierte Gemeinschaft umso entscheidender für das identity space wurde. So erklärt sich die breite imperiale Publizistik und die Nützlichkeit Baden-Powells als reale Figur; er wurde das Bindeglied zwischen dem decision space im peripheren Südafrika und dem identity space im imperialen Nationalstaat. Dass Mafeking als Mythos sowohl für das Boy Scout Movement im British Empire als auch für die Pfadfinderbewegung im Deutschen Reich formativ werden sollten, wird im Weiteren zu zeigen sein.
2.4. Scouting for boys - ein pädagogisches Konzept zur Stärkung des Empire
Nach dem für die Briten letztlich siegreichen Ende des Burenkrieges im Jahr 1903 kehrte Baden-Powell als Kriegsheld nach England zurück und wurde zum Generalinspekteur der Kavallerie der Britischen Armee befördert. Er wurde Ehrenvizepräsident einer religiösen Jugendvereinigung namens Boys‘ Brigade, deren Inhalt eine explizite Anlehnung an die anglikanische Kirche, Bibelkunde und militärischer Drill waren. Baden-Powell erkannte, dass dies auf Jungen eine begrenzte Anziehungskraft entfaltete.40 In den Reihen der Boys‘ Brigade war Baden-Powells Aids to scouting bereits weit verbreitet und so regte der Gründer der Brigade, William Smith, an, das Werk an die Erfordernisse für Jungen anzupassen. Nach einem Erprobungslager auf der Themse-Insel Brownsea Island im Jahr 1907 veröffentliche Baden- Powell am 15. Januar 1908 sein Werk Scouting for Boys. Dem Buch war ein hoher Verkaufserfolg beschieden und schon wenig später entstand eine Vielzahl von Scout Troops in Groß- britannien.41
Das Buch selbst trägt den Titel „Scouting for Boys - a handbook for instruction in good citizenship”. Es entfaltet ein Erziehungsprogramm, das darauf abzielt, die individuellen Fähigkeiten des einzelnen Jungen in die Dienste des Empires zu stellen. Baden-Powell greift dabei auf seinen Status als Kriegsheld zurück: Er entwirft das Programm der Boy Scouts am Beispiel der Nützlichkeit des Mafeking Cadet Corps und knüpft so an den weiter verbreiteten formativen Mythos Mafeking an. Er setzt dabei die belagerte Stadt Mafeking mit Britannien gleich:
„[...] we ought to be prepared in Britain against being attacked by enemies; for though it may not be probable, it is quite as possible as it was in Mafeking, and every boy in Britain should be just as ready as those boys were in Mafeking to take their share inits defence.”42
Es kann sicher gesagt werden, dass es nicht Baden-Powells Absicht war, aus den Boy Scouts eine direkte militärische Formation zu machen, aber der militärische Charakter des Werkes ist ebenso unübersehbar: Die Organisation der Boy Scouts in kleinen Truppen folgt militärischen Vorbildern, der zentrale Begriff des Zusammenhaltes ist die „Ehre“ des einzelnen Boy Scouts; das oberste Prinzip ist der Gehorsam gegen die Vorgesetzten, es gibt ein Gelöbnis.43
Das Kapitel 9 widmet sich dem Patriotismus. Nach einer räumlichen Beschreibung der ungeheuren Ausmaße wird es als Ergebnis „by hard work and the hard fighting of our fore- fathers“ beschrieben.44 Dass das Empire weiter bestünde, sei keinesfalls ausgemacht, wie die Geschichte des Römischen Imperiums zeige. Man müsse bereit sein, England zu verteidigen, und dass „an invader would only find himself ramming his head against bayonets and well- aimed bullets, if he tried landing on our shores.”45 Nachfolgend wird als Grund für das Scheitern des Römischen Imperiums und eigentlich aller weiteren Imperien der Weltgeschichte angegeben, dass ein Mangel an imperialem Bewusstsein und der Mangel an bürgerschaftli- cher Hingabe der Einwohner des jeweiligen Imperiums zu seinem Untergang geführt hät- ten.46 Dies gelte es zu verhindern und der Schlüssel dazu sei die Erziehung der Jugend.47 Rosenthal fasst die Besorgnis hinter diesem pädagogischen Ansatz mit einem von Baden- Powell häufig verwendeten Zitat zusammen, das auf David Lloydt George zurück geht: „You cannot maintain anA-1 Empire on C-3 men.“48
Baden-Powell wendet sich selbst gegen den Vorwurf, die Jugend militarisieren zu wollen. Er schreibt, dass es darum ginge, Peace-Scouting zu betreiben. Es sei sein Anliegen, gute Staatsbürger zu erziehen und die Mannhaftigkeit der nachwachsenden Generation für das Empire nutzbar zu machen.49
3. Aus Boy Scouts werden Pfadfinder
3.1. Entdeckung, Entdecker und Propagandisten einer Idee
Churchill bemerkte bereits, dass Baden-Powells Boy Scouts vor dem Ersten Weltkrieg im Deutschen Reich imitiert worden wären.50 Inwieweit dies zutrifft, wird im Folgenden erörtert werden. Am 17. März 1908 veröffentlichte die Times einen Artikel unter dem Titel „Scouting as a sport“, in dem der Autor die Erziehungsidee Baden-Powells mit den Erfordernissen des Lebens in den Kolonien vergleicht und das positive Fazit zieht, dass Hygiene, Sport und das Wissen um die richtige Ernährung den Männern des Empires beispielsweise im Burenkrieg viel Leid erspart hätte.51 Diesen Artikel liest nun am Bahnhof von Darmstadt der bayrische Stabsarzt Dr. Alexander Lion.52
Lion nimmt im gleichen Jahr Kontakt zu Baden-Powell auf und besucht ihn in London, wird von ihm in das Boy Scout Movement aufgenommen und erhält die Erlaubnis, Scouting for Boys ins Deutsche zu übertragen.53
So erscheint auch unter der Herausgeberschaft von Alexander Lion im Jahr 1909 „Das Pfadfinderbuch - Nach General Baden-Powells Scouting for Boys.“54 Als Motivation nennt er im Vorwort auch die Sorge um die körperliche Entwicklung junger Männer im Gefolge von Urbanisierung und Industrialisierung. Er stellt das gesunde Landleben dem ungesunden Leben in der Stadt gegenüber mit den Gefahren, die von Wirtshaus, Alkohol, Tabak und Frauen herrührten.55 Diese Sorge habe auch Baden-Powell nach der Belagerung von Mafeking um- getrieben,als er in der Heimat dann „den Unterschied zwischen diesen frischen, tatkräftigen, in freier Luft aufgewachsenen Jungen und den saft-und kraftlosen Gestalten auf den Strassen [sic!] der Grosstadt [sic!]“ erkannte.56 Lion verweist auch darauf, dasses nicht darum ginge, „Kriegsspäher“ heranzuziehen, sondern „Friedens-Scouts“. Die körperliche Ertüchtigung habe aber letztlich ein moralisches Ziel, nämlich das der Hilfsbereitschaft.57 Lion zitiert einen Brief Baden-Powells, in dem dieser seiner Hoffnung Ausdruck verleiht, dass England und Deutschland näher zueinander rückten durch die Boy Scouts und deren Ausdehnung nach Deutschland. Es handele sich um „Brudervölker“ und er hoffe, dass so eine „wahrhafte Entende cordiale “ entstünde.58
Direkt im ersten Kapitel kommt Lion erneut auf den formativen Mythos Mafeking zu sprechen und verweist auf die Nützlichkeit des Mafeking Cadet Corps bei der Verteidigung der Stadt, auf dass „jeder deutsche Knabe stets bereit [sei], so dem Vaterlande zu nützen, wie es die tapferen Jungens von Mafeking taten.“59 Kapitel IX macht deutlich, wofür die moralischen Eigenschaften, körperlichen und technischen Fähigkeiten erworben werden:
„Das beste Mittel zur Erhaltung des Friedens ist aber die Bereitschaft zum Kriege. Mit einfacheren Worten: wenn wir so stark sind, dass uns niemand anzugreifen und zu beleidigen wagt, wenn es dagegen jeder für wichtig hält, mit uns in guter Freundschaft zu leben, so ist der Friede gesichert. Wir brauchen eine starke Armee und eine starke Flotte, um unserem Vaterlande den Frieden zu wahren. An Euch, an der Jugend liegt es, ob Deutschland seine schöne, geachtete Stellung in der Welt bewahren wird. Eure Pflicht ist es, als tüchtige, deutsche Jungen den Körper zu stählen, damit Ihr einst Verteidiger des Vaterlandes werden könnt.“60
Mit der Veröffentlichung des Buches im Jahr 1909 war der erste Schritt getan, das englische Konzept Boy Scout auf die Verhältnisse im Deutschen Reich zu übertragen. Nur neun Jahre nach dem Ende der Belagerung Mafekings und ein Jahr nach der Veröffentlichung von Scouting for boys besorgte er zusammen mit Hauptmann Maximilian Bayer eine Übertragung ins Deutsche, die sich aber noch unübersehbar auf das englische Vorbild bezog.
3.2. Koloniales Handeln und Publizieren
Alexander Lion und Maximilian Bayer lernten sich in ihrer Zeit bei den „Schutztruppe“ genannten Militärteilen des Deutschen Reiches in der Kolonie „Deutsch-Südwestafrika“ im Jahr 1904 kennen. Lion leitet dort ein Feldlazarett und Bayer dient als Ordonanzoffizier im Generalstab.61 Beide nehmen also aktiv am Krieg des Deutschen Reiches gegen die Hereros und Nama teil, der in den ersten Völkermord des angebrochenen kalendarischen Jahrhunderts führte.
Wie sehr Lion und Bayer in ihrem Denken von ihren kolonialen Erlebnissen geprägt waren, kann man an ihrer publizistischen Tätigkeit erkennen: Bayer schildert im September 1906 einen Feldzug gegen die Hereros.62 Eine Gesamtdarstellung seiner Erfahrungen im Krieg gegen die Hereros und Nama in Südwestafrika erscheint 1908.63 Das Werk macht bereits in den ersten beiden Kapiteln sein rassistisches Menschenbild deutlich, wenn er die körperlichen Merkmale der afrikanischen Einwohner mit Abscheu schildert.64 Gleichzeitig wird das Denken in imperialen Kategorien deutlich, wenn er berichtet, dass in der Truppe auf der Überfahrt nach Afrika die Befürchtung laut geworden sei, deutsche Taten in Afrika würden vor dem Hintergrund des japanischen Überfalls auf Port Arthur international nicht gebührend beachtet werden.65 Über die publizistische Tätigkeit und das Menschenbild Bayers kann hier nicht erschöpfend gehandelt werden, wiewohl es für die Phase der Pfadfinder im Reich vor dem Großen Krieg in vielerlei Hinsicht interessant sein könnte.66
Lion verteidigte den deutschen Kolonialismus mit der niedrigeren Kulturstufe des „Negers“ und war der Ansicht, dass eine wirtschaftliche Ausbeutung der Afrikaner im nationalen Interesse des Reiches läge.67 Der Kolonialraum war für Lion auch Teil des identity space, für das es die deutsche Jugend aus Gründen des imperialen Wettbewerbes zu gewinnen gälte. Auch in dieser Hinsicht wurde er publizistisch tätig.68
Bayer und Lion waren beide nicht bloße Teilnehmer am kolonialen Geschehen, sondern sie verstanden sich jeweils auch als Experten für koloniale Fragen und als Propagandisten in dieser Hinsicht. So erklärt sich die breite koloniale Publizistik beider.
3.3. Nationalistische Kritik und ideologische Flexibilität
Neben der Initiative zur Gründung der Pfadfinder im Deutschen Reich durch Lion und Bayer entfaltete ein Impuls von allerhöchster Stelle seine Wirkung: Am 21. Juni 1910 erhielt überraschend der bis dahin ahnungslose Kavalleriegeneral (!) Moritz Freiherr von Bissing den Auftrag Wilhelms II., in Preußen eine Art Jugendwehr ähnlich den englischen Boy Scouts zu organisieren. Am 5. August 1910 überreichte er dem Kaiser und König von Preußen eine Denkschrift, mit der es ihm gelang, sich von diesem Auftrag wieder zu lösen.69
Im Gefolge einer intensiven Diskussion um Jugendwehren und zur Abwehr eines politischen Teilhabeanspruchs der Sozialdemokratie entstand in der Reichsführung und in Preußen der Wunsch, die Erziehung zwischen Schulhof und Kasernenhof staatlich stärker zu regulieren. Am 18. Januar 1911 - auf den Tag genau 40 Jahre nach Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 - regelte das Preußische Kultusministerium die „Vaterländische Jugendpflege“ per Erlass.70 Am gleichen Tag erfolgte die Gründung des Deutschen Pfadfinderbundes in Berlin, dessen Bundesfeldmeister Maximilian Bayer wird.71 Ehrenvorsitzender wurde Generalfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz.72
Von der Goltz forderte schon seit 1878 von der preußischen Militärführung, dass Maßnahmen zur körperlichen Ertüchtigung der Jugend ergriffen werden sollen. In Frankreich hatte er als Beobachter der Herbstmanöver erkannt, dass der körperlichen Jugendertüchtigung ein hoher Wert beigemessen werde.73 Um unter Ausschließung aller Politik die gesamt deutsche Jugend „wehrhaft und wahrhaft“ zu machen und um sie „körperlich und seelisch“ zu kräftigen, beantragte von der Goltz am 6. Juli 1911 beim Kaiser die Gründung des Jungdeutschlandbundes, was dieser am 5. August 1911 mit „freudiger Zustimmung“ genehmigte.74 Für von der Goltz diente der Jungdeutschlandbund der Vorbereitung des nächsten Krieges.75
Dass der Deutsche Pfadfinderbund auf eine Initiative Alexander Lions zurückging und englischem Vorbild folgte, war auch nationalistischen Kreisen nicht verborgen geblieben. In einer Broschüre unter dem Titel „Notschrei eines guten Preußen und guten Deutschen“ wandte sich im Oktober 1912 der Flügeladjudant des Kaisers, Generalleutnant Albano von Jacobi, gegen das Pfadfinderbuch Lions und bezeichnete es mit antisemitischem Unterton als „nationale Gefahr bei der Jugenderziehung.“ Von Jacobi war Mitglied im Vorstandsausschuss des Jungdeutschlandbundes, dem als erstes korporatives Mitglied auch der Deutsche Pfadfinderbund angehörte. Von der Goltz intervenierte erfolgreich beim Kaiser, der sich auf die Seite des Deutschen Pfadfinderbundes stellte.76
Die Ausgabe des Pfadfinderbuches von 1913 reagiert bereits auf diese Kritik. Der Titel lautet nunmehr „Jungdeutschlands Pfadfinderbuch“. Ausführlich geht Lion im Vorwort auf den Vorwurf ein, die Pfadfinder entstammten englischem Vorbilde. Und so führt er aus, dass man nie geleugnet habe, Baden-Powell zum Vorbild genommen zu haben, aber nun sei aber alles „auf deutsche Verhältnisse zugeschnitten.“ Man habe die Aufforderung zum internationalen Anschluss aus London abgelehnt und alle Beispiele aus englischen Scoutbüchern gestri- chen.77 So führt das erste Kapitel denn nunmehr auch aus, dass Turnvater Jahn der ideelle Urheber der Pfadfinderprinzipien sei und Baden-Powell eher eine Randfigur.78
Lion selbst blickt 1913 zurück auf die Ursachen der Pfadfinder- und Wehrkraftbewegung und fragt sich, was die Motive der Gegner gewesen wären, undnennt die englische Herkunft des Konzeptes als zentralen Vorwurf. Im klassisch imperialen Geist antwortet er ihnen, dass er entschlossen gewesen sei, fremden Nationen keinen Vorsprung zu gönnen:
„Wenn sie schon seit Jahrhunderten Kolonien besaßen, so griffen wir doch noch fest zu, bevor die Erde verteilt war; wenn sie ihre Dreadnoughts bauten, um uns zu schrecken, so bauten wir einfach noch größere; wenn sie Boy Scouts gründeten, um ihre Jugend stark und wehrkräftig zu machen, so schufen wir eben Pfadfinder, die der deutschen Jugend auf dem Pfade, der zu Gesundheit und Kraft, zu körperlicher und sittlicher Erstarkung führt, bahnbrechend voranschreiten sollen.“79
4. Fazit
Boy Scouts entstanden an der Schnittstelle des decision space und des identity space des Britischen Empires im Gefolge des Burenkrieges, die ihre Personifikation in Robert Baden- Powell fand. Die Bewegung entstand im nationalen Imaginationsraum eines imperialen Nationalstaats in der Gestimmtheit einer Krise, die in den militärischen Schwierigkeiten des Burenkrieges ihren Ausdruck fand. Baden-Powell nahm an, dass die Veränderungen, die die Moderne für die Lebensweise des Einzelnen mit sich gebracht hatte, die Ursache dieser Schwäche darstellten. Diese Schwäche könne das Empire in seinem Bestand gefährden. Gegen diese Schwächung setzt er seinErziehungskonzept, das den Körper, die sittliche Festigkeit und die Moral der männlichen Jugend stärken sollte. Sein Nimbus als imperialer Kriegsheld, der belligerrente Teil der Jugendpresse und religiöse Jugendorganisationen bilden die Komponenten, die zur Gründung des Boy Scout movement als Massenorganisation führten. Die gleichen Gründe treiben den Militärarzt Alexander Lion mit Blick auf die Musterungsstatistiken der Armee für das Deutsche Reich um, der im kolonialen Raum seine militärisch prägenden Erfahrungen im Krieg gegen die Herero und Nama macht. Er ist zuerst entschlossen, das englische Vorbild ins Deutsche Reich zu importieren und fand in Maximilian Bayer einen Mitstreiter. Als Kritik von nationalistischer Seite laut wird, passt er das ursprünglich englische Konzept an deutsche Nationalmythen an und immunisiert es so gegen diese Kritik. Die Bestrebungen Lions und Bayers treffen zusammen mit den Militarisierungswünschen konservativer Militärs wie denen des Generalfeldmarschalls von der Goltz. Hier erweist sich die Anpassungsfähigkeit des Konzeptes, die auf den militärischen Grundimpuls von Baden- Powells Aids to Scouting zurückverweist.
Die Geschichte der Pfadfinder im Deutschen Reich vor dem Großen Krieg kann daher als transnationale Verflechtungsgeschichte erzählt werden. Die Pfadfinder, die im besetzten Belgien militärische Hilfsdienste leisteten, folgten nur fünfzehn Jahre später dem Vorbild der Jungen des Mafeking Cadet Corps, das 1899 die Verteidigung Mafekings unterstützte.80
Quellen- und Literaturverzeichnis
A Quellen
Baschwitz, Bericht des 1. Vorsitzenden des DPB, Konsul Baschwitz, auf der Mitgliederversammlung des DPB am 6. 10. 1918 in Berlin, zitiert nach: Seidelmann, Karl, Die Pfadfinder in der deutschen Jugendgeschichte, Teil 2,1. Quellen und Dokumente aus der Zeit bis 1945, Hannover 1980, S. 47 f.
Baden-Powell, Robert, Scouting for Boys. A handbook for instruction in good citizenship, ed. Elleke Boehmer, Oxford 2005, Reprint der Ausgabe von 1908.
Ders., Aids to Scouting for N.C.O.s & Men, London 1915.
Bayer, Maximilian, Die Nation des Bastards, in: Zeitschrift für Kolonialpolitik, Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft, VIII. Jahrgang, Nr. 9, Berlin 1906, S. 625-648.
Ders., Mit dem Hauptquartier in Südwestafrika, Leipzig 1906.
Churchill, Winston S., Great Contemporaries, s.v. Lord Robert Baden-Powell, London 1938, S. 349-356.
Lion, Alexander, Die Kulturfähigkeit des Negers und die Erziehungsaufgaben der Kulturnationen, Berlin 1908.
Ders. (Hg.), Das Pfadfinderbuch, München 1909.
Ders. (Hg.), Jungdeutschlands Pfadfinderbuch, München 41913.
Ders., Die Pfadfinder- und Wehrkraftbewegung und ihre Ursachen, München 1913.
Ders., Als Freiwilliger nach Südwest. Eine Erzählung für Jungdeutschland auf Grund wirklicher Vorgänge, Leipzig 1914.
N.N., Imperial Rejoicings, in: The Times, 21. Mai 1900, S. 7.
N.N., Scouting as a Sport, in: The Times, 17. März 1908, S. 4.
Preußisches Kultusministerium, Erlaß zur Vaterländischen Jugendpflege v. 18.1.1911, zitiert nach: Karl Seidelmann, Die Pfadfinder in der deutschen Jugendgeschichte, Bd. 2,1. Quellen und Dokumente aus der Zeit bis 1945, Hannover 1980, S. 34.
B Literatur
Attridge, Steve, Nationalism, Imperialism and Identity in Late Victorian Culture. Civil and Military Worlds, Basingstoke 2003.
Bartmuss, Hartmut, Alexander Lion. Arzt, Sanitätsoffizier, Pfadfinder, Berlin 2017.
Botsch, Gideon, Zwischen Nationalismus und Weltpfadfinderbewegung. Zum schwierigen Erbe der Pfadfinder in Deutschland, in: Witte (Hg.), Witte, Matthias D. (Hg.), Pfadfinden Weltweit. Die Internationalität der Pfadfindergemeinschaft in der Diskussion, Wiesbaden 2015, S. 35-48.
Conze, Eckart/Witte Matthias D. (Hgg.), Pfadfinden. Eine globale Erziehungs- und Bildungsidee aus interdisziplinärer Sicht, Wiesbaden 2012.
Darvin, John, Der imperiale Traum. Die Globalgeschichte großer Reiche 1400-2000, Frankfurt/M. 2010.
Jeal, Tim, Baden-Powell, London 1989.
Krethlow, Carl Alexander, Generalfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz Pascha. Eine Biographie, Paderborn 2012.
Maier, Charles S., Consigning the Twentieth Century to History: Alternative Narratives for the Modern Era, in: American Historical Review 105, o.O. 2000, S. 807-831.
Marx, Christoph, Geschichte Afrikas. Von 1800 bis zur Gegenwart, Paderborn 2004.
Merriam-Webster. (n.d.). Maffick, in: Merriam-Webster.com dictionary, https://www.mer- riam-webster.com/dictionary/maffick, abgerufen am 10.03.2020, 21:55 Uhr.
Naudacher, Brigitte, Freizeit in öffentlicher Hand. Behördliche Jugendpflege in Deutschland von 1900-1980, Düsseldorf 1990.
Osterhammel, Jürgen, Auf der Suche nach einem 19. Jahrhundert, in: Conrad, Sebastian/E- ckert, Andreas, Globalgeschichte, Globalisierungen, multiple Modernen. Zur Geschichtsschreibung der modernen Welt, Frankfurt 2007, S. 109-130.
Ders., Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 22016.
Patel, Kiran Klaus, Überlegungen zu einer transnationalen Geschichte, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Jg. 52, Berlin 2004, S. 626-645.
Paulmann, Johannes, Reformer, Experten und Diplomaten. Grundlagen des Internationalismus im 19. Jahrhundert, in: Thiessen, Hillard von/Windler, Christian (Hgg.), Akteure der Außenbeziehungen. Netzwerke und Interkulturalität im historischen Wandel, Bd. 1, Köln 2010, S. 173-198.
Rosenthal, Michael, The Character Factory. Baden-Powell and the Origins of the Boy Scout Movement, London 1986.
Schrölkamp, Stephan, Gründerväter der Pfadfinderbewegung. Pfadfinderlebensläuft Band 1, Bauchnach 2005.
Seidelmann, Karl, Die Pfadfinder in der deutschen Jugendgeschichte, Bd. 1. Darstellung, Hannover 1977.
Schubert-Weller, Christoph, So begann es. Scouting vor vormilitärische Erziehung. Der Beginn der Pfadfinderbewegung in Deutschland am Vorabend des Ersten Weltkriegs, Bau- nach 1988.
Ders., „Kein schönrer Tod.“. Die Militarisierung der männlichen Jugend und ihr Einsatz im Ersten Weltkrieg 1890-1918, Weinheim/München 1998.
Thukydides, 1,23,5 & 1,23,6, ed.Jones, Stuttgart 1856, Übersetzung Gottwein, https://www.gottwein.de/Grie/thuk/thuk1023.php, abgerufen am 15.03.2020, 11:10 Uhr.
Witte, Matthias D. (Hg.), Pfadfinden Weltweit. Die Internationalität der Pfadfindergemeinschaft in der Diskussion, Wiesbaden 2015.
[...]
1 Aus Gründen der Unterscheidbarkeit verwendet diese Arbeit für das militärische Konzept des Kundschafters den Begriff scout, für die britische Übertragung als Erziehungskonzept den Begriff boy scout und für die deutsche Übertragung den Begriff Pfadfinder.
2 Vgl. Churchill, Winston S., Great Contemporaries, s.v. Lord Robert Baden-Powell, London 1938, S. 349356, hier S. 349.
3 Vgl. Seidelmann, Karl, Die Pfadfinder in der deutschen Jugendgeschichte, Bd. 1. Darstellung, Hannover 1977, S. 25.
4 Vgl. Preußisches Kultusministerium, Erlaß zur Vaterländischen Jugendpflege v. 18.1.1911, zitiert nach: Karl Seidelmann, Die Pfadfinder in der deutschen Jugendgeschichte, Bd. 2,1. Quellen und Dokumente aus der Zeit bis 1945, Hannover 1980, S. 34.; zu den Hintergründen, Vorgängererlassen und Fernwirkungen vgl. Brigitte Naudascher, Freizeit in öffentlicher Hand. Behördliche Jugendpflege in Deutschland von 1900-1980, Düsseldorf 1990, besonders S. 29-41.
5 Schubert Weller, Christoph, So begann es. Scouting als vormilitärische Erziehung. Der Beginn der Pfadfinderbewegung in Deutschland am Vorabend des Ersten Weltkriegs, Baunach 1988, und ders., „Kein schönrer Tod..Die Militarisierung der männlichen Jugend und ihr Einsatz im Ersten Weltkrieg 1890-1918, Wein- heim/München 1998.
6 Conze, Eckart/ Wittem, Matthias D. (Hgg.), Pfadfinden. Eine globale Erziehungs- und Bildungsidee aus interdisziplinärer Sicht, Wiesbaden 2012 und Witte, Matthias D. (Hg.), Pfadfinden weltweit. Die Internationalität der Pfadfindergemeinschaft in der Diskussion, Wiesbaden 2015.
7 Dagegen grundsätzlich richtig: Botsch, Gideon, Zwischen Nationalismus und Weltpfadfinderbewegung. Zum schwierigen Erbe der Pfadfinder in Deutschland, in: Witte (Hg.), Pfadfinden Weltweit, S. 35-48.
8 Vgl. Maier, Charles S., Consigning the Twentieth Century to History: Alternative Narratives for the Modern Era, in: American Historical Review 105, o.O. 2000, S. 807-831, hier S. 816. und Paulmann, Johannes, Reformer, Experten und Diplomaten. Grundlagen des Internationalismus im 19. Jahrhundert, in: Thiessen, Hillard von/Windler, Christian (Hgg.), Akteure der Außenbeziehungen. Netzwerke und Interkulturalität im historischen Wandel, Bd. 1, Köln 2010, S. 173-198, hier S. 193.
9 Vgl. Patel, Kiran Klaus, Überlegungen zu einer transnationalen Geschichte, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Jg. 52, Berlin 2004, S. 626-645, hier S. 636.
10 Vgl. Osterhammel, Jürgen, Auf der Suche nach einem 19. Jahrhundert, in: Conrad. Sebastian/Eckert, Andreas, Globalgeschichte, Globalisierungen, multiple Modernen. Zur Geschichtsschreibung der modernen Welt, Frankfurt 2007, S. 109-130, hier S. 125-126.
11 Vgl. Osterhammel, Jürgen, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 22016, S. 646-672; Osterhammel beschreibt hier die globalgeschichtlich wirksamen Mechanismen imperialer Nationalstaaten.
12 Vgl. Ebd., Verwandlung, S. 788-793.
13 Vgl. Darvin, John, Der imperiale Traum. Die Globalgeschichte großer Reiche 1400-2000, Frankfurt 2010, S. 295.
14 Vgl. Osterhammel, Verwandlung, S. 110.
15 Vgl. Jeal, Tim, Baden-Powell, London 1989, S. 11; die Familie schrieb sich Baden Powell, ohne Bindestrich. 1869 änderte sie die Schreibweise in Baden-Powell, um eine Verwandtschaft mit der aus Deutschland stammenden königlichen Familie zu insinuieren; vgl. ebd., S. 22; der Einfachheit halber folgt diese Arbeit der üblichen Schreibweise mit Bindestrich.
16 Vgl. Ebd., S. 38.
17 Osterhammel, Verwandlung, S. 656.
18 Vgl. Jeal, Baden-Powell, S. 45.
19 Zur militärischen Karriere Baden-Powells bis zur Belagerung von Mafeking an den meisten Schauplätzen des British Empires (Afghanistan, Nord- und Zentralafrika etc.) vgl. Jeal, Baden-Powell, S. 46-204.
20 Vgl. Osterhammel, Veränderung, S. 13.
21 Vgl. Jeal, Baden-Powell, S. 119.
22 Vgl. Robert Baden-Powell, Aids to Scouting for N.C.O.s & Men, London 1915.
23 Vgl. Ebd. S. 7.
24 Vgl. Ebd. S. 7.
25 Vgl. Churchill, Great Contemporaries, S. 351; vgl. dazu auch Jeal, Baden-Powell, S. 111; dieser Bericht macht auf den eingeschränkten Wert Churchills als Quelle aufmerksam. Nach Jeal hat ein Pferd Baden- Powells geritten von einem anderen Offizier den Kadir-Cup gewonnen im Jahr 1883; Churchills erneutes Aufeinandertreffen mit Baden-Powell fand ausweislich der Quelle drei Jahre später nach dem Entsatz von Mafeking 1900 statt, fand also 1897, 14 Jahre nach dem Kadir-Cup, statt. Bei Churchill selbst findet sich darauf kein Hinweis, was als Ausweis literarischer Überformung zu bewerten ist.
26 Vgl. Marx, Christoph, Geschichte Afrikas. Von 1800 bis zur Gegenwart, Paderborn 2004, S. 86.
27 Vgl. ebd., S. 119.
28 Vgl. ebd., S. 120.
29 Vgl. Darvin, Der imperiale Traum, 301 f. - nennt im Wesentlichen die gleichen Gründe wie Marx, macht aber darauf aufmerksam, dass für London der casus belli gewesen sei, dass der Präsident der Republik Transvaal die volle Unabhängigkeit von London gefordert habe und damit die Möglichkeit zu einem Eingreifen konkurrierender imperialer Mächte entstanden wäre; vgl. grundlegend Thuk., 1,23,5 &6.
30 Vgl. Jeal, Baden-Powell, S.223; die Literatur gefällt sich darin, diese in 5.000 Schwarze und 1.700 Weiße zu unterteilen, was angesichts der unterschiedlichen Beteiligung am Kampfgeschehen und der entsprechenden Siedlungsgeographie als vielleicht gerechtfertigt erscheinen kann.
31 Vgl. ebd., S. 300; zum militärischen Aspekt und einer sehr detaillierten Beschreibung der Belagerung vgl. ebd. S. 205-312; ein Kapitel, das Jeal bezeichnenderweise mit der Überschrift „The Hero“ versehen hat.
32 Vgl. Rosenthal, Michael, The Character Factory. Baden-Powell and the Origins of the Boy Scout Movement, London 1986, S. 162.
33 Vgl. Churchill, Great Contemporaries, S. 352.
34 Vgl. Rosenthal, Character Factory, S. 31. und Merriam-Webster. (n.d.). Maffick, in: Merriam-Webster.com dictionary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/maffick, abgerufen am 10.03.2020, 21:55 Uhr.
35 Times, 21. Mai 1900, S. 7.
36 Vgl. Jeal, Baden-Powell, S. 40.
37 Vgl. Jeal, Baden-Powell, S. 367.
38 Vgl. Attridge, Steve, Nationalism, Imperialism and Identity in Late Victorian Culture. Civil and Military Worlds, Basingstoke 2003, S. 48.
39 Vgl. Rosenthal, Character Factory, S. 53.
40 Vgl. Rosenthal, Character Factory, S.6.
41 Vgl. ebd., S. 85.
42 Baden-Powell, Robert, Scouting for Boys. A handbook for instruction in good citizenship, ed. Elleke Boeh- mer, Oxford 2005, Reprint der Ausgabe von 1908, S. 10; Hervorhebungen nicht im Original; „be prepared“ war sowohl das Motto der Boy Scouts als auch die Initialen Baden-Powells; Churchill verweise auf diesen Umstand, vgl. Churchill, Great Contemporaries S. 353.
43
44 Vgl. ebd., S. 275.
45 Vgl. ebd., S. 277.
46 Vgl. ebd., S. 296.
47 Vgl. ebd., S. 299.
48 Vgl. Rosenthal, Character Factory, S.2.
49 Vgl. Baden-Powell, Scouting for boys, S. 299f.
50 Vgl. Churchill, Great Contemporaries, S. 355.
51 Times, 17. März 1908, S.4; in der Literatur, so bei Bartmuss, findet man falsch häufig den 20.3.
52 Vgl. Hartmut Bartmuss, Alexander Lion. Arzt, Sanitätsoffizier, Pfadfinder, Berlin 2017, S. 30.
53 Vgl. Seidelmann, Darstellung, S. 193.
54 Alexander Lion (Hg.), Das Pfadfinderbuch, München 1909, Titelblatt.
55 Vgl. ebd., S I.
56 Ebd., S. IV; die Ausgabe von 1909 ist in Antiqua gesetzt, die von 1913 interessanterweise in Fraktur.
57 Vgl. ebd., S. IV. f.
58 Ebd., S. VIII, Kursive durch KK; ersetzen hier Anführungszeichen.
59 Ebd., S. 7.
60 Ebd., S. 306 f.
61 Vgl. Schrölkamp, Stephan, Gründerväter der Pfadfinderbewegung. Pfadfinderlebensläufe Band 1, Baunach 2005, S. 15.; Schrölkamp ist nur von eingeschränktem Wert. Er bietet eine sehr großer Detailfülle biographischer Stationen, aber fehlt ihm jede kritische Distanz zu den von ihm beschriebenen Akteuren, ihrer Zeit und ihren Taten.
62 Bayer, Maximilian, Die Nation des Bastards, in: Zeitschrift für Kolonialpolitik, Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft, VIII. Jahrgang, Nr. 9, Berlin September 1906, S. 625-648.
63 Ders., Mit dem Hauptquartier in Südwestafrika, Leipzig 1906.
64 Vgl. ebd.; auf genaue Seitenangabe muss leider verzichtet werden, da der historische Lesesaal der USB aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen worden ist.
65 Ebd., o.S.
66 Ein Verzeichnis seiner Schriften bietet Schrölkamp, Gründerväter, S. 139-146.
67 Lion, Alexander, Die Kulturfähigkeit des Negers und die Erziehungsaufgaben der Kulturnationen, Berlin 1908; erschienen in der Reihe: Koloniale Abhandlungen als Heft 15; Nr. 1 davon ist Bayers Nation des Bastards.
68 Ders.; Als Freiwilliger nach Südwest. Eine Erzählung für Jungdeutschland auf Grund wirklicher Vorgänge, Leipzig 1914.
69 Vgl. Schubert-Weller, Kein schönrer Tod, S. 91.
70 Seidelmann, Quellen, S. 34.
71 Seidelmann, Darstellung, S. 35.
72 Vgl. Krethlow, Carl Alexander, Generalfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz Pascha. Eine Biographie, Paderborn 2012, S. 404.
73 Vgl. ebd., S. 401.
74 Vgl. ebd., S. 404 f.
75 Vgl. ebd., S. 409.
76 Vgl. ebd., S. 411.
77 Vgl. Lion, Alexander (Hg.), Jungdeutschlands Pfadfinderbuch, München 41913, S.IX.
78 Vgl. Ebd., S. 1.
79 Lion, Alexander, Die Pfadfinder- und Wehrkraftbewegung und ihre Ursachen, München 1913, S. 16 f.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit über Boy Scouts und Pfadfinder?
Die Arbeit untersucht, unter welchen Bedingungen die Boy Scout-Bewegung entstand und sich verbreitete, wie daraus im Deutschen Reich das Konzept der Pfadfinder entstand und mit welcher Intention dabei spezifische Anpassungen vorgenommen wurden. Sie betrachtet die Geschichte der Boy Scouts und der Pfadfinderbewegung unter Berücksichtigung des Imperialismus und des kolonialen Kontexts.
Welches Konzept wird für die Analyse verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf das Konzept der Territorialität des US-amerikanischen Historikers Charles S. Maier, der die Räume für einen Staat als "decision space" und "identity space" kennzeichnet. Der "decision space" wird von politischen Machthabern durch Entscheidungen kontrolliert, während der "identity space" öffentliche Arenen umfasst, über die Loyalität und Identität hergestellt werden.
Was sind die zentralen Thesen der Arbeit?
Die Boy Scout-Bewegung entstand an der Schnittstelle des "decision space" und des "identity space" des Britischen Empires im Zuge des Burenkrieges. Robert Baden-Powell personifizierte diese Bewegung. Im Deutschen Reich passten Alexander Lion und Maximilian Bayer das englische Konzept an deutsche Nationalmythen an, um es gegen Kritik zu immunisieren. Die Anpassungsfähigkeit des Konzepts beruht auf dem militärischen Grundimpuls von Baden-Powells "Aids to Scouting".
Welche Rolle spielte die Belagerung von Mafeking?
Die Belagerung von Mafeking war ein formativer Mythos für die Boy Scout-Bewegung und die Pfadfinderbewegung. Sie konstituierte Baden-Powells Status eines Kriegshelden, führte zur publizistischen Verbreitung seines Werkes "Aids to scouting" und zeigte die militärische Nützlichkeit organisierter Jugendlicher.
Wie wurde das Konzept der Boy Scouts im Deutschen Reich aufgenommen und angepasst?
Alexander Lion übersetzte "Scouting for Boys" ins Deutsche und veröffentlichte "Das Pfadfinderbuch". Er betonte die Bedeutung der körperlichen Ertüchtigung und Hilfsbereitschaft. Später passte er das Konzept an deutsche Verhältnisse an, um nationalistischer Kritik entgegenzuwirken und es mit deutschen Nationalmythen zu verbinden. Die Ursprünglich englische Verankerung wurde durch die Betonung Turnvater Jahns als ideellem Urheber ersetzt.
Welche Rolle spielten koloniale Erfahrungen bei der Entstehung der Pfadfinderbewegung im Deutschen Reich?
Alexander Lion und Maximilian Bayer lernten sich während ihrer Zeit bei den "Schutztruppen" in der Kolonie "Deutsch-Südwestafrika" kennen. Ihre kolonialen Erfahrungen prägten ihr Denken und Handeln. Sie sahen den Kolonialraum als Teil des "identity space", für den es die deutsche Jugend aus Gründen des imperialen Wettbewerbs zu gewinnen galt.
Wie positionierten sich die Pfadfinder im Deutschen Reich zum Militarismus?
Die Pfadfinderbewegung im Deutschen Reich war von Beginn an mit militaristischen Tendenzen verbunden. Die körperliche Ertüchtigung der Jugend wurde als Vorbereitung auf den Krieg angesehen. Generalfeldmarschall Colmar Freiherr von der Goltz forderte Maßnahmen zur körperlichen Ertüchtigung der Jugend und gründete den Jungdeutschlandbund zur Vorbereitung des nächsten Krieges. Alexander Lion betont, dass fremden Nationen kein Vorsprung gegönnt werden sollte: "Wenn sie Boy Scouts gründeten, um ihre Jugend stark und wehrkräftig zu machen, so schufen wir eben Pfadfinder".
- Quote paper
- Kristian Kaiser (Author), 2020, Aus Boy Scouts werden Pfadfinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538860