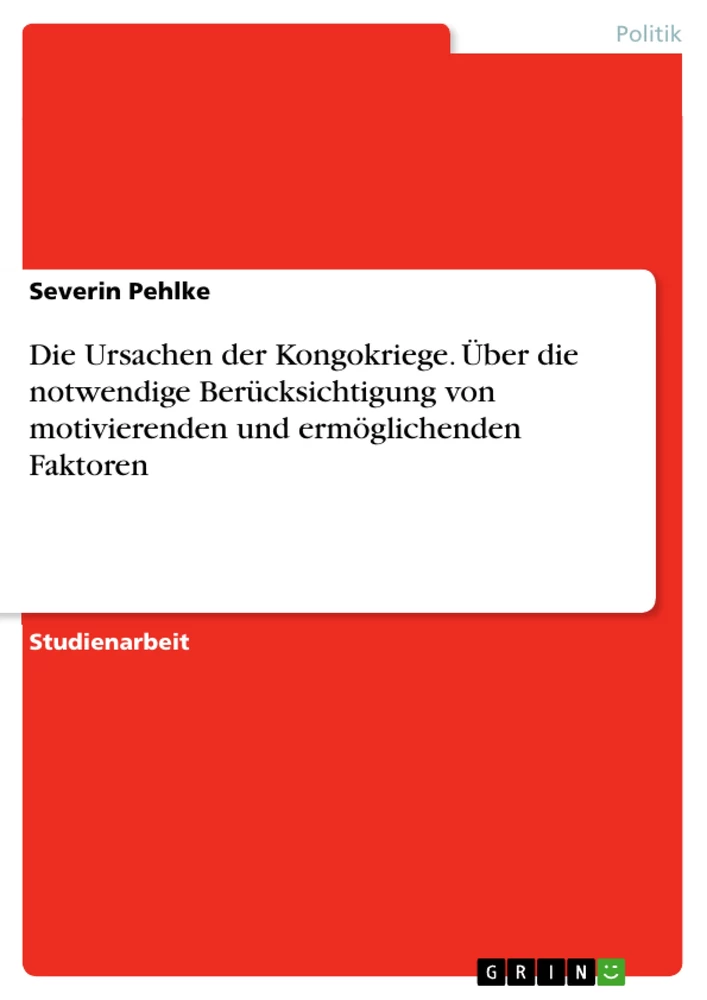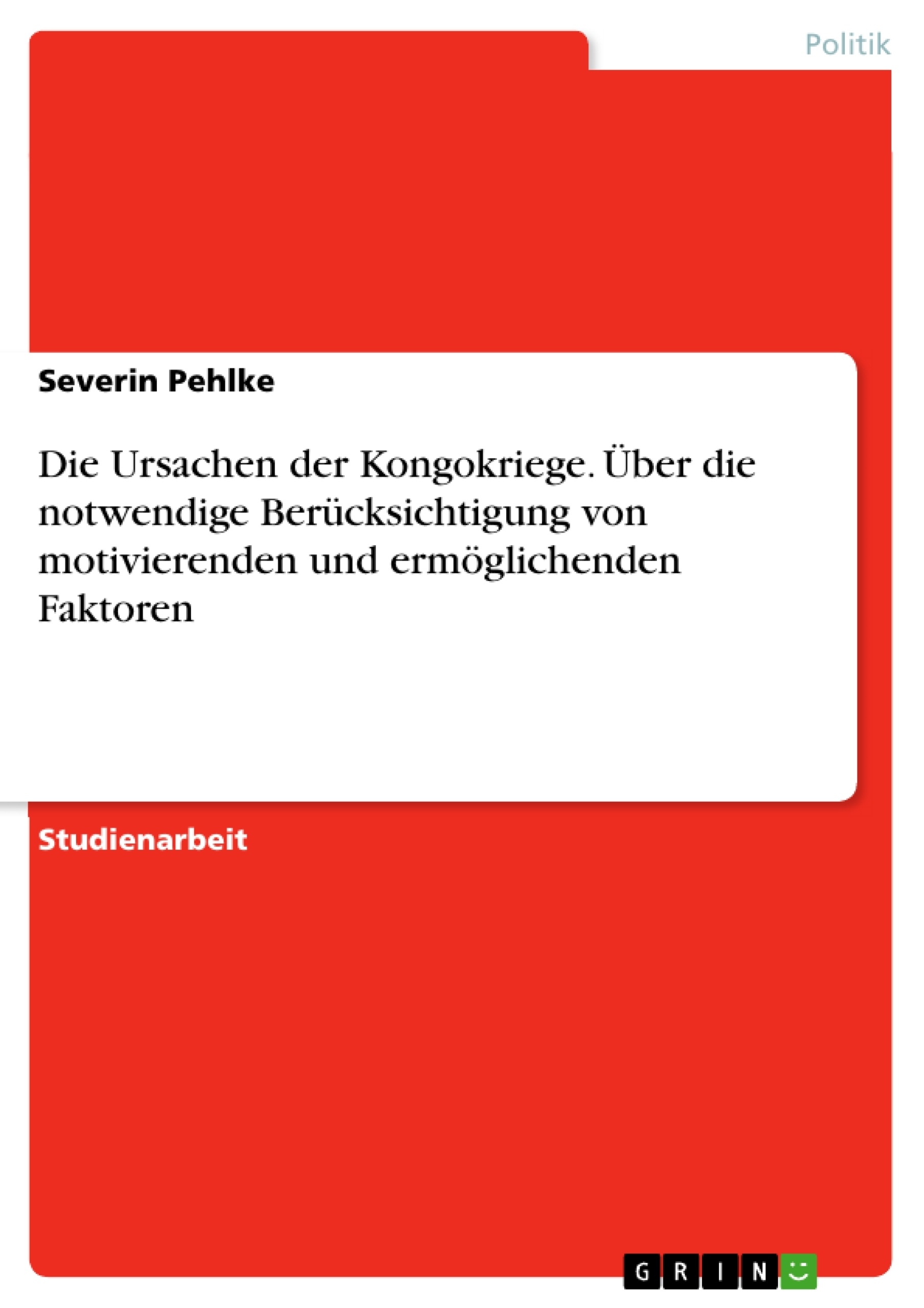Im Kongo ist seit über zwei Jahrzehnten kein nachhaltiger Frieden eingekehrt: Die beiden großen Kongokriege haben das Land schwer in Mitleidenschaft gezogen und im Ostkongo herrscht bis heute ein unübersichtlicher Bürgerkrieg. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass eine solche Gewaltspirale nur durch das Zusammenwirken und die gegenseitige Verstärkung von ethnisch- kulturellen, institutionellen und ökonomischen Faktoren zu erklären ist. Das Konzept der „Ursachen innenpolitischer Gewalt“ nach Bussmann, Hasenclever und Schneider dient dabei als Eingrenzung des analytischen Rahmens. Im Verlauf der Arbeit werden die motivierenden und ermöglichenden Dimensionen der ethnisch-kulturellen, institutionellen und ökonomischen Konfliktursachen herausgearbeitet.
Bei der Analyse innerstaatlicher Kriege und gewaltsamer Rebellion müssen stets motivierende und ermöglichende Faktoren einbezogen werden. Bei einem einseitigen Fokus auf die Kapazität von gewaltsamer Rebellion – wenn nur darauf geachtet wird welche materiellen Faktoren sie ermöglichen – verkennt man ethnisch-kulturelle Differenzen, historische Faktoren und externe Einflüsse, die einen Konflikt mitbegründen. Andererseits würde eine Beschränkung auf motivierende Ursachen ebenfalls zu kurz treten: Wenn nur danach gefragt wird, warum eine Bevölkerungsgruppe gewaltsam rebelliert, übersieht man systemische und materielle Umstände, die innerstaatliche Kriege auslösen und fördern können, wie beispielsweise eine florierende Kriegsökonomie, die keine friedlichen Erwerbsmöglichkeiten zulässt.
Der viel zitierte britische Wirtschaftswissenschaftler Paul Collier beschränkt sich mit seiner ‚Feasibility‘-Hypothese auf ein singuläres, ökonomisches Analysemodell, das einen Fokus auf die Kapazität gewaltsamer Rebellion legt: „It seems to me that the key insight into rebellion comes not from asking why it happens but how it happens“ (Collier 2009: 133). Colliers Ansatz soll in dieser Arbeit widerlegt werden. Eine solch eindimensionale Perspektive verklärt die Komplexität innerstaatlicher Konflikte – besonders im Falle der Demokratischen Republik Kongo.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1 Colliers, Feasibility'-Hypothese
- 2.2 Ursachen innenpolitischer Gewalt nach Bussmann et al.
- 3. Die Kongokriege
- 3.1 Historischer Hintergrund
- 3.2 Kriegsverlauf
- 3.2.1 Der Erste Kongokrieg (1996-1997)
- 3.2.2 Der Zweite Kongokrieg (1998-2003)
- 3.2.3 Aktueller Krieg im Ostkongo
- 3.3 Motivierende und ermöglichende Ursachen der Kongokriege
- 3.3.1 Identität
- 3.3.2 Politische Institutionen und Ressourcen
- 3.3.3 Ökonomie
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen der Kongokriege und widerlegt die einseitige „Feasibility“-Hypothese von Paul Collier, die lediglich auf die Durchführbarkeit von Rebellion fokussiert. Stattdessen wird das differenzierte Analysemuster von Bussmann, Hasenclever und Schneider angewendet, welches ökonomische, politische und kulturelle Faktoren berücksichtigt. Ziel ist es, die Komplexität des Konflikts durch die Betrachtung sowohl motivierender als auch ermöglichender Ursachen zu beleuchten.
- Widerlegung der „Feasibility“-Hypothese von Collier
- Anwendung des Analysemusters von Bussmann et al. auf die Kongokriege
- Analyse der Rolle von Identität, politischen Institutionen und ökonomischen Faktoren
- Untersuchung des Zusammenspiels motivierender und ermöglichender Ursachen
- Erklärung der anhaltenden Gewalt im Kongo
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik des anhaltenden Konflikts in der Demokratischen Republik Kongo dar und führt in die Thematik der motivierenden und ermöglichenden Faktoren innerstaatlicher Gewalt ein. Sie führt die „Feasibility“-Hypothese von Collier ein, die im weiteren Verlauf der Arbeit kritisch hinterfragt und widerlegt werden soll. Die Arbeit setzt den theoretischen Rahmen von Bussmann et al. ein, der kulturelle Konfliktlinien, politische Institutionen und wirtschaftliche Opportunitätskosten analysiert. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Zusammenspiels motivierender und ermöglichender Ursachen für die Kongokriege.
2. Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel präsentiert zwei gegensätzliche theoretische Ansätze zur Erklärung innerstaatlicher Konflikte. Zunächst wird Colliers „Feasibility“-Hypothese vorgestellt, die die Durchführbarkeit von Rebellion als zentralen Faktor betont und motivierende Faktoren vernachlässigt. Im Anschluss wird der differenzierte Ansatz von Bussmann et al. eingeführt, der kulturelle Konfliktlinien, politische Institutionen und ökonomische Opportunitätskosten als gleichwertige Faktoren berücksichtigt. Dieser Ansatz bildet die Grundlage der Analyse der Kongokriege.
3. Die Kongokriege: Dieses Kapitel behandelt die Kongokriege umfassend, beginnend mit dem historischen Hintergrund und dem Kriegsverlauf (inklusive des Ersten und Zweiten Kongokriegs sowie des aktuellen Konflikts im Ostkongo). Es analysiert die motivierenden und ermöglichenden Ursachen der Konflikte unter den Aspekten Identität, politischer Institutionen und ökonomischer Faktoren. Die Kapitel untersuchen, wie diese Faktoren zusammenwirken und die anhaltende Gewaltspirale im Kongo befeuern.
Schlüsselwörter
Kongokriege, innerstaatliche Konflikte, gewaltsame Rebellion, „Feasibility“-Hypothese, Paul Collier, Bussmann, Hasenclever, Schneider, Identität, politische Institutionen, Ökonomie, motivierende Ursachen, ermöglichende Ursachen, Kulturelle Konfliktlinien, wirtschaftliche Opportunitätskosten, Staatsschwäche.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Kongokriege
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Ursachen der Kongokriege im Kongo und widerlegt dabei die einseitige „Feasibility“-Hypothese von Paul Collier. Sie untersucht die Komplexität des Konflikts durch die Betrachtung sowohl motivierender als auch ermöglichender Ursachen.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit vergleicht und kontrastiert zwei theoretische Ansätze: Colliers „Feasibility“-Hypothese, die sich auf die Durchführbarkeit von Rebellion konzentriert, und das differenzierte Analysemuster von Bussmann, Hasenclever und Schneider, welches ökonomische, politische und kulturelle Faktoren berücksichtigt. Letzteres bildet die Grundlage der Analyse.
Welche Faktoren werden analysiert?
Die Analyse betrachtet motivierende und ermöglichende Ursachen der Kongokriege. Zu den analysierten Faktoren gehören Identität, politische Institutionen, ökonomische Faktoren (inklusive wirtschaftlicher Opportunitätskosten), und kulturelle Konfliktlinien. Das Zusammenspiel dieser Faktoren wird untersucht.
Wie werden die Kongokriege behandelt?
Die Arbeit beschreibt den historischen Hintergrund und den Kriegsverlauf der Kongokriege (Erster und Zweiter Kongokrieg, aktueller Konflikt im Ostkongo). Sie analysiert detailliert die Rolle der oben genannten Faktoren bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Konflikte.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit widerlegt die „Feasibility“-Hypothese von Collier und zeigt die Notwendigkeit einer differenzierten Analyse, die verschiedene ökonomische, politische und kulturelle Faktoren berücksichtigt, um die Komplexität der Kongokriege zu verstehen. Das Zusammenspiel von motivierenden und ermöglichenden Faktoren wird als entscheidend für die anhaltende Gewalt im Kongo hervorgehoben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum theoretischen Rahmen (mit Darstellung der Theorien von Collier und Bussmann et al.), ein Kapitel über die Kongokriege (mit historischem Hintergrund und Analyse der Ursachen) und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Kongokriege, innerstaatliche Konflikte, gewaltsame Rebellion, „Feasibility“-Hypothese, Paul Collier, Bussmann, Hasenclever, Schneider, Identität, politische Institutionen, Ökonomie, motivierende Ursachen, ermöglichende Ursachen, kulturelle Konfliktlinien, wirtschaftliche Opportunitätskosten, Staatsschwäche.
- Quote paper
- Severin Pehlke (Author), 2019, Die Ursachen der Kongokriege. Über die notwendige Berücksichtigung von motivierenden und ermöglichenden Faktoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538856