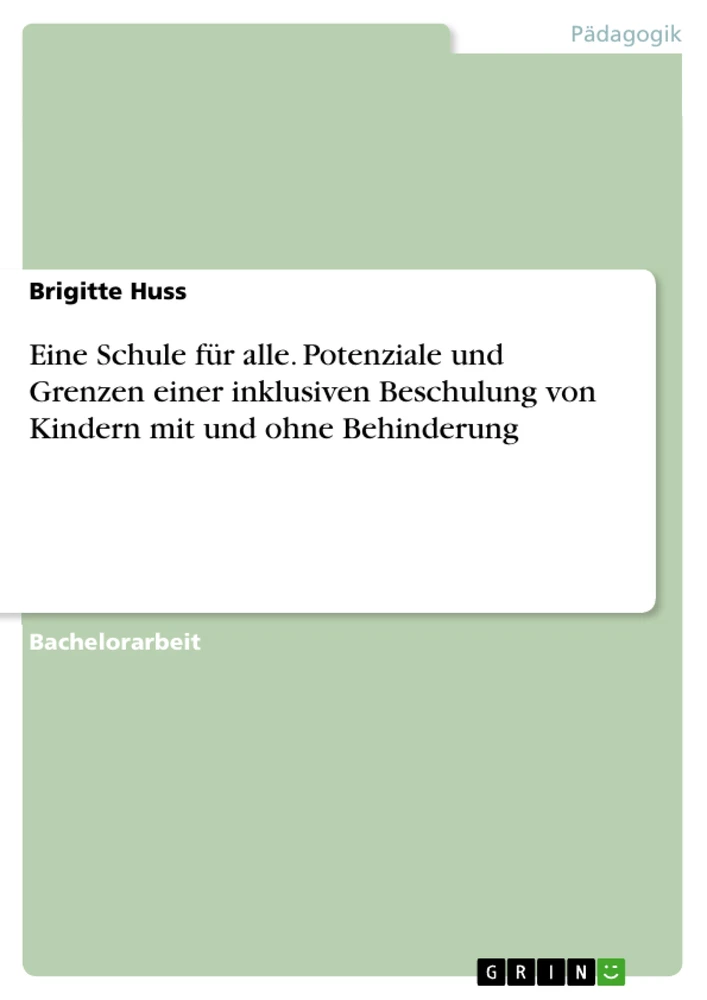Die Themen dieser Arbeit sind die Idee einer Schule für alle, der Weg bis dorthin, die Möglichkeiten inklusiver Konzepte und die Potenziale und Grenzen einer inklusiven Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung.
Was für uns heutzutage noch mehr nach einer Utopie klingt, soll – wenn es nach Inklusions-Befürwortern geht – in den nächsten Jahrzehnten Realität werden. Durch Anerkennung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-Behindertenrechtskonvention) als geltendes Recht hat Deutschland sich verpflichtet, sein Schulsystem zu überarbeiten und hat somit einen wichtigen Teil zur Verwirklichung der Utopie „Eine Schule für alle“ beigetragen. Doch leider ist die Umsetzung dieser Konvention keine Sache von ein paar Monaten, inklusive Beschulung flächendeckend umzusetzen wird noch mehrere Jahre dauern und wird dem deutschen Schulsystem viel abverlangen. Doch eben die Idee einer Schule für alle, der Weg bis dorthin, die Möglichkeiten inklusiver Konzepte und die Potenziale und Grenzen einer inklusiven Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung beschäftigen in der aktuellen Zeit viele Pädagogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Behinderung
- Inklusion
- Inklusion und Integration
- Rechtliche Grundlagen
- Die Salamanca-Erklärung (1994)
- Die UN-Behindertenrechtskonvention (2006)
- Inklusive Beschulung - Potenziale und Grenzen
- Der Weg zur Inklusion in der Schule
- Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der deutschen Bildungspolitik
- Bayern
- Bremen
- Konzepte inklusiver Beschulung
- Kooperatives Lernen
- Das Gelingen inklusiver Schulen
- Allgemeine Veränderungen
- Personelle Veränderungen
- Veränderungen der Lehrkompetenzen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Thematik der inklusiven Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung und widmet sich den Potenzialen und Grenzen dieses pädagogischen Konzepts. Sie analysiert die rechtlichen Grundlagen und den Weg zur Inklusion in der deutschen Bildungspolitik sowie die Umsetzung in der Praxis.
- Definition von Behinderung und Inklusion
- Rechtliche Grundlagen der Inklusion
- Konzepte und Strategien für inklusive Beschulung
- Herausforderungen und Grenzen der Inklusion in der Schule
- Potenziale und Auswirkungen inklusiver Beschulung
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Bedeutung der Inklusion und das Ziel einer „Schule für alle“ anhand des Zitats von Theo Klauß beleuchtet. Die aktuelle Situation in Deutschland, die Unterteilung von Schülern nach ihren Leistungen und die Notwendigkeit einer Veränderung des Schulsystems, werden dargestellt. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderung, die inklusive Beschulung für das deutsche Schulsystem darstellt und wie die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention dazu beitragen kann.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Begriff der Behinderung und definiert diesen anhand verschiedener Ansätze, einschließlich der Definition im Sozialgesetzbuch (SGB IX). Die Arbeit diskutiert die verschiedenen Perspektiven auf Behinderung, insbesondere die Sichtweise der Gehörlosenkultur und die Definition der WHO, welche vier Grundbegriffe einführt: Krankheit, Schädigung, Behinderung und Beeinträchtigung.
Im dritten Kapitel wird der Begriff Inklusion im Vergleich zum Begriff Integration definiert. Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der Inklusion, insbesondere die Salamanca-Erklärung (1994) und die UN-Behindertenrechtskonvention (2006). Die Bedeutung dieser rechtlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft und die Gestaltung des Schulsystems wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Inklusion, Behinderung, Integration, Salamanca-Erklärung, UN-Behindertenrechtskonvention, inklusive Beschulung, kooperatives Lernen, Potenziale, Grenzen, deutsche Bildungspolitik, Schule für alle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Idee einer "Schule für alle"?
Es handelt sich um das Konzept der inklusiven Beschulung, bei der Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen und das Schulsystem an die Vielfalt der Schüler angepasst wird.
Welche rechtliche Grundlage verpflichtet Deutschland zur Inklusion?
Deutschland hat sich durch die Anerkennung der UN-Behindertenrechtskonvention (2006) verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen zu gewährleisten.
Was ist der Unterschied zwischen Inklusion und Integration?
Während Integration oft die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in ein bestehendes System meint, zielt Inklusion darauf ab, das System von vornherein so zu gestalten, dass alle gleichermaßen teilhaben können.
Was versteht man unter kooperativem Lernen im inklusiven Kontext?
Kooperatives Lernen ist eine Methode, bei der Schüler in heterogenen Gruppen zusammenarbeiten, um gemeinsam Lernziele zu erreichen und sich gegenseitig zu unterstützen.
Was sind die größten Herausforderungen bei der Umsetzung inklusiver Schulen?
Zu den Grenzen und Herausforderungen gehören notwendige personelle Veränderungen, die Anpassung der Lehrkompetenzen sowie strukturelle Umbauprozesse in der Bildungspolitik.
- Arbeit zitieren
- Brigitte Huss (Autor:in), 2016, Eine Schule für alle. Potenziale und Grenzen einer inklusiven Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538763