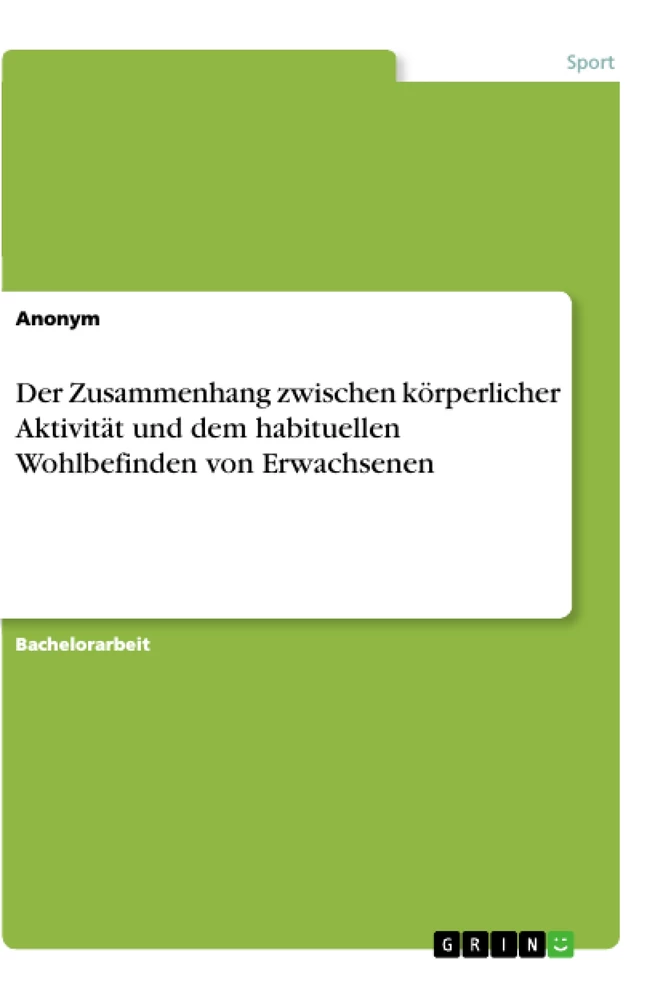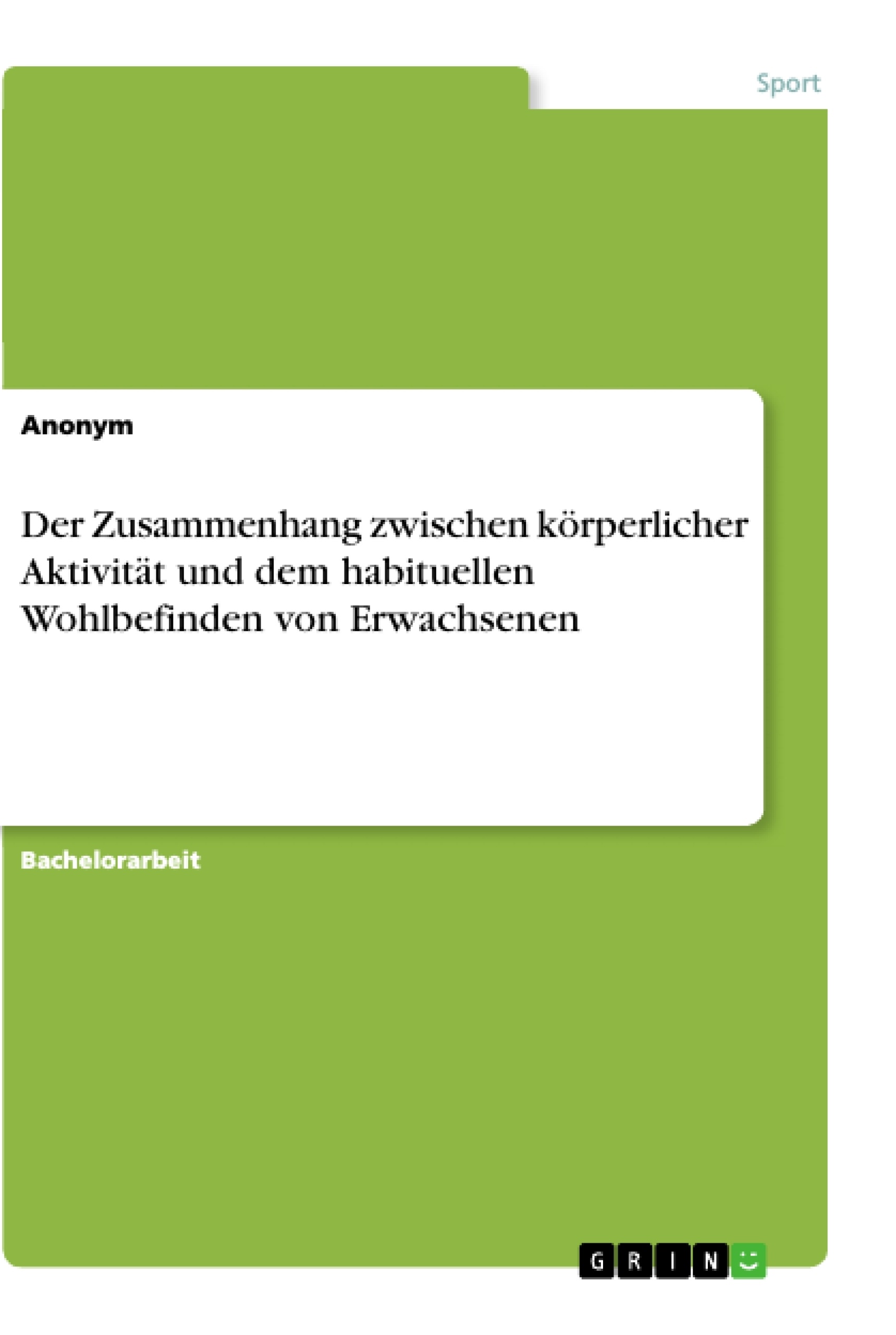Im Verlauf dieser Arbeit soll der Zusammenhang der Schlüsselvariable körperliche Aktivität und dem allgemeinen habituellen Wohlbefinden betrachtet werden.
Körperliche Aktivität als Überbegriff lässt sich in seine einzelnen Bestandteile zerlegen: Es soll der Zusammenhang der körperlichen Aktivität im Beruf, in der Freizeit und im Sport sowie als Gesamtaktivität untersucht werden. Die Entscheidung, sich auf das habituelle Wohlbefinden zu konzentrieren, basiert darauf, dass Schlicht und Brand unterstreichen, dass in Studien überwiegend das "aktuelle Wohlbefinden" berücksichtigt wird, nur selten aber das habituelle. Das sogenannte habituelle Wohlbefinden ist das überdauernde, gewohnheitsmäßige Wohlbefinden. Es bleibt einigen Wochen bis hin zu mehreren Monaten bestehen und ist situationsübergreifend.
Jeder Mensch führt ein individuelles Leben, doch fast alle Menschen verfolgen das gleiche Ziel – Wohlbefinden. Mayring bezeichnet das Streben nach Wohlbefinden als ein zentrales Lebensbedürfnis des Menschen. Wohlbefinden repräsentiert die subjektive Komponente von Gesundheit. Dieses zentrale Kriterium ist 1946 erstmals in der Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation aufgenommen worden. Diese lautet: "Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen".
In einem Wechselspiel von Versuch und Irrtum versucht der Mensch das in sein Leben zu integrieren, was ihm, seiner Meinung nach, den höchsten Gewinn bzw. das größtmögliche Wohl verspricht. Diese Bestrebung ist nicht neu, sie beschäftigt Menschen bereits seit Jahrtausenden. Menschen, die ein positives Gesundheitsverhalten aufweisen, fühlen sich tendenziell wohler. Gesunde Ernährung, aktives Erholungsverhalten, guter Umgang mit Stress sowie körperliche Aktivität sind gesundheitsfördernde Beispiele und steigern das Wohlbefinden. Lange Zeit wurden körperliche und psychische Komponenten separat betrachtet. Dabei ist diese Ganzheitlichkeit schon früher wahrgenommen worden. So wie einst der römische Dichter Juvenal sagte: "Mens sana in corpore sano" – in einem gesunden Körper, wohnt ein gesunder Geist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aufbau der Arbeit
- Teil 1: Theoretische Grundlagen
- 3. Wohlbefinden
- 3.1 Die eudaimonische versus hedonische Perspektive
- 3.2 Wohlbefinden als Dimension der Lebensqualität
- 3.3 Wohlbefinden und Gesundheit
- 3.4 Wohlbefinden nach Diener
- 3.5 Aktuelles und habituelles Wohlbefinden
- 3.6 Vier-Faktoren-Modell nach Mayring
- 4. Körperliche Aktivität
- 4.1 Körperliche Aktivität im Allgemeinen
- 4.2 Dosis-Wirkungs-Beziehung körperlicher Aktivität
- 4.3 Sportliche Aktivität als Teil der körperlichen Aktivität
- 4.3.1 Empfehlungen zur sportlichen Aktivität
- 4.3.2 Training und Trainingsarten
- 5. Körperliche Aktivität und Wohlbefinden
- 6. Aktueller Forschungsstand
- Teil 2: Empirische Forschung
- 7. Forschungsfrage und Hypothesenbildung
- 8. Methodik der Datenerhebung
- 8.1 Pretest
- 8.2 Fragebogenbeschreibung
- 8.3 Stichprobenbeschreibung
- 9. Datenauswertung
- 10. Ergebnisse
- 10.1 Deskriptive Ergebnisdarstellung
- 10.2 Interferenzstatistische Ergebnisdarstellung
- 11. Diskussion
- 11.1 Hypothesenprüfung und Ergebnisdiskussion
- 11.2 Bewertung des Messinstrumentes und der Ergebnisse
- 12. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und habituellem Wohlbefinden bei Erwachsenen. Ziel ist es, mittels einer empirischen Studie die Korrelation zwischen diesen beiden Variablen zu ermitteln und zu beschreiben. Die körperliche Aktivität wird dabei in die Bereiche Beruf, Freizeit und Sport unterteilt.
- Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Wohlbefinden
- Untersuchung der Korrelation in verschiedenen Aktivitätsbereichen (Beruf, Freizeit, Sport)
- Anwendung einer empirischen Methode zur Datengewinnung und -analyse
- Interpretation der Ergebnisse im Kontext des aktuellen Forschungsstandes
- Bewertung der verwendeten Messinstrumente
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Relevanz des Zusammenhangs zwischen körperlicher Aktivität und Wohlbefinden. Sie beschreibt die Problemstellung und leitet zur Forschungsfrage über. Die Bedeutung von Wohlbefinden für die Lebensqualität wird angerissen, ebenso wie die Notwendigkeit weiterer Forschung in diesem Bereich, insbesondere im Bezug auf die verschiedenen Arten körperlicher Aktivität. Es wird kurz der Aufbau der Arbeit skizziert.
3. Wohlbefinden: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte des Wohlbefindens. Es werden unterschiedliche Perspektiven (eudaimonisch vs. hedonisch) vorgestellt und das Wohlbefinden als Dimension der Lebensqualität betrachtet. Die Definitionen von Wohlbefinden nach Diener werden erörtert und der Unterschied zwischen aktuellem und habituellem Wohlbefinden erklärt. Schließlich wird das Vier-Faktoren-Modell nach Mayring vorgestellt und in den Kontext der Studie eingeordnet, um ein umfassendes Verständnis von Wohlbefinden zu ermöglichen.
4. Körperliche Aktivität: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition von körperlicher Aktivität und differenziert zwischen den Bereichen Beruf, Freizeit und Sport. Die Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen körperlicher Aktivität und Gesundheit wird beleuchtet, sowie spezifische Empfehlungen zur sportlichen Aktivität und verschiedene Trainingsarten. Der Zusammenhang zwischen diesen verschiedenen Arten von körperlicher Aktivität wird ausführlich behandelt und die Bedeutung jeder Kategorie für das Gesamtbild herausgestellt.
5. Körperliche Aktivität und Wohlbefinden: Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Wohlbefinden. Es werden bereits bestehende Studien und Theorien diskutiert, um den aktuellen Forschungsstand auf diesem Gebiet darzustellen und den Rahmen für die eigene empirische Untersuchung zu schaffen. Verschiedene Modelle und Ansätze zur Erklärung dieser Beziehung werden vorgestellt und kritisch bewertet, um die Lücke zu identifizieren, die die vorliegende Arbeit zu schließen versucht.
7. Forschungsfrage und Hypothesenbildung: Dieses Kapitel formuliert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit und leitet daraus konkrete Hypothesen ab. Es wird präzise erläutert, welche Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Arten der körperlichen Aktivität und dem habituellen Wohlbefinden untersucht werden sollen und welche Erwartungen die Autor*innen aufgrund des theoretischen Hintergrunds haben. Das Kapitel bildet somit die Grundlage für den empirischen Teil der Arbeit.
8. Methodik der Datenerhebung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Datenerhebung. Es erläutert den Ablauf des Pretests, die Struktur und den Inhalt des verwendeten Online-Fragebogens sowie die Zusammensetzung der Stichprobe. Die gewählten Methoden werden begründet und ihre Eignung für die Beantwortung der Forschungsfrage wird dargelegt. Die Kapitelteil beschreiben die Auswahl der Probanden und die Methoden zur Datenbeschaffung.
9. Datenauswertung: Dieses Kapitel erläutert die angewandte Methode der Datenauswertung. Es wird detailliert auf die statistischen Verfahren eingegangen, die zur Analyse der erhobenen Daten verwendet wurden. Die Auswahl dieser Verfahren wird begründet, und es wird erklärt, wie die Daten interpretiert und in Bezug zu den Forschungsfragen und Hypothesen gesetzt werden.
10. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Studie. Es wird sowohl eine deskriptive als auch eine inferenzstatistische Ergebnisdarstellung vorgenommen. Die Ergebnisse werden detailliert und übersichtlich dargestellt, um ein klares Bild der Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen zu ermöglichen. Die Ergebnisse werden im Kontext des aktuellen Forschungsstands erläutert.
11. Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Studie im Hinblick auf die formulierten Hypothesen. Es wird geprüft, ob die Hypothesen bestätigt oder widerlegt werden konnten, und mögliche Erklärungen für die Ergebnisse werden erörtert. Die Stärken und Schwächen der Studie werden kritisch reflektiert und der methodische Ansatz wird bewertet. Es werden auch Limitationen der Studie und mögliche Ansatzpunkte für zukünftige Forschungsarbeiten angesprochen.
Schlüsselwörter
Körperliche Aktivität, Wohlbefinden, habituelles Wohlbefinden, empirische Studie, Korrelationsanalyse, Beruf, Freizeit, Sport, Lebensqualität, Gesundheit, Online-Fragebogen.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Körperliche Aktivität und Wohlbefinden
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und habituellem Wohlbefinden bei Erwachsenen. Sie erforscht die Korrelation dieser beiden Variablen und betrachtet dabei die körperliche Aktivität in den Bereichen Beruf, Freizeit und Sport.
Welche Forschungsfragen und Hypothesen werden behandelt?
Die Arbeit formuliert eine zentrale Forschungsfrage und leitet daraus konkrete Hypothesen ab. Es wird untersucht, welche Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Arten körperlicher Aktivität (Beruf, Freizeit, Sport) und dem habituellen Wohlbefinden bestehen. Die Hypothesen basieren auf dem theoretischen Hintergrund und werden im empirischen Teil der Arbeit geprüft.
Welche Methoden wurden zur Datenerhebung und -auswertung verwendet?
Die Datenerhebung erfolgte mittels eines Online-Fragebogens, der im Vorfeld einem Pretest unterzogen wurde. Die Stichprobenbeschreibung wird detailliert dargestellt. Die Datenauswertung beinhaltet deskriptive und inferenzstatistische Verfahren, die im Detail erläutert werden. Die Auswahl der Methoden wird begründet und deren Eignung zur Beantwortung der Forschungsfrage dargelegt.
Welche Aspekte des Wohlbefindens werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte des Wohlbefindens, darunter die eudaimonische und hedonische Perspektive, Wohlbefinden als Dimension der Lebensqualität, Definitionen nach Diener, den Unterschied zwischen aktuellem und habituellem Wohlbefinden sowie das Vier-Faktoren-Modell nach Mayring.
Wie wird körperliche Aktivität in der Arbeit definiert und kategorisiert?
Körperliche Aktivität wird umfassend definiert und in die Bereiche Beruf, Freizeit und Sport unterteilt. Die Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen körperlicher Aktivität und Gesundheit wird beleuchtet, ebenso wie Empfehlungen zur sportlichen Aktivität und verschiedene Trainingsarten. Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Arten körperlicher Aktivität wird ausführlich behandelt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt und wie werden sie interpretiert?
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse deskriptiv und inferenzstatistisch. Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und im Kontext des aktuellen Forschungsstandes erläutert. Die Diskussion analysiert die Ergebnisse im Hinblick auf die Hypothesen, bewertet die Studie kritisch und nennt Limitationen sowie Ansatzpunkte für zukünftige Forschung.
Wie ist der Aufbau der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil behandelt Wohlbefinden, körperliche Aktivität und den Zusammenhang beider. Der empirische Teil umfasst Forschungsfrage, Hypothesen, Methodik, Datenauswertung, Ergebnisse und Diskussion. Die Einleitung und Zusammenfassung runden die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Körperliche Aktivität, Wohlbefinden, habituelles Wohlbefinden, empirische Studie, Korrelationsanalyse, Beruf, Freizeit, Sport, Lebensqualität, Gesundheit, Online-Fragebogen.
Welche Literatur wurde verwendet (implizite Frage)?
Die Arbeit bezieht sich auf den aktuellen Forschungsstand und zitiert relevante Studien und Theorien zu Wohlbefinden und körperlicher Aktivität. Konkrete Literaturangaben sind im vollständigen Text der Bachelorarbeit zu finden.
Wo finde ich den vollständigen Text der Bachelorarbeit?
Der vollständige Text der Bachelorarbeit ist [hier den Zugriff auf die Arbeit einfügen, z.B. Link zur Universitätsbibliothek oder Datenbank].
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Der Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und dem habituellen Wohlbefinden von Erwachsenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538649