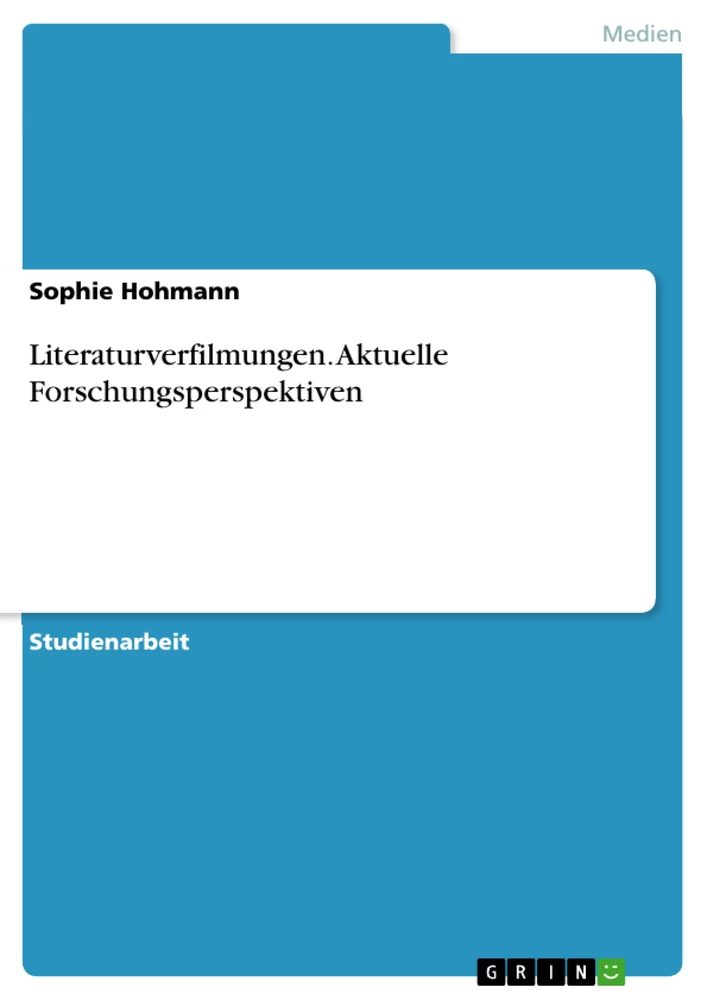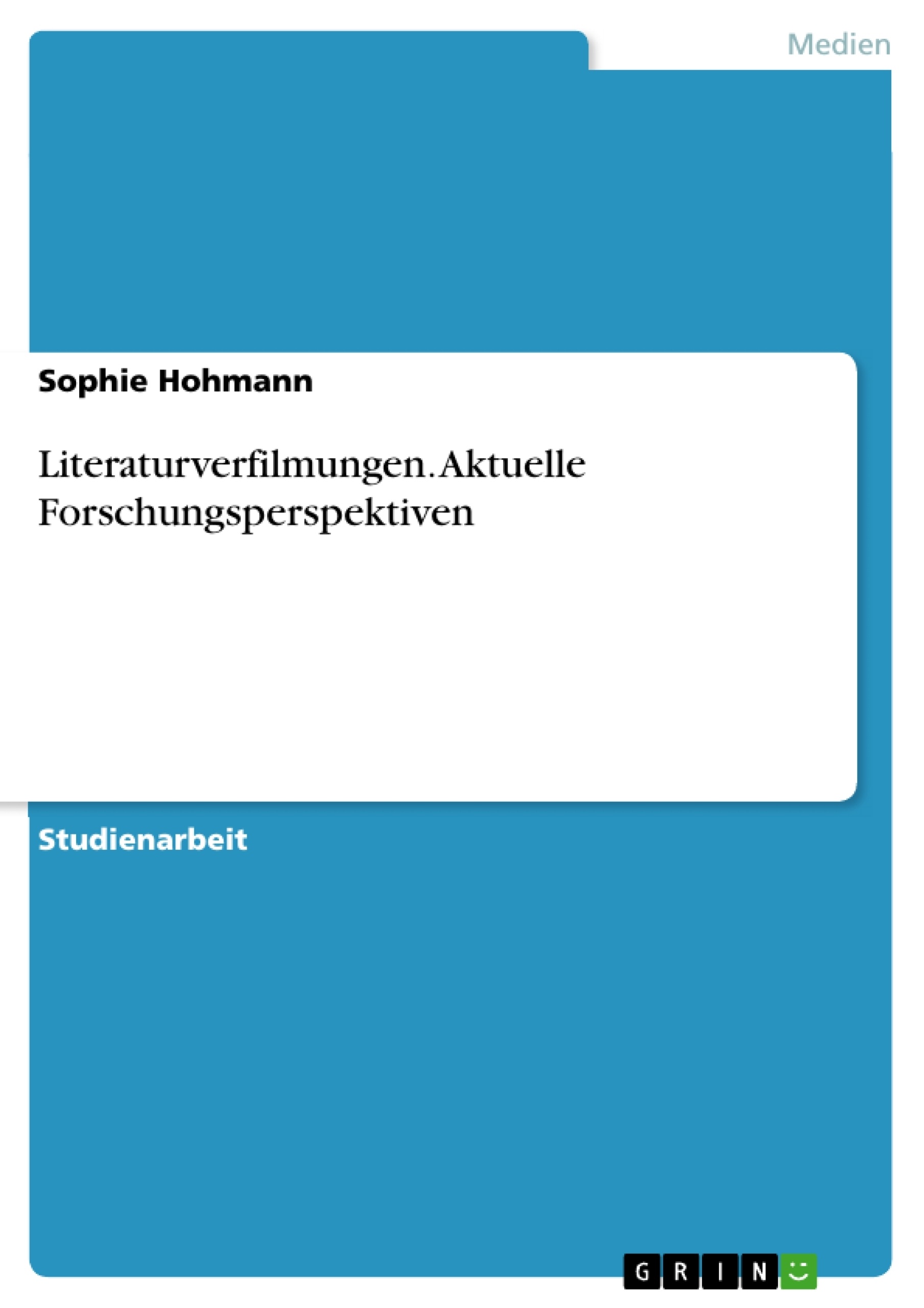Die vorliegende Arbeit bietet eine Übersicht aktueller Forschungsansätze zur Literaturverfilmung.
Inhalt:
- Von der Raumtheorie über kulturhistorische und rezeptionsgeschichtliche Zugänge bis hin zu narratologischen Ansätzen;
- Der Entwicklungsversuch eines medienübergreifenden Untersuchungsmodells für Literaturverfilmungen;
- Von der Rahmentheorie zu Intermedialitäts- und Adaptionsprozessen;
- Literarische Vorlage und filmische Transformation verschmelzen zu einem Produkt
Inhaltsverzeichnis
- Von der Raumtheorie über kulturhistorische und rezeptionsgeschichtliche Zugänge bis hin zu narratologischen Ansätzen
- Der Entwicklungsversuch eines medienübergreifenden Untersuchungsmodells für Literaturverfilmungen
- Von der Rahmentheorie zu Intermedialitäts- und Adaptionsprozessen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text analysiert verschiedene Ansätze und Modelle zur Untersuchung von Literaturverfilmungen. Er beleuchtet unterschiedliche methodische Zugänge und diskutiert die Herausforderungen des Medienwechsels. Der Fokus liegt auf der Analyse von Adaptionsprozessen und der Beziehung zwischen literarischer Vorlage und filmischer Umsetzung.
- Methodische Ansätze zur Analyse von Literaturverfilmungen
- Raumkonstruktion und deren semantische Effekte in Literatur und Film
- Intermedialität und Adaptionsprozesse
- Das Verhältnis von literarischer Vorlage und filmischer Transformation
- Entwicklung eines medienübergreifenden Vergleichsmodells
Zusammenfassung der Kapitel
Von der Raumtheorie über kulturhistorische und rezeptionsgeschichtliche Zugänge bis hin zu narratologischen Ansätzen: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene methodische Ansätze zur Analyse von Literaturverfilmungen. Es werden exemplarische Analysen vorgestellt, die Raumkonstruktionen, Ideologisierungsstrategien und das Verhältnis von Literatur und Film als „Medienverbund“ untersuchen. Die Beiträge beleuchten unterschiedliche Ebenen der Analyse, von der Vergleichbarkeit der Erzählung (Histoire) bis hin zu den spezifischen Ausdrucksmitteln (Discourse) von Film und Literatur. Dabei wird die Problematik des Medienwechsels und die Frage nach der Äquivalenz zwischen Vorlage und Verfilmung diskutiert. Die Analysen von Hochhuths "Der Stellvertreter" und Costa-Gavras' "Amen", Storms "Der Schimmelreiter" und Simmels "Und Jimmy ging zum Regenbogen" illustrieren die Vielfalt der methodischen Herangehensweisen. Die Bedeutung der Raumgestaltung und die Frage nach der Adaption bzw. Neuinterpretation des Originals werden in verschiedenen Beiträgen hervorgehoben.
Der Entwicklungsversuch eines medienübergreifenden Untersuchungsmodells für Literaturverfilmungen: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung eines funktional-strukturalistischen Vergleichsmodells für Literaturverfilmungen. Das Modell zielt darauf ab, literarische Vorlage und Verfilmung auf drei Ebenen (Struktur, Bedeutung, Sinn) und auf Histoire- und Discourse-Ebene zu vergleichen. Es wird eine quantitative Methode vorgestellt, um das Abstraktionsniveau der filmischen Adaption vom Original zu bestimmen. Die praktische Anwendung des Modells wird anhand von Kafkas "Der Prozess" und dessen Verfilmungen durch Welles und Jones demonstriert. Dabei werden die einzelnen Handlungselemente (Events) in der Vorlage und den Adaptionen analysiert und Transformationsprozesse wie Kürzungen, Ergänzungen und Umstellungen quantifiziert. Die Methode der Sequenzanalyse (Ö-V-E Schema) wird zur detaillierten Untersuchung der Transformationsprozesse eingesetzt.
Von der Rahmentheorie zu Intermedialitäts- und Adaptionsprozessen: Dieses Kapitel befasst sich mit Intermedialitäts- und Adaptionsprozessen in grafischer Literatur. Es werden intra- und paratextuelle Rahmungen, Rahmenbrüche und Rahmenwechsel als Instrumente der medialen Transformation diskutiert. Rahmen werden als kulturelle Konstrukte verstanden, die für das Verständnis von Literatur und anderen Medien entscheidend sind. Ein Medienwechsel wird als Prozess der medialen Übersetzung beschrieben, der neue Perspektiven eröffnet. Die Perspektive von Linda Hutcheon auf Adaption (formale Einheit, kreativer Prozess, Rezeptionsprozess) wird diskutiert, und die Komplexität des Adaptionsprozesses als dynamische Wechselbeziehung zwischen Ausgangswerk und Adaption wird hervorgehoben. Die Rolle von paratextuellen Elementen und Rahmenbrüchen zur Hervorhebung der medialen Transformation wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Literaturverfilmung, Adaption, Intermedialität, Medienwechsel, Transformationsanalyse, Raumtheorie, Rezeptionsgeschichte, Narratologie, Vergleichsmodell, Film lesen, Rahmentheorie, grafische Literatur, Äquivalenz, Histoire, Discourse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Literaturverfilmungen
Was ist der Gegenstand der Analyse in diesem Text?
Der Text analysiert verschiedene Ansätze und Modelle zur Untersuchung von Literaturverfilmungen. Er beleuchtet unterschiedliche methodische Zugänge und diskutiert die Herausforderungen des Medienwechsels. Der Fokus liegt auf der Analyse von Adaptionsprozessen und der Beziehung zwischen literarischer Vorlage und filmischer Umsetzung.
Welche methodischen Ansätze werden behandelt?
Der Text behandelt eine breite Palette methodischer Ansätze, darunter Raumtheorien, kulturhistorische und rezeptionsgeschichtliche Zugänge sowie narratologische Ansätze. Es wird ein funktional-strukturalistisches Vergleichsmodell entwickelt und die Bedeutung von Rahmentheorien und Intermedialität diskutiert.
Welche Ebenen werden im Vergleich von Literatur und Film betrachtet?
Der Vergleich erfolgt auf verschiedenen Ebenen: Struktur, Bedeutung und Sinn, sowie auf der Ebene der Erzählung (Histoire) und des Diskurses (Discourse). Ein entwickeltes Modell ermöglicht einen quantitativen Vergleich des Abstraktionsniveaus der filmischen Adaption vom Original.
Wie wird der Medienwechsel in der Analyse berücksichtigt?
Der Medienwechsel wird als komplexer Prozess der medialen Übersetzung beschrieben, der neue Perspektiven eröffnet. Die Problematik der Äquivalenz zwischen Vorlage und Verfilmung sowie die Rolle von intra- und paratextuellen Rahmungen, Rahmenbrüchen und Rahmenwechseln werden ausführlich diskutiert.
Welches Vergleichsmodell wird vorgestellt?
Es wird ein funktional-strukturalistisches Vergleichsmodell entwickelt, das einen dreistufigen Vergleich (Struktur, Bedeutung, Sinn) auf Histoire- und Discourse-Ebene ermöglicht. Die Anwendung des Modells wird anhand von Beispielen wie Kafkas "Der Prozess" und dessen Verfilmungen illustriert. Die Methode der Sequenzanalyse (Ö-V-E Schema) wird zur detaillierten Untersuchung der Transformationsprozesse eingesetzt.
Welche Beispiele werden in der Analyse verwendet?
Die Analyse bezieht sich auf diverse Beispiele, darunter Hochhuths "Der Stellvertreter" und Costa-Gavras' "Amen", Storms "Der Schimmelreiter" und Simmels "Und Jimmy ging zum Regenbogen", sowie Kafkas "Der Prozess" und dessen Verfilmungen durch Welles und Jones. Zusätzlich wird die Intermedialität und Adaption in grafischer Literatur behandelt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Literaturverfilmung, Adaption, Intermedialität, Medienwechsel, Transformationsanalyse, Raumtheorie, Rezeptionsgeschichte, Narratologie, Vergleichsmodell, Film lesen, Rahmentheorie, grafische Literatur, Äquivalenz, Histoire, Discourse.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in drei Kapitel: "Von der Raumtheorie über kulturhistorische und rezeptionsgeschichtliche Zugänge bis hin zu narratologischen Ansätzen", "Der Entwicklungsversuch eines medienübergreifenden Untersuchungsmodells für Literaturverfilmungen" und "Von der Rahmentheorie zu Intermedialitäts- und Adaptionsprozessen". Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen methodischen Ansätze und Beispiele.
- Quote paper
- Sophie Hohmann (Author), 2019, Literaturverfilmungen. Aktuelle Forschungsperspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/538141