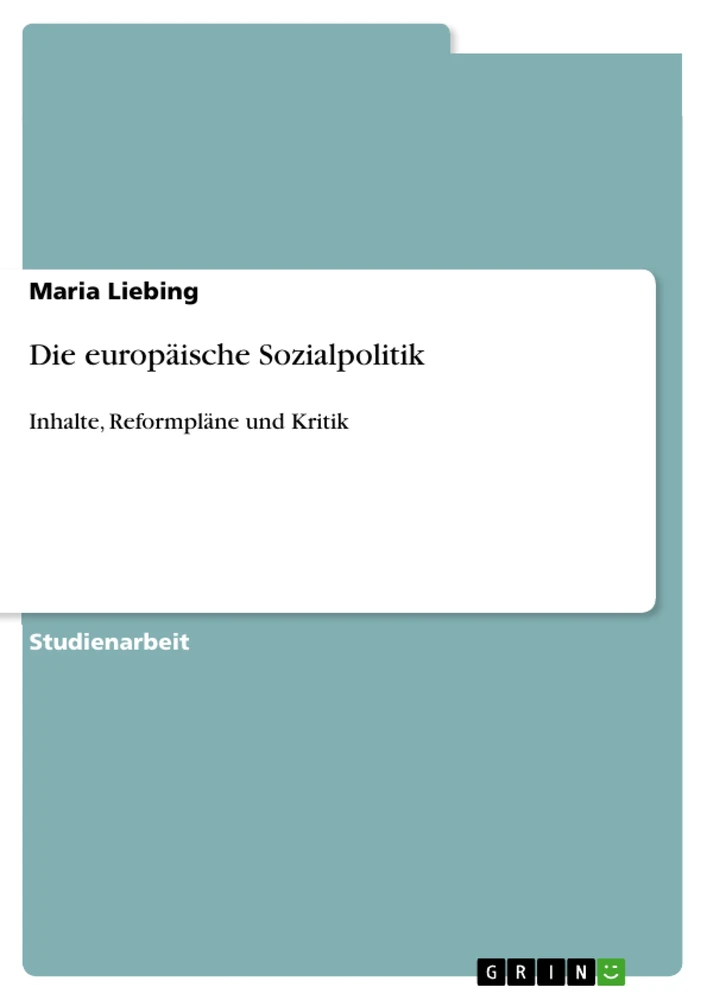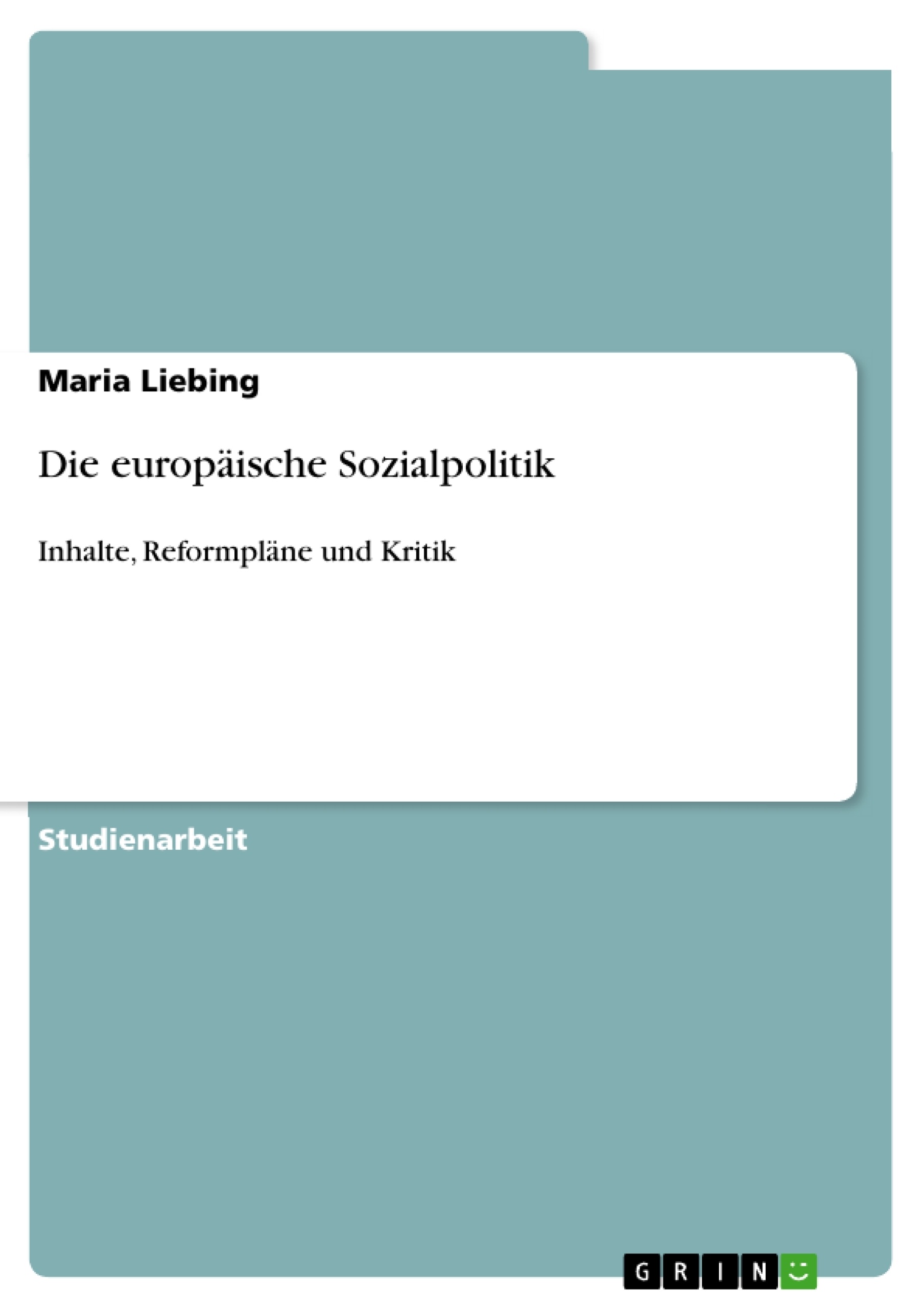Schaut man sich die derzeitige Lage in der EU an, so nehmen statt dem Zusammenhalt eher die Spannungen zu. Dies wurde zuletzt besonders durch den Brexit sowie durch das Erstarken rechtspopulistischer Parteien deutlich. Man kann sagen, dass sich die EU in einer Krise befindet. Angesichts der aktuellen Krise sowie bestehender sozialer Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in Bezug auf die Lebensumstände der Menschen in den jeweiligen Mitgliedsländern, kommt man nicht umhin einen Blick auf die europäische Sozialpolitik zu werfen. Diese Arbeit stellt dar, was die europäische Sozialpolitik genau ausmacht und welche Reformpläne aktuell bestehen. Dabei werden auch aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne in die Kritik genommen.
Vorab ist festzuhalten, dass die wesentlichen Aufgaben und Inhalte der EU und der europäischen Politik wirtschaftlicher Natur sind und nicht im Bereich Soziales liegen. Die EU stellt, nach wie vor, eine Wirtschafts- und Währungsunion mit dem Schwerpunkt des Binnenmarktes dar. Auch wenn eine soziale Ausrichtung und damit verbundene Sozialpolitik auf den Weg gebracht und notwendig ist, so stellt diese nicht den Kern der EU-Politik dar. Die soziale Sicherung stellt damit eher ein Nebenprodukt, resultierend aus den wirtschaftlichen Bestrebungen, dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Europäische Sozialpolitik - Definition und Inhalte
- Von einer europäischen, ja supranationalen Sozialpolitik kann gem. der o.g. Definition(en) nicht gesprochen werden, da die Sozialpolitik nach wie vor in den Händen der jeweiligen Mitgliedsstaaten liegt. (vgl. Ammann 2017, S. 25) Grundlage hierfür ist das (umstrittene) Subsidiaritätsprinzip und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gem. Art. 5 EUV. Diese Prinzipien besagen, dass die EU nur eingreifen darf, wenn die sozialpolitischen Ziele auf nationaler Ebene nicht erreicht werden können und dass das Eingreifen nur jene Maßnahmen umfassen darf, welche zur Erreichung des jeweiligen Ziels erforderlich sind. Demnach bleibt die Ausgestaltung der Sozialpolitik in den Hän-den der Mitgliedsstaaten. Dies schließt jedoch verbindliche Grundsätze, wie die Umsetzung der EU-Grundrechtecharta sowie grundlegende verbindliche Standards für alle Mitgliedsstaaten aus. (vgl. Ammann 2017, S. 29). Trotz der Übereinkunft die sozialen Risiken, welche mit den Grund-freiheiten wie der Freizügigkeit und dem bestehenden Binnenmarkt verbunden sind, zu regulieren, wurde eine europäische soziale Sicherung nur auf dem Papier festgehalten. Die soziale Sicherung in der EU wurde bisher vor allem durch die Verankerung sozialer Rechte vorangetrieben. Dazu zählen die EU-Grundrechtecharta, der Amsterdamer Vertrag, eine große Zahl an Einzelre-gelungen sowie Rechtsprechungen durch den Europäischen Gerichtshof. (vgl. Dietz/Frevel/Toens 2015, S. 188ff.) Positiv zu vermerken ist das Inkrafttreten der EU-Grundrechtecharta. Jedoch hat diese keine unmittelbare Auswirkung auf den Rechtsschutz der einzelnen EU-Bürger*innen. Die Grundrechtecharta bildet demnach lediglich den Rahmen für die zukünftige Ausgestaltung der eu-ropäischen Sozialpolitik. Ähnlich verhält es sich mit den weiteren rechtlichen Regelungen. So wer-den diese in den jeweiligen Mitgliedsstaaten unterschiedlich ausgelegt und umgesetzt. Auch hier kann nur von einer rechtlichen Grundlage für die weitere sozialpolitische Ausrichtung gesprochen werden. (vgl. Dietz/Frevel/Toens 2015, S. 186ff.) In der Realität kommt diese Sicherung demnach nur eingeschränkt zum Tragen. Durch den Vertrag von Lissabon wurde der europäischen Sozialpolitik mehr Bedeutung beigemessen, jedoch ohne diese mehr in die Zuständigkeit der EU zu verlagern. Somit bleibt ein tatsächlicher Wandel aus. (vgl. Dietz/Frevel/Toens 2015, S. 185) Euro-päische Sozialpolitik bleibt demnach „unterentwickelt“, wie von Kohler-Koch u.a. formuliert. (vgl. Kohler-Koch u.a. 2002, S. 184f. zit. n. Dietz/Frevel/Toens 2015, S. 196). Vielmehr lässt sich sagen, dass die europäische Sozialpolitik darin besteht, die Sozialpolitik der Nationalstaaten zu unterstützen und zu fördern sowie Empfehlungen für diese auszusprechen. (vgl. Dietz/Fre-vel/Toens 2015, S. 204)
- Schmidt sieht die Problematik in der Institution EU. So formuliert er eine „strukturelle Blockade sozialpolitischer Aktivitäten“ und resümiert, dass alle Maßnahmen der EU [...] bislang bruchstückhaft geblieben [sind].\" (Schmid 2002, S. 445 zit. n. Dietz/Frevel/Toens 2015, S. 196). Wie lässt sich dies erklären? Wie Schmid bereits formulierte, blockiert sich die EU auf institutioneller Ebene selbst. Eine Schwierigkeit besteht bereits darin, dass die EU keine Staatsform ist und durch die Allparteienregierung auch ein klares Profil. Demnach fällt (trotz vielfältiger Bemühungen) auch die Identifizierung der EU-Bürger*innen mit der EU nur schwach aus. Daraus folgt wiederum eine nur geringe Solidarität und soziale Verantwortung unter den Mitgliedsstaaten. Es fehlt ein „Wir“-Gefühl. Sozialpolitik muss jedoch von den Bürger*innen mitgetragen werden. Däubler bezeichnet diese Notwendigkeit als ein „Europa von unten“ (Däubler 2002, S. 487 zit. n. Dietz/Frevel/Toens 2015, S. 205). Durch die Ausrichtung als Wirtschafts- und Währungsunion stehen zudem nur geringe finanzielle Mittel für die Sozialpolitik bereit für die notwendigen Umverteilungsmaßnahmen. Hinzu kommt durch die eingeschränkte Gewaltenteilung und die Multilateralität eine stark verlangsamte Politik und damit eine Behinderung zügiger Reformen. Weitere Punkte ist die schwache Verhandlungsposition von Gewerkschaften in der EU sowie die schwache Position der Mitwirkungsorgane. (vgl. Dietz/Frevel/Toens 2015, S. 201f.)
- Hinzu kommt, dass die Grundausrichtung der EU nach wie vor zu diskutieren ist. Aktuell lassen sich drei Ausrichtungen feststellen: das konföderationale, das supranationale sowie das föderalistische Lager.
- Je nach Lager werden die Eingriffe der EU in die Sozialpolitik abgelehnt oder befürwortet. Ohne eine klare Richtung und Ausprägung der EU-Politik, bleibt auch die europäische Sozialpolitik unscharf. (vgl. Dietz/Frevel/Toens 2015, S. 203)
- Politische Reformpläne
- Neben der EU-Grundrechtecharta gibt es Reformpläne in Bezug auf ein gemeinsames europäisches Sozialmodell. Gewissermaßen die Erweiterung der EU von der Wirtschaftsunion zu einer Wirtschafts- und Sozialunion. Eine Rechtsverbindlichkeit der EU-Grundrechtecharta für alle Mitgliedsstaaten und eine verbindliche einheitliche EU-Sozialpolitik sind jedoch ein kühnes Unterfangen. Die grundlegende Problematik ergibt sich insbesondere aus der Anzahl bzw. Vielzahl und Heterogenität der Mitgliedsstaaten. So sind sozialpolitische Inhalte vor allem abhängig von dem Sozialstaatstypus, der Wirtschaftskraft, den regionalen sozialen Problematiken und den kulturellen Ansichten der jeweiligen Mitgliedsstaaten. (vgl. Dietz/Frevel/Toens 2015, S.185ff.) So würde mit der Einführung einer einheitlichen Sozialpolitik und der damit verbundenen Angleichung der Lebensstandards die Gefahr bestehen die hohen Sozialleistungen in Wohlfahrtsstaaten wie bspw. Dänemark zu reduzieren, was einem Sozialabbau gleichkäme und Länder mit bisher nur geringen Grundsicherungsleistungen durch die dazu notwendigen aufkommenden Sozialkosten (wirtschaftlich) zu überfordern. Problematisch ist auch, dass diese Reform nicht an den zugrundeliegenden Ursachen ansetzt. Unwahrscheinlich macht eine solche einheitliche Sozialpolitik ebenfalls die bestehende Politik mit ihrer demokratischen Parteienlandschaft. Die Inhalte der Sozialpolitik stellen eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der verschiedenen Parteien da und sind für deren Wahlkampf entscheidend. Es ist kaum vorstellbar, dass sich die Parteien auf eine solche Vereinheitlichung einlassen würden. (vgl. Dietz/Frevel/Toens 2015, S.198) Die Idee einer Festlegung sozialer Mindeststandards, wie durch die Grundrechtecharta erfolgt, waren meiner Ansicht nach ein guter Anfang in Richtung einer europäischen Sozialpolitik. Leider hat diese bis jetzt nur Vorbildcharakter und eine eher empfehlende Wirkung. Eine konkrete harmonisierende EU-weite soziale Mindestsicherung, besonders in den Ländern mit bisher geringem sozialem Schutz, ist leider nicht erfolgt. (vgl. Dietz/Frevel/Toens 2015, S.199)
- Einen politischen Reformplan stellt das Wirtschaftsprogramm „Europa 2020“ dar. Auch wenn es sich dabei in erster Linie um eine Wirtschaftsreform handelt, so beinhaltet diese doch auch einige sozialpolitische Elemente. Einen Schwerpunkt betrifft die soziale Eingliederung, welche beschrieben wird mit: \"intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum\". Die sozialpolitischen Kernziele sind u.a. die Anhebung der Beschäftigungsquote, der Anstieg von Bildungsabschlüssen sowie die Reduzierung von EU-Bürger*innen, welche von Armut oder Ausgrenzung bedroht sind. Zusätzlich sollen die einzelnen Mitgliedstaaten weitere nationale Ziele festlegen.
- Dazu wurden Leitinitiativen wie bspw. „Jugend in Bewegung“, \"Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten\" und \"Plattform gegen Armut\" erarbeitet. (vgl. BMUB 2010) Kritiker sehen die gesetzten Ziele als zu hoch und zu langfristig an. Vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung in Europa, braucht es kurzfristige Ziele und Lösungen, so der ehem. EGB-Generalsekretär John Monks. (vgl. EURACTIV.de 2010)
- Einen weiteren Reformplan stellt die „offene Methode der Koordinierung“ dar. Hierbei handelt es sich um ein Instrument, welches enormen Einfluss auf die Sozialpolitik hat. Diese Reform soll der bereits dargelegten Heterogenität der Mitgliedsstaaten Rechnung tragen und soll die rechtliche Verbindlichkeit der EU stärken. Dies gelingt indem die Ausgestaltung konkreter Maßnahmen in Hand der Nationalstaaten liegt, aber gleichzeitig auch die Qualität und Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen gefördert wird. Ein weiteres Ziel ist die Anpassung und Koordination der jeweiligen Sozialsysteme. Letztlich sollen durch diese Prozesse die passendsten sozialpolitischen Maßnahmen ermittelt werden. Die Aufgabe der EU besteht dabei in der Projektbewilligung, finanziellen Förderung und Unterstützung sowie der Überwachung. (vgl. Dietz/Frevel/Toens 2015, S.202f.) Zunächst werden sogenannte „guidelines“ festgelegt. Gemeint sind sozialpolitische Ziele. Zu diesen Zielen erhalten die Mitgliedsstaaten qualitative Leitlinien und einen Zeitplan, in welchem die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele realisiert werden sollen. Es folgt das „benchmarking“. Hierbei werden die Kriterien zur Zielerreichung festgelegt, um später mittels dieser qualitativen und quantitativen Indikatoren Vergleiche zwischen den Mitgliedsländern vornehmen zu können. Anschließend folgt die Realisierung der Ziele und Leitlinien in den jeweiligen Mitgliedsländern unter Berücksichtigung der jeweiligen regionalen Besonderheiten und Herausforderungen. Das „,monitoring“ bildet die Schlussphase. Die Umsetzung in den Mitgliedsstaaten wird hierbei regelmäßig kontrolliert, bewertet, evaluiert sowie einem peer review unterworfen. Zum Schluss erfolgt ein Vergleich und Erfahrungsaustausch. Zudem sollen durch den Austausch über die ggf. entstandenen best practice Modelle weitere Anregungen geschaffen werden. Durch diesen Prozess sind die Nationalstaaten in der Verpflichtung ihre Projekte und Maßnahmen zu entwicklen. (vgl. Althammer/Lampert 2014, S. 394)
- Weitere sozialpolitische Reformimpulse wurden seitens der Vertreter von acht Think Tanks und Stiftungen mit der Konferenz-Erklärung „Redesigning European Welfare States: A Time for Action“ vorgelegt. Es handelt sich hierbei insbesondere um Reformen wie dem Abbau von Ungerechtigkeiten und Barrieren, dem Einsatz von Social Investments sowie Impulsen bzgl. der EU und der Nationalstaaten selbst. (vgl. Ammann 2017, S. 28)
- Definition und Inhalte der europäischen Sozialpolitik
- Kritik an der begrenzten Wirksamkeit der europäischen Sozialpolitik
- Politische Reformpläne und ihre Implementierung
- Herausforderungen und Perspektiven der europäischen Sozialpolitik
- Zusammenhang von Wirtschafts- und Sozialpolitik in der EU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk analysiert die europäische Sozialpolitik, beleuchtet ihre Inhalte, Reformansätze und die damit verbundenen Herausforderungen. Es untersucht, wie die EU die Lebensbedingungen der Menschen in den Mitgliedsstaaten verbessern kann und welche strukturellen Hürden es auf diesem Weg gibt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der aktuellen Lage in der EU und dem Zusammenhang zwischen der europäischen Sozialpolitik und den Herausforderungen, die sich aus den bestehenden sozialen Ungleichheiten und Spannungen ergeben. Es wird deutlich, dass die EU-Politik stark auf die Wirtschafts- und Währungsunion ausgerichtet ist, während die soziale Dimension eher als Nebenprodukt betrachtet wird.
Das Kapitel „Europäische Sozialpolitik - Definition und Inhalte“ stellt die wesentlichen Inhalte und Ziele der europäischen Sozialpolitik vor. Es beleuchtet das Arbeitsrecht, die Beschäftigungspolitik und die Gleichstellungspolitik, die im Zentrum des europäischen Sozialmodells stehen.
Das folgende Kapitel befasst sich mit der strukturellen Problematik der europäischen Sozialpolitik. Es werden die Gründe dafür analysiert, warum eine umfassende supranationale Sozialpolitik in der EU bislang nicht realisiert werden konnte. Die Analyse fokussiert auf die Rolle des Subsidiaritätsprinzips, die begrenzte Identifikation der EU-Bürger*innen mit der EU sowie die fehlende Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten.
Im Kapitel über politische Reformpläne werden verschiedene Ansätze vorgestellt, wie die europäische Sozialpolitik weiterentwickelt werden könnte. Es werden das Wirtschaftsprogramm „Europa 2020“ sowie die „offene Methode der Koordinierung“ als bedeutende Reformpläne dargestellt und ihre Stärken und Schwächen analysiert. Darüber hinaus werden weitere Reformimpulse von Think Tanks und Stiftungen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Europäische Sozialpolitik, Sozialpolitik, EU, Mitgliedsstaaten, Subsidiaritätsprinzip, soziale Sicherung, Arbeitsrecht, Beschäftigungspolitik, Gleichstellungspolitik, Reformpläne, Wirtschafts- und Sozialunion, Europa 2020, offene Methode der Koordinierung, Social Investments, Ungleichheit, Armut, Ausgrenzung, Solidarität.
- Quote paper
- Maria Liebing (Author), 2017, Die europäische Sozialpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537661