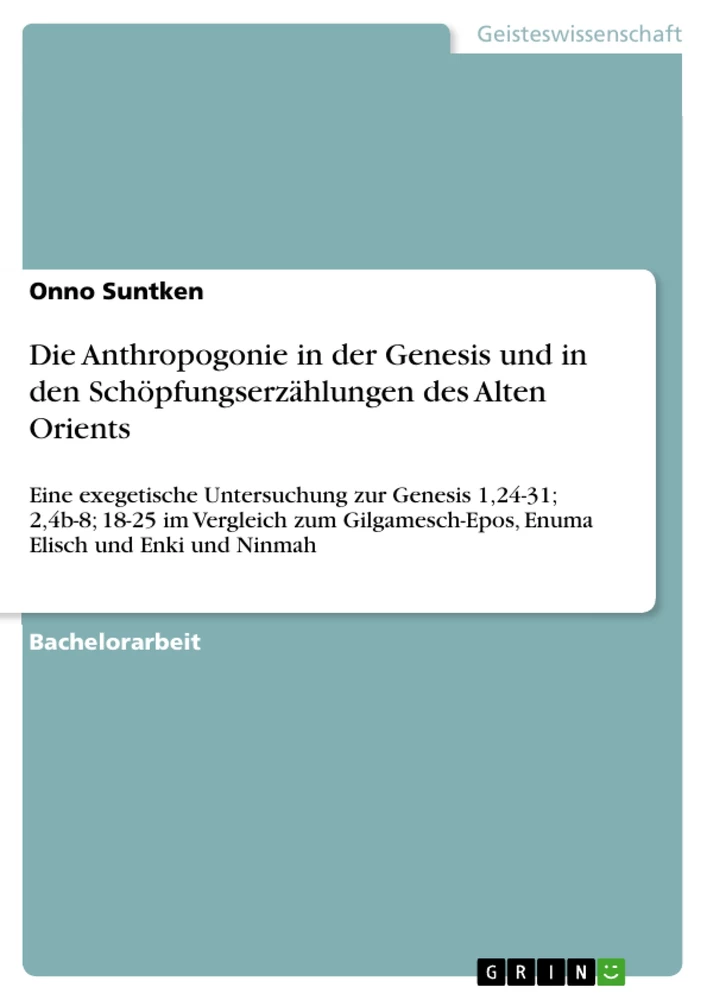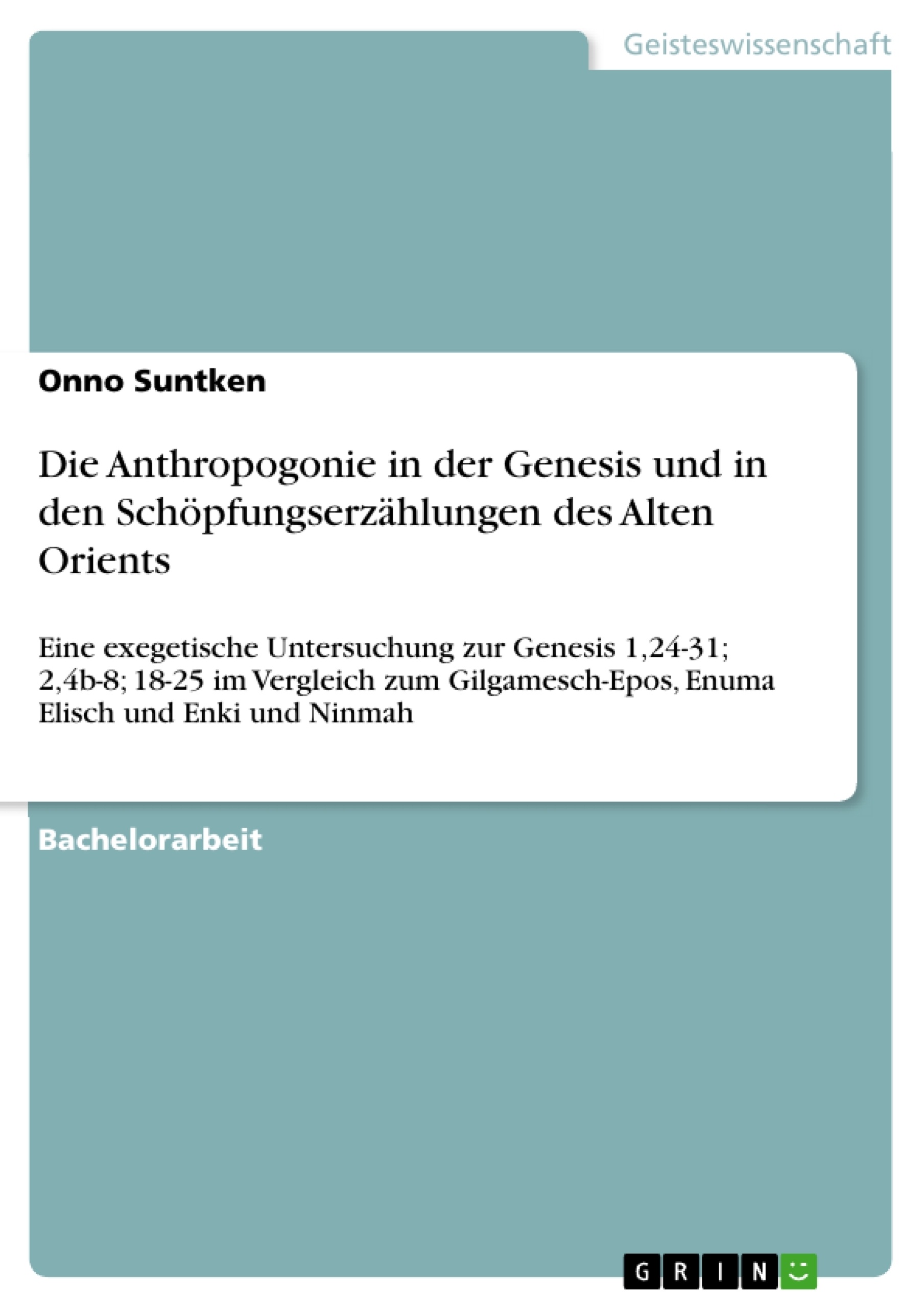Die Frage nach dem Beginn der Menschheit beschäftigt uns schon immer. In den verschiedensten Feldern wird diese aufgenommen und bearbeitet. Seien es Naturwissenschaften, die sich mit unseren Vorfahren auseinandersetzen oder Literatur, Film und Kunst, die diesem Aspekt mit kreativen, expressionistischen Ideen nachgehen. Die nach wie vor bekannteste Antwort stammt aus der Bibel, aus der Genesis.
Im Rahmen dieser Arbeit werde ich nicht die Frage bearbeiten, woher der Mensch kommt oder wohin er geht, sondern Ziel meiner Bachelorarbeit ist es, herauszufiltern, wo die Textstelle ihre Wurzeln hat. Durch einen Vergleich mit älteren Schöpfungserzählungen aus dem räumlichen Umkreis der Genesis , dem altorientalischen Mesopotamien, werde ich herausfinden, welche äußeren Einflüsse die Entstehung der Schöpfungsgeschichte mitbestimmt und gelenkt haben. Letztlich werde ich überprüfen, wie sich diese Erkenntnisse auf die Aussage des Textes auswirken und ob dies möglicherweise sogar Einfluss auf das biblische Gottesbild hat. Im Fazit werde ich auch auf mein persönliches Gottesbild zu sprechen kommen.
Ich werde mich neben den Perikopen Gen 1, 24-31; 2,4b-8 und 2,18-25 besonders auf drei außerbiblische Schöpfungsmythen beziehen. In unterschiedlicher Abstufung werde ich den akkadischen Gilgamesch-Epos, den sumerischen Mythos um Enki und Ninmah und die babylonisch-mesopotamische Schöpfungsgeschichte Enuma Elisch in Beziehung zu der Schöpfungsgeschichte der Genesis setzen. Dazu ist jedoch eine exegetische Untersuchung der entsprechenden Perikopen selbst notwendig, womit ich in den ersten Kapiteln beginne. Als Grundlage werde ich die Perikopen abgrenzen, sowie eine sprachliche Analyse durchführen, um ein Fundament für den späteren Vergleich zu schaffen. Auch die Schöpfungserzählungen des Alten Orients werde ich zunächst kurz darlegen, bevor der Vergleich mit der Schöpfung in der Genesis die Arbeit abschließt.
Zwar werde ich zur Bearbeitung auch Sekundärliteratur, Wörterbücher und Konkordanzen zu Hilfe nehmen, jedoch fußt meine Arbeit besonders auf dem selbstständigen Vergleich der Texte, weshalb sich die Verwendung von Sekundärliteratur in Grenzen hält. Der Fokus meiner Arbeit liegt auf der linguistischen Bearbeitung des Quellenmaterials.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abgrenzung der Perikopen
- Sprachlich-sachliche Analyse
- Linguistische Analyse
- Genesis 1,24-31
- Genesis 2,4b-8
- Genesis 2,18-25
- Sozialgeschichtliche, historische Fragen und Realienkunde
- Genesis 1,24-31
- Genesis 2,4b-8
- Genesis 2,18-25
- Linguistische Analyse
- Motiv und Traditionskritik
- Religionsgeschichtlicher Vergleich
- Datierung und Darstellung der Schöpfungserzählungen des Alten Orients
- Das Gilgamesch-Epos
- Enki und Ninmah
- Enuma Elisch
- Inhalt der Schöpfungserzählungen des Alten Orients
- Der Gilgamesch-Epos
- Enki und Ninmah
- Enuma Elisch
- Die Anthropogonie der Schöpfungserzählungen des Alten Orients
- Das Gilgamesch-Epos
- Enki und Ninmah
- Enuma Elisch
- Vergleich und textpragmatische Analyse
- Fazit
- Verzeichnis der verwendeten Quellen und Literatur
- Quellen
- Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Genesis und ihre Schöpfungsgeschichte im Vergleich zu Schöpfungserzählungen des Alten Orients. Ziel ist es, die Ursprünge und Einflüsse der Genese-Texte im Kontext altorientalischer Mythen herauszuarbeiten. Die Arbeit analysiert die sprachlichen und historischen Bezüge der Genesis-Perikopen Gen 1, 24-31; 2,4b-8 und 2,18-25 im Vergleich zum Gilgamesch-Epos, Enki und Ninmah sowie Enuma Elisch, um die Entstehung der Schöpfungsgeschichte im Spannungsfeld zwischen altorientalischer Tradition und biblischer Eigenständigkeit zu beleuchten. Die Arbeit soll zeigen, wie die Genesis die Schöpfungsgeschichte in ihren spezifischen Kontext einbetten konnte, ohne dabei die Bedeutung altorientalischer Vorbilder zu ignorieren.
- Sprachliche und historische Analyse der Genesis-Perikopen
- Vergleich mit Schöpfungserzählungen des Alten Orients
- Rekonstruktion der Einflüsse altorientalischer Traditionen auf die Genese
- Die Rolle der Schöpfungsgeschichte im biblischen Gottesbild
- Das Verhältnis von altorientalischer und biblischer Schöpfungstheologie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer genauen Abgrenzung der drei relevanten Perikopen aus der Genesis und legt somit den Grundstein für die weitere Analyse. Es folgt eine sprachliche Analyse der Genese-Texte, welche die linguistischen Besonderheiten und die Bedeutung der verwendeten Sprache beleuchtet. Im Anschluss werden sozialgeschichtliche Aspekte, historische Fragen und Realienkunde der einzelnen Perikopen diskutiert.
Das dritte Kapitel widmet sich der Motiv- und Traditionskritik der Genesis-Perikopen. Hier werden wichtige Motive und Themen der Texte sowie deren mögliche Verbindungen zu literarischen Traditionen aus der altorientalischen Welt betrachtet.
Der Kern der Arbeit liegt im religionsgeschichtlichen Vergleich. Hier werden die Schöpfungserzählungen des Alten Orients, insbesondere das Gilgamesch-Epos, Enki und Ninmah sowie Enuma Elisch, in Bezug auf ihre Datierung, Darstellung und Inhalte vorgestellt.
Anschließend folgt eine vergleichende Analyse der Schöpfungserzählungen des Alten Orients, die die anthropogonischen Elemente der einzelnen Texte beleuchtet. Abschließend erfolgt ein Vergleich der Genesis-Perikopen mit den altorientalischen Schöpfungserzählungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Schöpfungstheologie und der Anthropogonie. Es werden wichtige Schlagwörter wie Genesis, Schöpfungsgeschichte, Altorient, Gilgamesch-Epos, Enki und Ninmah, Enuma Elisch, sprachliche Analyse, sozialgeschichtliche Aspekte, Motiv- und Traditionskritik sowie Religionsgeschichte behandelt.
- Quote paper
- Onno Suntken (Author), 2018, Die Anthropogonie in der Genesis und in den Schöpfungserzählungen des Alten Orients, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/537092