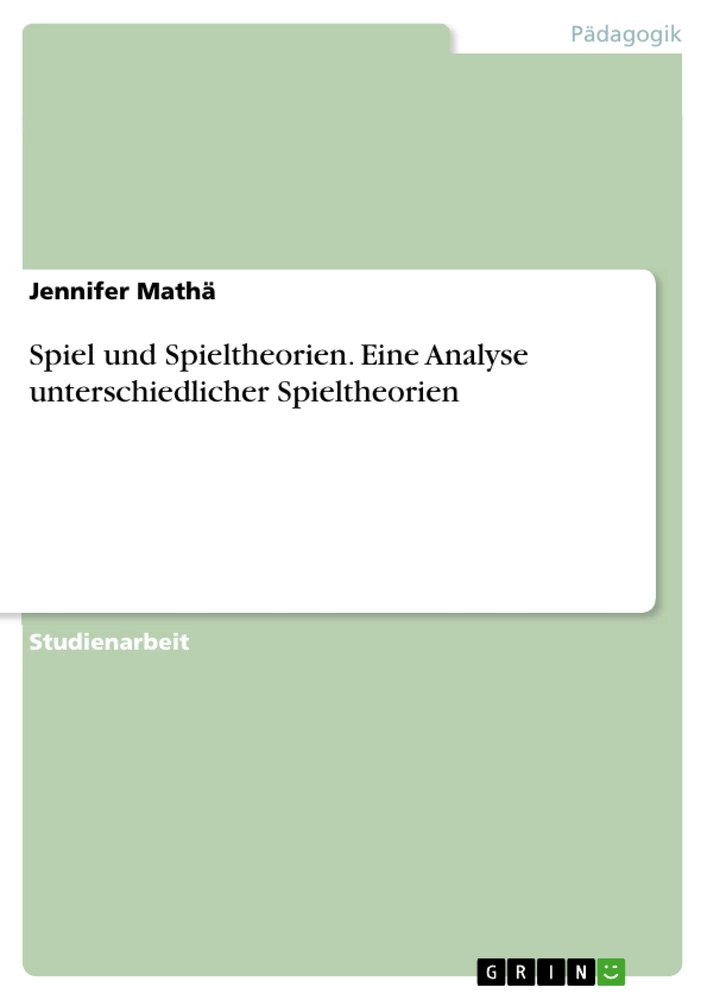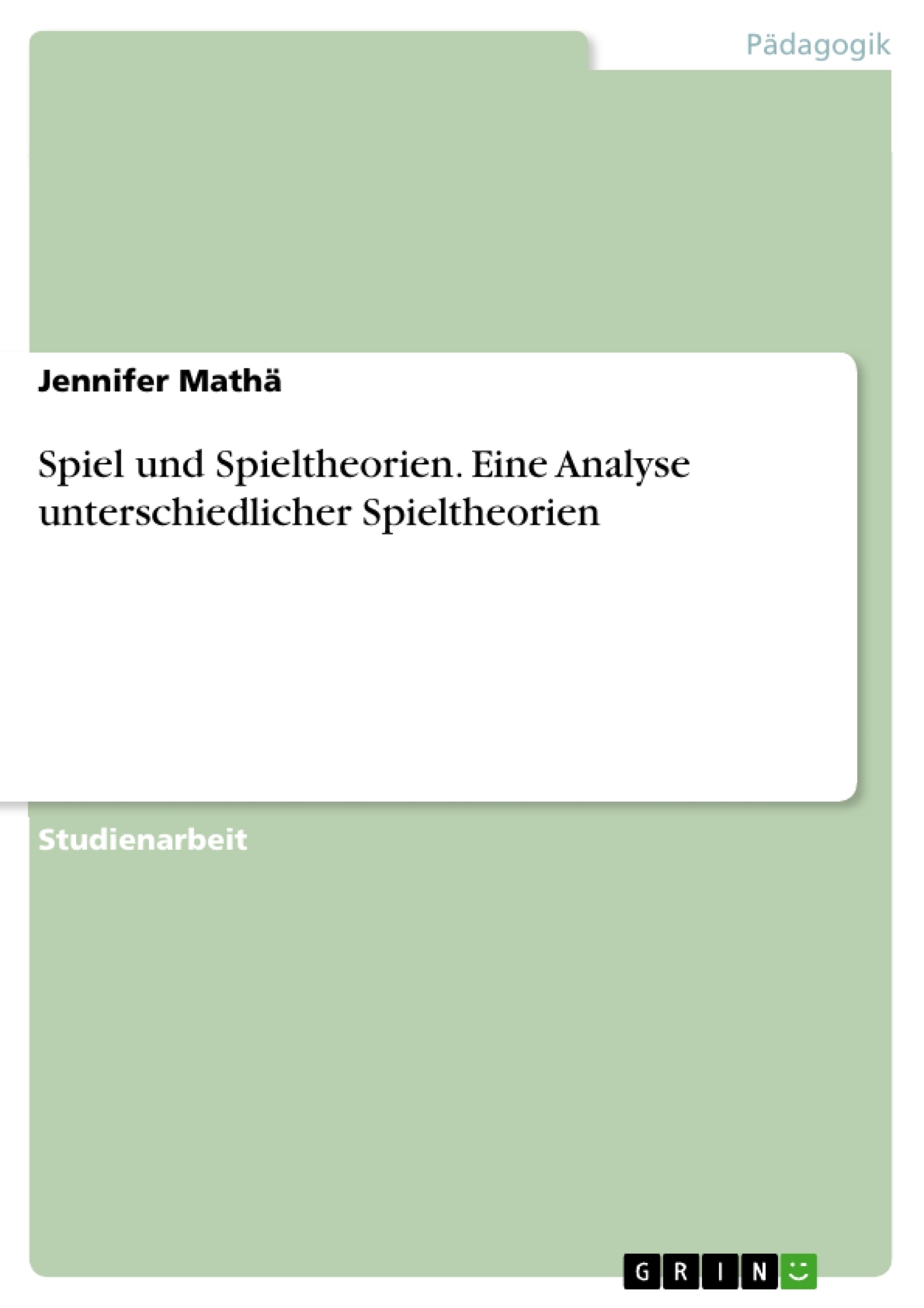„Das Kinderspiel ist eine zu auffällige Erscheinung aller Zeiten und Kulturen, als daß die Menschen es nicht von jeher hätten wahrnehmen müssen.“ (Flitner 2009)
Das Kinderspiel hatte schon immer einen Platz in der Gesellschaft. So wird es beispielsweise in der bildenden Kunst dargestellt und in der Literatur beschrieben. Schon die Ägypter im Alten Reich zeigten auf ihren Bildern Puppen, Spieltiere, Bälle und Kinder die miteinander tanzen, zusammen hüpfen und Theaterszenen spielen während sie Masken dazu tragen. Dies sind Beweise dafür, dass das Kinderspiel schon damals nicht nur als Lebenserscheinung dargestellt, sondern auch durch Spielzeug unterstützt wurde. Während in der vorindustriellen Gesellschaft Kinder auch an den Spielen der Erwachsenen teilgenommen haben, entstand im Industriezeitalter eine moderne pädagogische Reflexion in der die Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse und die Entwicklung der Kinder gerichtet wurde. „Kindheit blieb nun nicht mehr das Selbstverständlich-Unauffällige, das einfache Mitleben der jungen Generation; sie wurde vielmehr ein Gegenstand des Nachdenkens und der bewußten Fürsorge.“ (Flitner 2009). Flitner deutet das neue Verständnis von Kindheit an. Kindheit ist nicht nur ein Durchgangsstadium zum Erwachsenwerden, sondern hat es verdient, als eigenständige, wichtige Phase des Lebens betrachtet zu werden.
Dieser Wandel führt zu einer Pädagogik und einer Erziehungslehre in den neuen Institutionen, der im 18. Jahrhundert beginnt und bis heute scheinbar immer noch nicht abgeschlossen ist. Aufgrund dieses Prozesses, entsteht auch ein immer größer werdendes Interesse am kindlichen Spiel und die Beschäftigung mit dem Phänomen Spiel. In dieser Ausarbeitung wird der Fokus auf das Thema Spiel und Spieltheorien gerichtet. Ziel ist es, einen Überblick über das Thema zu erlangen.
Im Folgenden wird zunächst auf die früheren Spieltheorien eingegangen. Hierbei werden nicht alle bestehenden Theorien beschrieben. Die Theorien von Fröbel und Groos werden stellvertretend für viele andere tiefergehend betrachtet. Anschließend wird der Blick auf die moderne Erforschung des Spiels gerichtet. Stellvertretend werden hier Hassenstein, Scheuerl, Hutt und Piaget beschrieben.
Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung des doch sehr umfangreichen Themas mit kurzem Ausblick auf weitere Spieltheorien.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frühere Spieltheorien
- Moderne Erforschung des Spiels
- Phänomenologie des Spiels
- Phänomenologie des Spiels - Bernhard Hassenstein
- Phänomenologie des Spiels – Hans Scheuerl
- Entwicklungspsychologie und Lernforschung
- Entwicklungspsychologie und Lernforschung – Corinne Hutt
- Entwicklungspsychologie und Lernforschung – Jean Piaget
- Phänomenologie des Spiels
- Fazit
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit dem Thema Spiel und Spieltheorien und zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die Entwicklung und die wichtigsten Aspekte des Spiels zu liefern. Dabei werden sowohl frühere Spieltheorien als auch moderne Forschungsansätze beleuchtet, um ein tieferes Verständnis für das Phänomen des Spiels zu entwickeln.
- Die historische Entwicklung des Spiels und seiner Bedeutung für die Gesellschaft
- Die verschiedenen Ansätze und Interpretationen des Spiels in der Pädagogik und Psychologie
- Die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung und das Lernen
- Die Rolle des Spiels in der modernen Gesellschaft und seine Bedeutung für den Menschen
- Aktuelle Forschungstrends und Debatten im Bereich der Spieltheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Spiels für die Gesellschaft und die Entwicklung des Kindes dar. Sie beleuchtet den historischen Wandel in der Wahrnehmung des Kinderspiels und wie es im 18. Jahrhundert zum Gegenstand pädagogischer Reflexion wurde. Die Ausarbeitung soll einen Überblick über das Thema Spiel und Spieltheorien bieten.
Frühere Spieltheorien
Dieses Kapitel beleuchtet zwei bedeutende Denker, Friedrich Fröbel und Karl Groos, die sich mit dem Kinderspiel auseinandersetzten. Fröbels Ansatz fokussierte auf die Symbolik der Welt und die Förderung der Kreativität durch Spielgaben. Groos hingegen sah das Spiel als eine Vorbereitung auf das Erwachsenenleben und als Möglichkeit, Fähigkeiten durch Einübung zu entwickeln.
Moderne Erforschung des Spiels
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Phänomenologie des Spiels und beleuchtet die Arbeiten von Bernhard Hassenstein und Hans Scheuerl. Hassenstein ordnet das Spiel einem telenomischen Prinzip zu, das die Entwicklung zukünftiger Verhaltensweisen im Vordergrund stellt. Scheuerls Ansatz betrachtet die vielfältigen Formen des Spiels und deren Einfluss auf die kindliche Entwicklung.
Schlüsselwörter
Kinderspiel, Spieltheorien, Phänomenologie, Entwicklungspsychologie, Lernforschung, Fröbel, Groos, Hassenstein, Scheuerl, Hutt, Piaget, telonomisches Prinzip, Einübungstheorie.
- Quote paper
- Jennifer Mathä (Author), 2016, Spiel und Spieltheorien. Eine Analyse unterschiedlicher Spieltheorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/536420