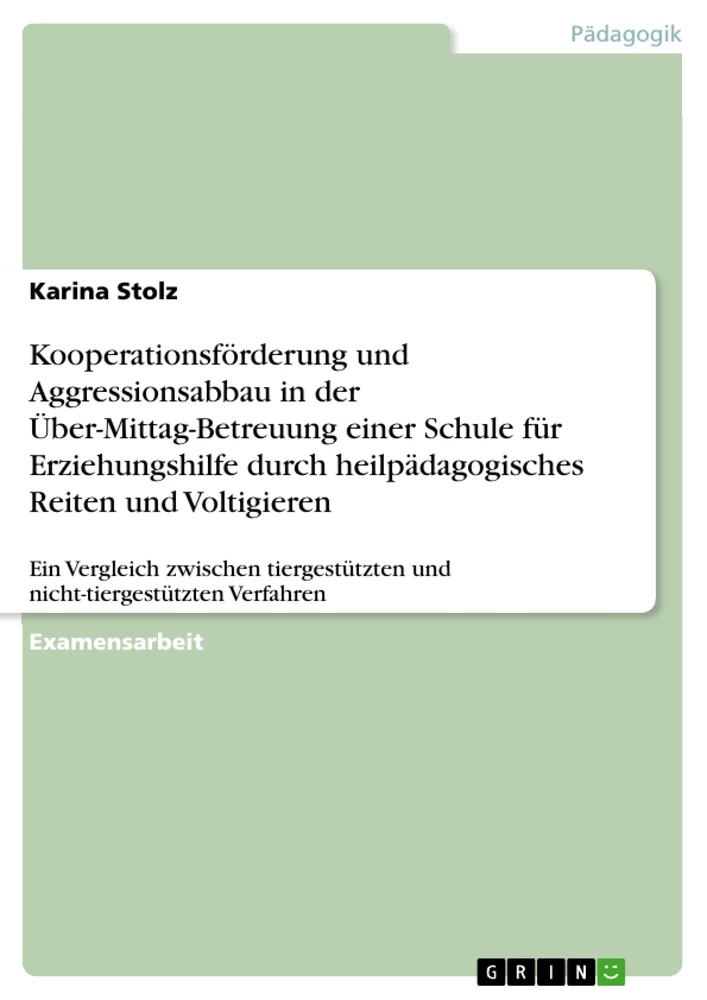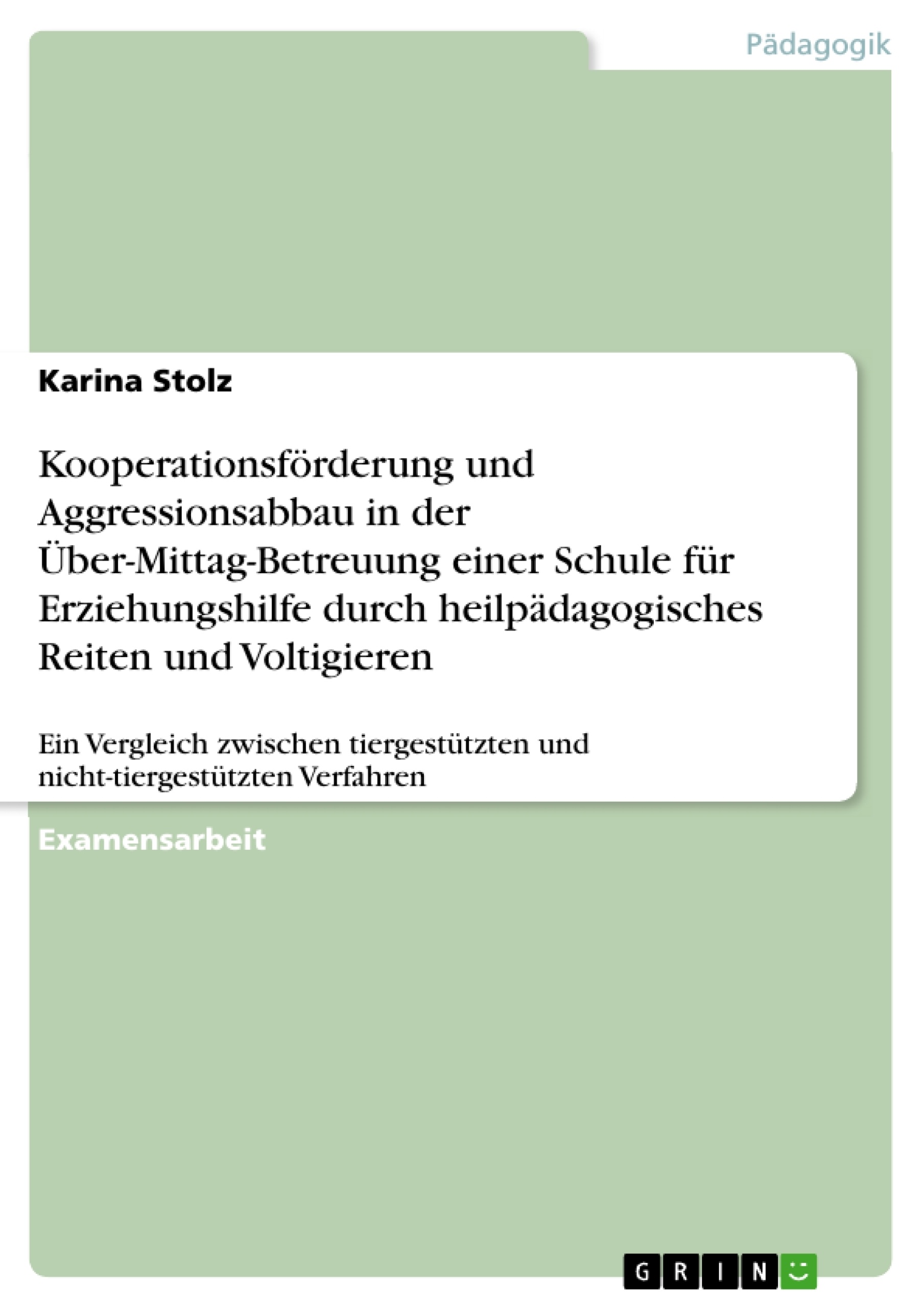„In Anwesenheit von Tieren werden Beziehungen zwischen SchülerInnen sowie zwischen SchülerInnen und LehrerInnen kooperativer, freundlicher. Aggressives und gewalttätiges Verhalten lassen nach, wenn Tiere anwesend sind.“ (Olbrich 2003, S. 77)
Seit langem werden Tiere erfolgreich in pädagogischen, sozialen und therapeutischen Projekten eingesetzt. Hinter der tiergestützten Pädagogik steht die Überzeugung, dass von Tieren eine Faszination ausgeht, die beruhigend und heilend wirken kann.
Ganz konkret bezieht es sich die heilende und beruhigende Wirkung, unter vielen weiteren Merkmalen, auf die kooperativen und prosozialen Verhaltensweisen.
Die empirische Forschung kann schon auf einige Effizienzstudien zurückblicken (vgl. zum Beispiel Vanek-Gullner 2003). Eine stringente und umfassende Theorie konnte allerdings noch nicht entwickelt werden.
Die Schule für Erziehungshilfe Berliner Straße bietet ein solches Projekt in der Über-Mittag-Betreuung an. Eine sehr gute Möglichkeit, um selbst zu testen, ob wirklich prosoziales und kooperatives Verhalten im direkten Tierkontakt im Vordergrund stehen.
Das Tier, das während der gesamten Zeit zur Verfügung steht ist ein Pferd.
„Das Pferd erlaubt keine Fassade, kein Double-bind im sozialen Umgang, es fordert eine klare Aufrichtung, runden Energiefluss, kreatürliche Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Und das heilt.“ (Steinborn/Wecker 1994, S. 3)
Mein besonders herzlicher Dank gilt den Kindern der Primargruppe der Über-Mittag-Betreuung, der Kollegin und dem Kollegen aus dem Betreuerteam, der Klassenlehrerin und dem Klassenlehrer, der Leitung der Schule für Erziehungshilfe Berliner Straße, sowie allen, die mir bei der Umsetzung behilflich waren für die freundliche und engagierte Unterstützung und ihre Hilfsbereitschaft vor, während und nach dem Projekt. Ohne diese angenehme Zusammenarbeit wäre die Umsetzung der Untersuchung nicht möglich gewesen. Aus Datenschutzgründen habe ich die Namen der beobachteten Schüler geändert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erster Teil: Theoretische Grundlagen
- 1. Grundlagen der Erziehungsschwierigenpädagogik
- 1.1 Begriffsbestimmung und Definition
- 1.2 Erklärungsansätze
- 1.3 Verhaltensstörungen im Kontext schulischer Anforderungen (KMK-Empfehlungen)
- 2. Tiergestützte Pädagogik
- 2.1 Über die Beziehung zwischen Mensch und Tier
- 2.2 Die Kommunikation zwischen Mensch und Tier
- 2.3 Tiergestützte Pädagogik und verhaltensauffällige Kinder
- 3. Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren
- 3.1 Grundlagen
- 3.2 Zur Bedeutung des Pferdes
- 3.3 Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren mit verhaltensauffälligen Kindern
- 4. Vernetzung von Schule und Jugendhilfe
- 5. Aggression und Kooperation
- 5.1 Der Begriff Aggression und die Anwendung psychologischer Konzepte
- 5.2 Theorien zur Klärung der Entstehung und Vermeidung von Aggressionen
- 5.3 Aggressivität als psychische Disposition der Aggression
- 5.4 Über die Kooperationsbereitschaft
- 1. Grundlagen der Erziehungsschwierigenpädagogik
- Zweiter Teil: Empirische Untersuchung
- 1. Das Projekt
- 1.1 Übermittagbetreuung an der Schule für Erziehungshilfe Berliner Straße
- 1.2 Projektbeschreibung
- 1.3 Schülerbeschreibung
- 2. Das Forschungsdesign
- 2.1 Problemdarstellung und Entwicklung der Fragestellung
- 2.2 Legitimation der Methode
- 2.3 Legitimation der Beobachtungs- und Fragebögen (Beobachtungsleitfaden)
- 2.4 Die Auswertungsmethode
- 3. Die Auswertung
- 3.1 Projektreflexion
- 3.2 Die Graphiken – Ergebnisdarstellung
- 3.3 Zusammenfassendes Fazit
- 3.4 Ausblick
- 1. Das Projekt
- Dritter Teil: Nachweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss heilpädagogischen Reitens und Voltigierens auf die Kooperationsförderung und den Aggressionsabbau in der Über-Mittag-Betreuung einer Schule für Erziehungshilfe. Ziel ist es, einen Vergleich zwischen tiergestützten und nicht-tiergestützten Verfahren zu ziehen.
- Einfluss tiergestützter Pädagogik auf das Sozialverhalten von Kindern mit Erziehungsschwierigkeiten
- Vergleichende Analyse von tiergestützten und nicht-tiergestützten Interventionen
- Aggressionsabbau und Kooperationsförderung durch heilpädagogisches Reiten und Voltigieren
- Bedeutung der Mensch-Tier-Beziehung in der heilpädagogischen Arbeit
- Evaluation eines konkreten Projekts an einer Schule für Erziehungshilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der tiergestützten Pädagogik und deren positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten von Kindern mit Erziehungsschwierigkeiten ein. Sie verweist auf die bestehende Forschungslage und die Lücke bezüglich einer umfassenden Theorie. Das Projekt an der Schule für Erziehungshilfe Berliner Straße dient als Grundlage der empirischen Untersuchung.
Erster Teil: Theoretische Grundlagen: Dieser Teil legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Er beleuchtet Konzepte der Erziehungsschwierigenpädagogik, die Bedeutung tiergestützter Pädagogik, insbesondere heilpädagogisches Reiten und Voltigieren, und die Zusammenhänge zwischen Aggression, Kooperation und der Mensch-Tier-Beziehung. Es werden relevante Theorien und Ansätze zur Aggressionsentstehung und -vermeidung diskutiert.
Zweiter Teil: Empirische Untersuchung: Der zweite Teil beschreibt die empirische Untersuchung, die an der Schule für Erziehungshilfe Berliner Straße durchgeführt wurde. Er beinhaltet die Projektbeschreibung, die Methodik (einschließlich der Forschungsfrage, der gewählten Methode und deren Legitimation sowie der Auswertungsmethode), und die detaillierte Auswertung der Ergebnisse. Der Fokus liegt auf der Analyse des Einflusses des Projekts auf das Sozialverhalten der teilnehmenden Kinder.
Schlüsselwörter
Heilpädagogisches Reiten, Voltigieren, Tiergestützte Pädagogik, Aggression, Kooperation, Erziehungsschwierigkeiten, Schule für Erziehungshilfe, Empirische Untersuchung, Sozialverhalten, Mensch-Tier-Beziehung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Einfluss heilpädagogischen Reitens und Voltigierens auf die Kooperationsförderung und den Aggressionsabbau
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von heilpädagogischem Reiten und Voltigieren auf die Kooperationsfähigkeit und den Abbau von Aggressionen bei Kindern mit Erziehungsschwierigkeiten in der Übermittagbetreuung einer Schule für Erziehungshilfe. Ein Vergleich zwischen tiergestützten und nicht-tiergestützten Methoden wird durchgeführt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss tiergestützter Pädagogik auf das Sozialverhalten, einer vergleichenden Analyse tiergestützter und nicht-tiergestützter Interventionen, dem Aggressionsabbau und der Kooperationsförderung durch heilpädagogisches Reiten und Voltigieren, der Bedeutung der Mensch-Tier-Beziehung in der heilpädagogischen Arbeit und der Evaluation eines konkreten Projekts an einer Schule für Erziehungshilfe.
Welche theoretischen Grundlagen werden in der Arbeit gelegt?
Der theoretische Teil behandelt Grundlagen der Erziehungsschwierigenpädagogik (Begriffsbestimmung, Erklärungsansätze, Verhaltensstörungen im Kontext schulischer Anforderungen), tiergestützte Pädagogik (Mensch-Tier-Beziehung, Kommunikation, Anwendung bei verhaltensauffälligen Kindern), heilpädagogisches Reiten und Voltigieren (Grundlagen, Bedeutung des Pferdes, Anwendung bei verhaltensauffälligen Kindern), die Vernetzung von Schule und Jugendhilfe, sowie Aggression und Kooperation (Begriffsbestimmung, Theorien zur Entstehung und Vermeidung von Aggressionen, Aggressivität als Disposition, Kooperationsbereitschaft).
Wie ist die empirische Untersuchung aufgebaut?
Die empirische Untersuchung beschreibt ein Projekt in der Übermittagbetreuung einer Schule für Erziehungshilfe. Sie umfasst die Projektbeschreibung, die Schülerbeschreibung, das Forschungsdesign (Problemdarstellung, Forschungsfrage, Methodik, Legitimation der gewählten Methoden, Auswertungsmethode), die Auswertung der Ergebnisse (Projektreflexion, Ergebnisdarstellung, Fazit, Ausblick).
Welche Methoden wurden in der empirischen Untersuchung eingesetzt?
Die Arbeit beschreibt die verwendeten Beobachtungs- und Fragebögen (Beobachtungsleitfaden) und die dazugehörige Auswertungsmethode. Die genauen Details der Methoden werden im Haupttext erläutert.
Wo wurde die empirische Untersuchung durchgeführt?
Die empirische Untersuchung wurde an der Schule für Erziehungshilfe Berliner Straße durchgeführt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit ergeben sich aus der Auswertung der empirischen Daten und werden im Fazit und Ausblick zusammengefasst. Es wird ein Vergleich zwischen den tiergestützten und nicht-tiergestützten Methoden gezogen und die Ergebnisse hinsichtlich des Einflusses auf das Sozialverhalten der Kinder interpretiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Heilpädagogisches Reiten, Voltigieren, Tiergestützte Pädagogik, Aggression, Kooperation, Erziehungsschwierigkeiten, Schule für Erziehungshilfe, Empirische Untersuchung, Sozialverhalten, Mensch-Tier-Beziehung.
- Quote paper
- Karina Stolz (Author), 2005, Kooperationsförderung und Aggressionsabbau in der Über-Mittag-Betreuung einer Schule für Erziehungshilfe durch heilpädagogisches Reiten und Voltigieren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53622