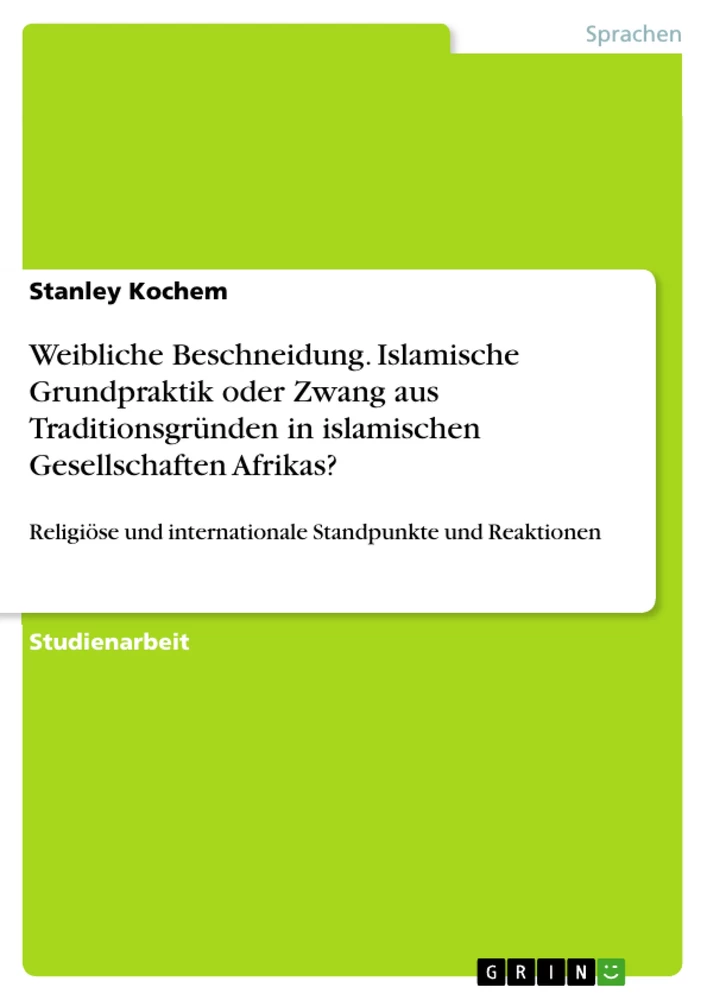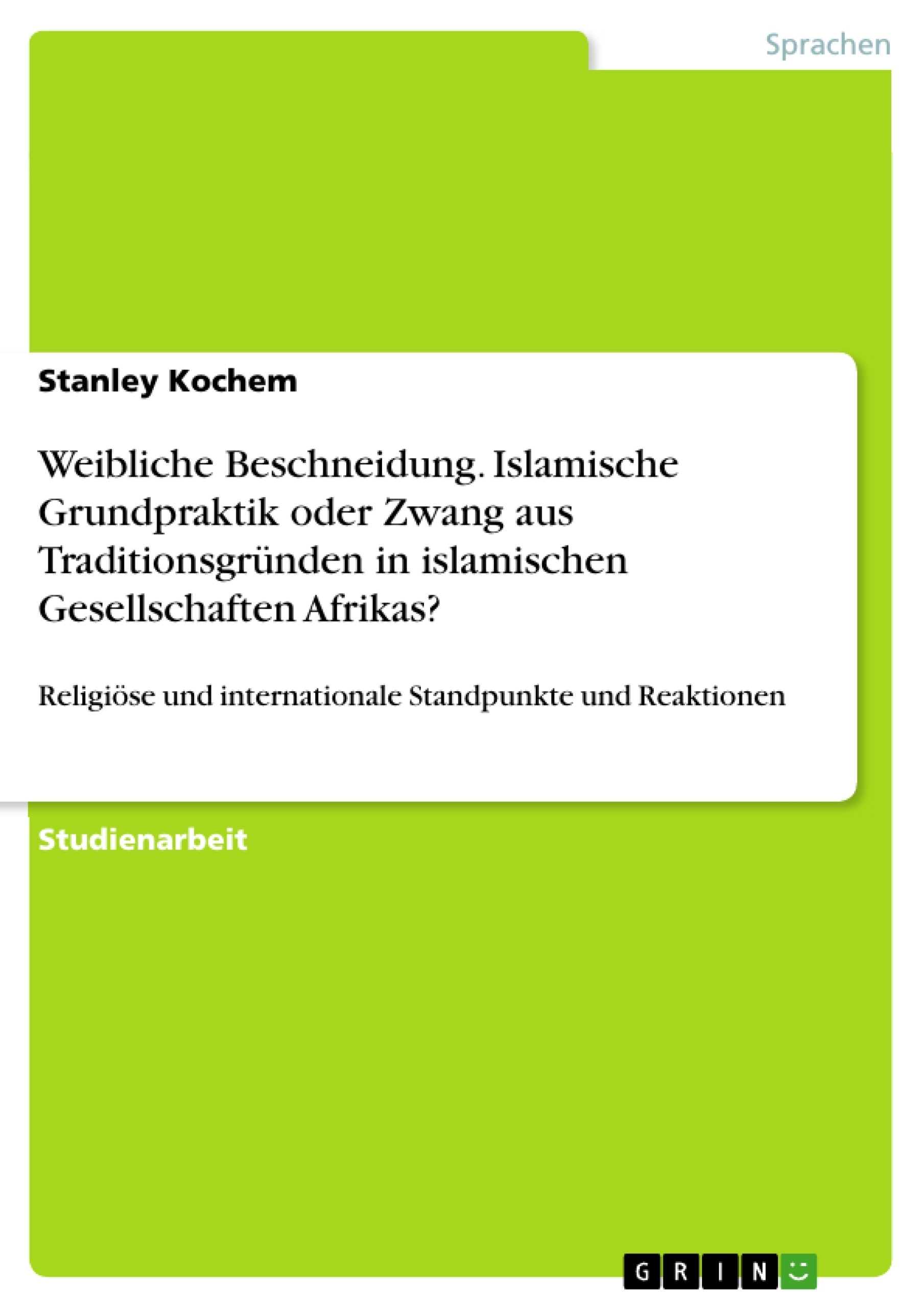Unter dem Begriff der weilblichen Beschneidung wird im allgemeinen Sinne das Beschneiden des weiblichen Geschlechts verstanden, welches sich je nach Ort, Kultur, Tradition, Glauben und zahlreichen weiteren Faktoren erheblich unterscheiden kann. In diesem Sinne wird jene Praktik v. a. in islamisch geprägten Gesellschaften Afrikas ausgeübt, wo sie sich sowohl in Bezeichnung und Bedeutung unterscheidet. Die gängigsten Bezeichnungen sind ḫifāḍ, ṭahāra, ṭahūr (allesamt Arabisch), qodiin (Somali), bolokoli, irua, bondo, kuruna, negekorsigin und kene‐kene (weitere Sprachen aus der Sahelzone, etwa Bambara, Hausa u. a.), als auch im Alter der Ausübung, etwa gleich nach der Geburt, zwischen dem siebten und zehnten Lebensjahr, oder gar unmittelbar vor der Hochzeit oder nach der ersten Schwangerschaft und im Ritual, ob die beschneidende Person etwa ein Arzt in einem Krankenhaus oder eine traditionelle Beschneiderin ist und letztlich, wo und wie lange der Prozess stattfindet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines
- Gründe
- Vorkommen, Verbreitung und Ursprung
- Die 4 Typen der weiblichen Beschneidung laut der WHO
- Die weibliche Beschneidung in verschiedenen lokalen, rechtlichen und religiösen Kontexten
- Die weibliche Beschneidung im somalischen Kontext als Fallbeispiel
- Die weibliche Beschneidung als Kontroverse im intraislamischen Diskurs
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der weiblichen Beschneidung, einer Praxis, die in verschiedenen islamisch geprägten Gesellschaften Afrikas verbreitet ist. Sie untersucht die verschiedenen Formen der Beschneidung, ihre Hintergründe, ihre Folgen und die internationalen Reaktionen auf diese Praxis. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Komplexität der weiblichen Beschneidung zu entwickeln und die verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema zu beleuchten.
- Die verschiedenen Formen der weiblichen Beschneidung und ihre historischen Wurzeln
- Die unterschiedlichen Motive für die Durchführung der weiblichen Beschneidung
- Die gesundheitlichen und psychologischen Folgen der weiblichen Beschneidung
- Die rechtlichen und gesellschaftlichen Debatten um die weibliche Beschneidung
- Die Rolle des Islam in der Debatte um die weibliche Beschneidung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung erläutert den Begriff der weiblichen Beschneidung und differenziert zwischen der traditionellen Praxis und der modernen Definition der "weiblichen Genitalverstümmelung" (FGM). Sie behandelt die verschiedenen Bezeichnungen und Rituale der Beschneidung, die je nach Region variieren. Außerdem werden die möglichen Folgen der Beschneidung für die betroffenen Frauen beleuchtet, sowohl die unmittelbaren als auch die langfristigen Auswirkungen.
Die weibliche Beschneidung in verschiedenen lokalen, rechtlichen und religiösen Kontexten
Dieses Kapitel untersucht die weibliche Beschneidung in unterschiedlichen Kontexten, wobei ein Fokus auf dem somalischen Kontext liegt. Es analysiert die verschiedenen Gründe für die Praxis, die von traditionellen kulturellen Normen bis hin zu religiösen Interpretationen reichen können. Der Einfluss des Islams auf die Praxis wird untersucht, wobei die Frage nach einer möglichen Legitimation durch den Koran und die Hadithen im Vordergrund steht.
Schlüsselwörter
Weibliche Beschneidung, weibliche Genitalverstümmelung (FGM), Islam, Afrika, Tradition, Kultur, Ritus, Gesundheit, Psychologie, Recht, Gesellschaft, Debatte, Legitimation, Koran, Hadith.
- Quote paper
- Stanley Kochem (Author), 2019, Weibliche Beschneidung. Islamische Grundpraktik oder Zwang aus Traditionsgründen in islamischen Gesellschaften Afrikas?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535693