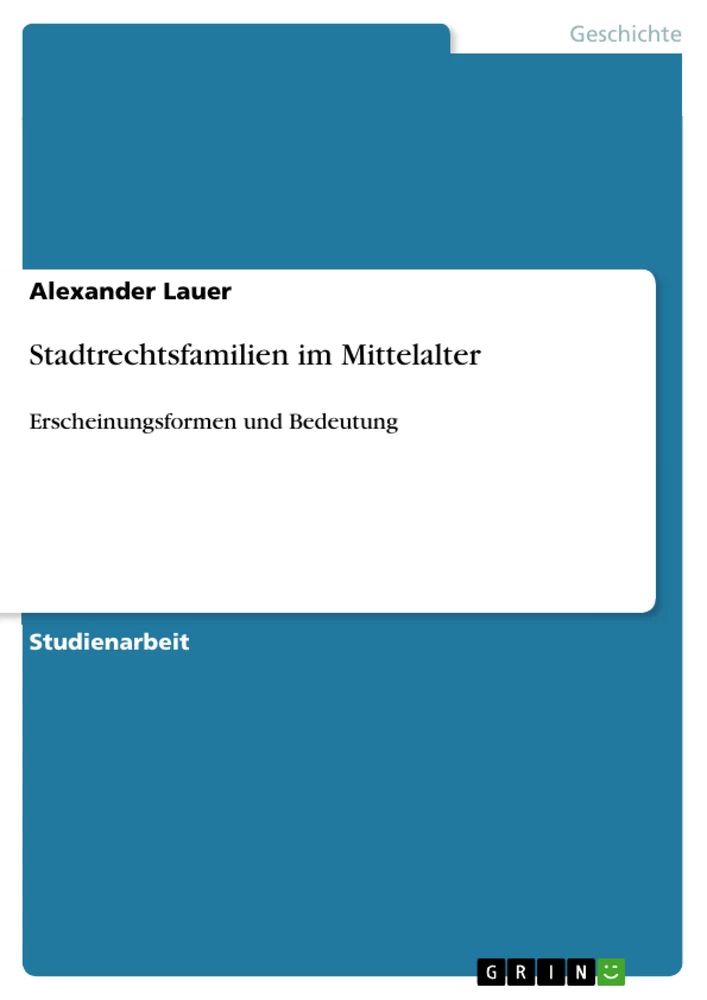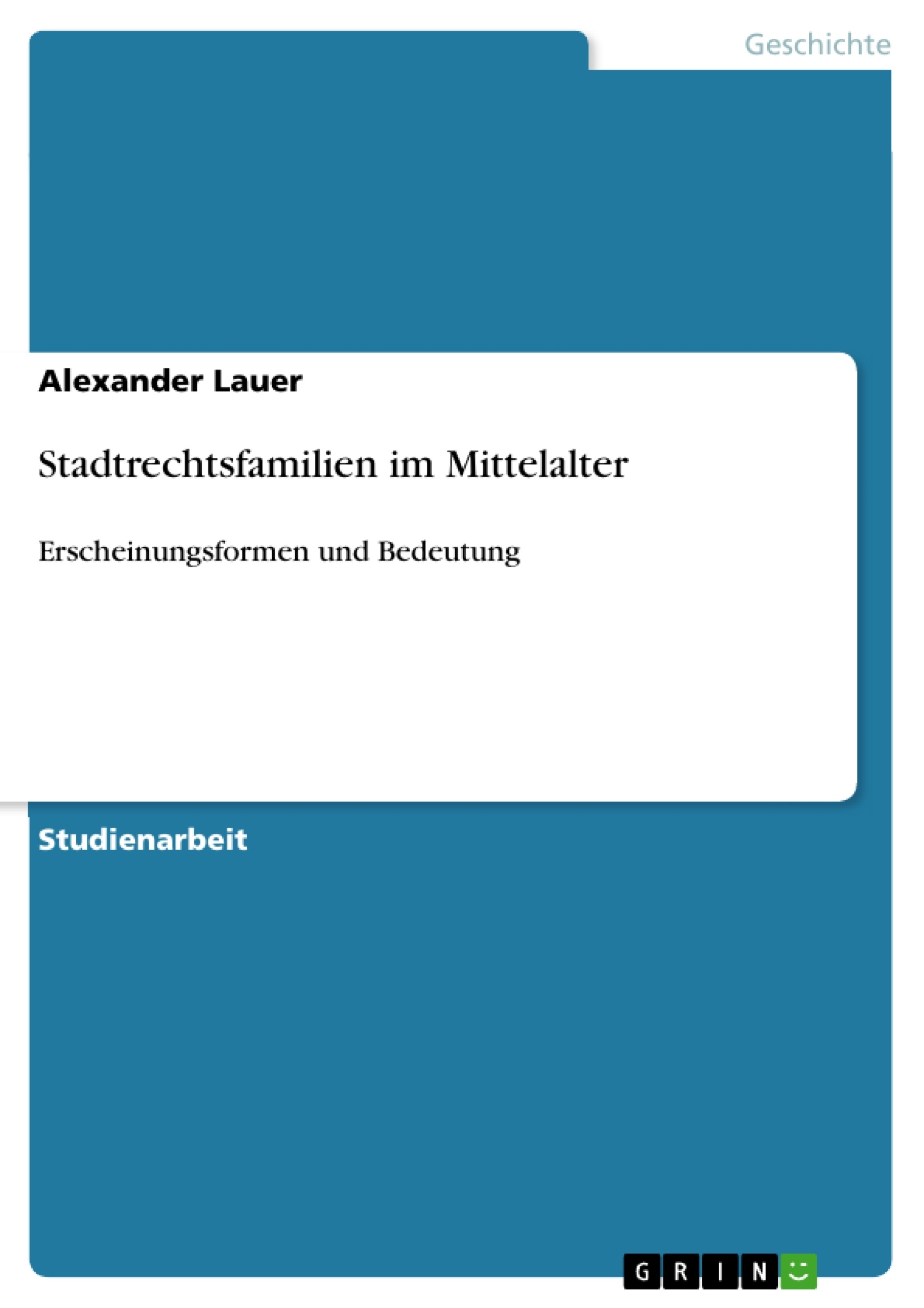Das Stadtrecht hat in der Forschung große Aufmerksamkeit erfahren, sodass die mittelalterliche deutsche Stadt bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts fast ausschließlich über ihr besonderes Recht definiert wurde. Dies hat sich inzwischen zugunsten eines differenzierten, viele verschiedene Aspekte würdigenden Ansatzes geändert. Dennoch muss das Stadtrecht als deutliches Merkmal der Abgrenzung der Stadt vom Umland eine herausgehobene Bedeutung behalten. Diese Bedeutung hatte es aber nicht nur in der Stadt seiner ursprünglichen Geltung. Auch für Auswärtige gab es einen Anknüpfungspunkt, der es ihnen ermöglichte, rechtlichen Rat in einer fremden Stadt einzuholen.
Will man diesen Anknüpfungspunkt bestimmen, kommt man nicht umhin, sich mit einem Phänomen zu befassen, das die heutige Stadtrechtsforschung „Stadtrechtsfamilien“ nennt. Daher soll zunächst versucht werden, eine möglichst allgemeine Bestimmung des Begriffs „Stadtrechtsfamilie“ vorzunehmen, woran sich eine kurze Aufstellung der wichtigsten Stadtrechtsfamilien und ihrer Verbreitungsgebiete anschließen wird. Daraufhin ist auf die Gründe, Verfahren und Voraussetzungen ihrer Entstehung und Ausbreitung einzugehen. Als dritter Punkt sollen die Verfahrensformen, in denen die rechtlichen Beziehungen zwischen den Städten zu Tage traten, und die Begriffe, die die Forschung dafür geprägt hat, erörtert werden. Hierbei werden zumeist die Stadtrechtsfamilien von Lübeck und Magdeburg als Beispiele herangezogen. Schließlich ist noch die Bedeutung der Stadtrechtsfamilien zu diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Begriffsbestimmung und wichtigste Beispiele
- II. Gründe, Verfahren und Voraussetzungen der Entstehung von Stadtrechtsfamilien
- 1. Stadtrechtsverleihungen
- 2. Rechtsmitteilungen
- 3. Fazit
- III. Oberhof und Rechtszug: Ausprägungen und Unterschiede
- 1. Allgemeines
- 2. Zum mittelalterlichen Gerichtsverfahren
- 3. Der Rechtszug nach Lübeck
- IV. Bedeutung der Stadtrechtsfamilien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Phänomen der Stadtrechtsfamilien im Mittelalter, wobei der Fokus auf deren Entstehung, Verbreitung und Bedeutung liegt. Die Arbeit untersucht, wie sich das Recht verschiedener Städte im Laufe der Zeit entwickelte und wie diese Entwicklung zur Entstehung von Stadtrechtsfamilien führte.
- Entwicklung und Ausbreitung von Stadtrechtsfamilien im Mittelalter
- Verfahren und Voraussetzungen der Entstehung von Stadtrechtsfamilien
- Die Rolle von Oberhöfen und Rechtszügen bei der Entwicklung von Stadtrechtsfamilien
- Die Bedeutung von Stadtrechtsfamilien für die städtische Rechtsordnung im Mittelalter
- Die Bewertung von Stadtrechtsfamilien in der wissenschaftlichen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Begriffsbestimmung und wichtigste Beispiele: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Stadtrechtsfamilie“ und stellt die wichtigsten Stadtrechtsfamilien im Mittelalter vor. Es beleuchtet auch die historische Entwicklung des Begriffs „Stadtrechtsfamilie“ in der Forschung.
- II. Gründe, Verfahren und Voraussetzungen der Entstehung von Stadtrechtsfamilien: Dieses Kapitel untersucht die Gründe, Verfahren und Voraussetzungen für die Entstehung von Stadtrechtsfamilien. Es analysiert die Rolle von Stadtrechtsverleihungen und Rechtsmitteilungen bei der Verbreitung von Stadtrechten.
- III. Oberhof und Rechtszug: Ausprägungen und Unterschiede: Dieses Kapitel behandelt die Ausprägungen und Unterschiede von Oberhöfen und Rechtszügen im Zusammenhang mit Stadtrechtsfamilien. Es analysiert insbesondere das Beispiel des Rechtszugs nach Lübeck.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen „Stadtrechtsfamilien“, „Stadtrechtsverleihung“, „Rechtsmitteilungen“, „Oberhof“, „Rechtszug“, „Lübeck“, „Magdeburg“ und „mittelalterliches Stadtrecht“. Sie analysiert das Phänomen der Stadtrechtsfamilien im Kontext der städtischen Rechtsentwicklung im Mittelalter und beleuchtet deren Bedeutung für die Rechtsordnung in Städten und Regionen.
- Quote paper
- Alexander Lauer (Author), 2016, Stadtrechtsfamilien im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535428