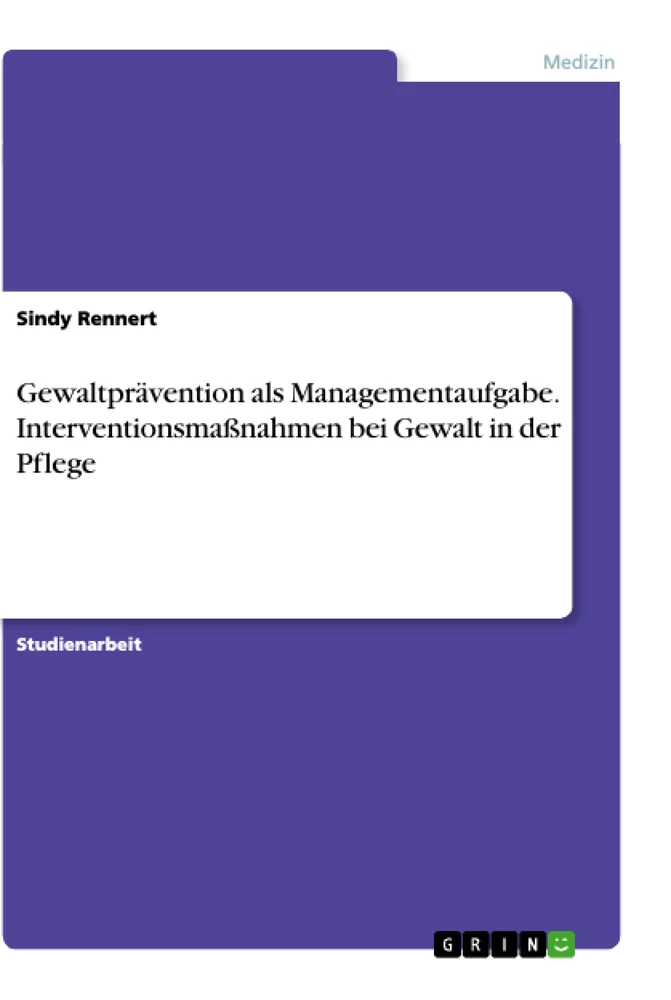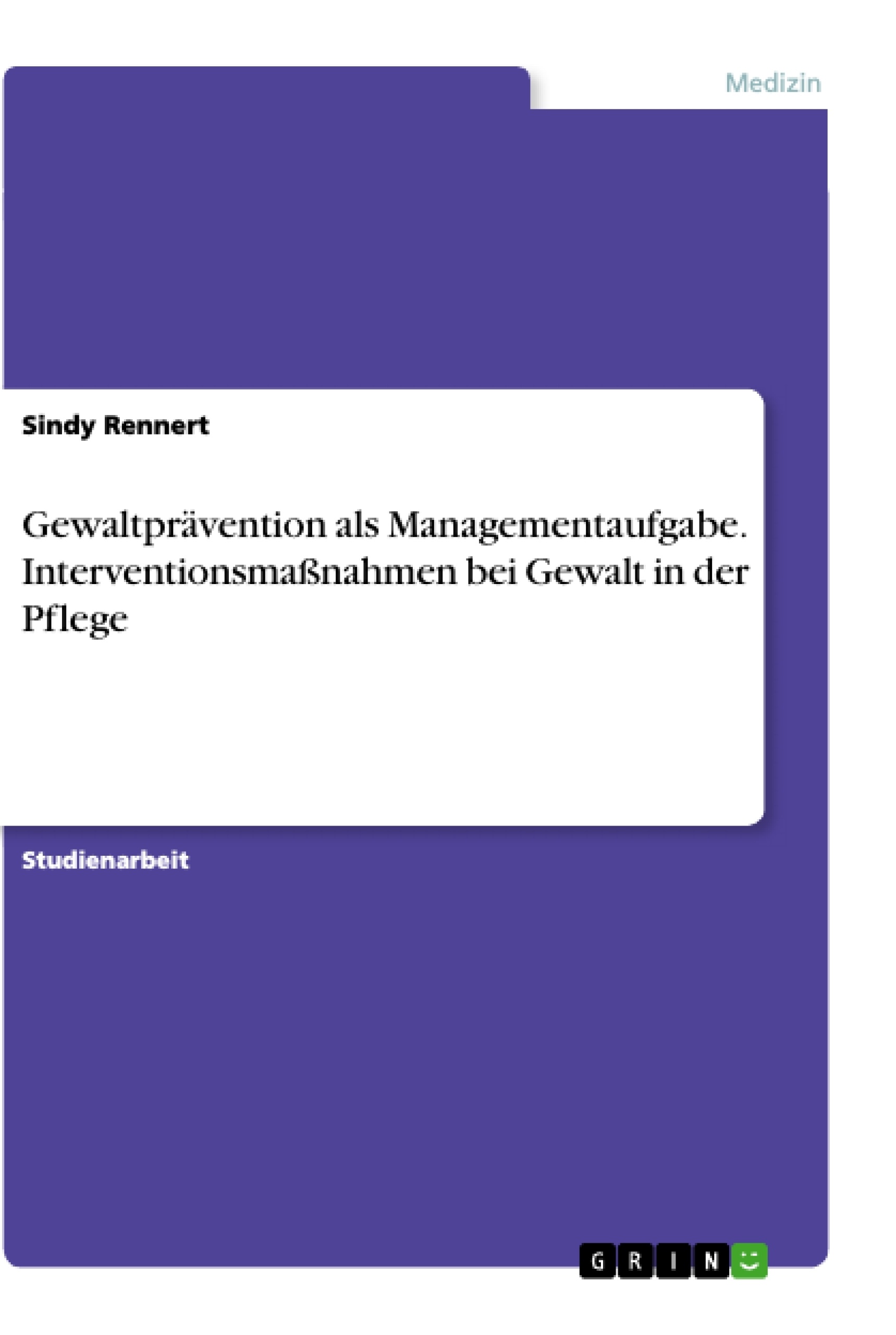Das Ziel dieser Hausarbeit ist, ein präventives Konzept mit Interventionen zur Gewaltprophylaxe zu erstellen, um den eigenen Mitarbeitern einen Leitfaden mit an die Hand zu geben, um bestmöglich sensibilisiert und vorbereitet zu sein. Dazu werden im ersten Teil die theoretischen Grundlagen, aktuellen Erkenntnisse sowie möglichen Modelle erläutert. Im zweiten Teil geht es um praktische Umsetzungsmöglichkeiten und die Erstellung eines Beispielkonzepts nach dem Motto "Best Practice".
In den Medien erleben wir nahezu täglich Berichte über häusliche Gewalt oder sexuelle Übergriffe. Dabei handelt es sich meist um die schwersten Fälle. Längst jedoch hat auch die Gewalt in der Pflege ihren Einzug in Öffentlichkeit gehalten. Laut einer Studie der B. Braun-Stiftung und des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung berichtet jeder Dritte Pflegende, dass Maßnahmen gegen den Willen der Patienten alltäglich sind. Vermehrt wird offiziell auch von Fällen in den Medien berichtet, dass Bewohner von Altenheimen drangsaliert und misshandelt werden. Ein Beispiel ist das Urteil von Amtsgericht Schwarzenbek aus Januar 2017. Eine 94-jährige Frau wurde in einem Altenheim in Lauenburg von ihrem Pfleger geschlagen und misshandelt. Sie erlitt Gesichtsprellungen und diverse Hämatome. Ihr 32-jähriger Pfleger wurde nach §132 des StGB zu 80 Tagessätzen von insgesamt 2.400 Euro verurteilt.
Doch auch die Gewalt gegenüber den Pflegekräften verschärft sich zunehmend. Fast jeder siebte gibt an, in den letzten 3 Monaten selbst Opfer von Gewalt geworden zu sein. Gewalt fängt früh mit kleinen Gesten an. Nur durch eine frühestmögliche Wahrnehmung und das Erkennen erster Anzeichen von Fehlverhalten zwischen Pflegepersonal und Pflegebedürftigen lässt sich der Gewalt präventiv entgegenwirken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1 Aggression
- 2.1.1 Begriff
- 2.1.2 Formen
- 2.2 Gewalt
- 2.2.1 Begriff
- 2.3 Aggression und Gewalt in der Pflege
- 2.1 Aggression
- 3. Theorien zur Entstehung von Aggression
- 4. Erklärungsmodelle
- 5. Ursachen von Aggressionen und Gewalt in der Pflege
- 5.1 Ursachen bei Pflegenden
- 5.2 Ursachen bei Pflegebedürftigen
- 6. Modell Monika Krohwinkel
- 6.1 Kommunizieren
- 6.2 Sich bewegen
- 6.3 Vitale Funktionen
- 6.4 Sich pflegen
- 6.5 Essen und Trinken
- 6.6 Ausscheiden
- 6.7 Sich kleiden
- 6.8 Ruhen und Schlafen
- 6.9 Sich beschäftigen
- 6.10 Sich als Mann oder Frau fühlen
- 6.11 Für eine sichere Umgebung sorgen
- 6.12 Soziale Bereiche des Lebens sichern
- 6.13 Mit existentiellen Erfahrungen des Lebens umgehen
- 7. Allgemeine Rechte und Pflichten
- 7.1 Rechte und Pflichten der Organisation
- 7.2 Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und Bewohner / Patienten
- 7.3 Freiheitsentziehende Maßnahmen
- 8. Gewaltprävention
- 8.1 Begriffsbestimmung
- 8.2 Primärprävention
- 8.3 Sekundärprävention
- 8.4 Tertiärprävention
- 9. Konzept Gewaltprävention
- 9.1 Zweck
- 9.2 Ziele
- 9.3 Geltungsbereich
- 9.4 Grundsätze
- 9.5 Definitionen
- 9.6 Zuständigkeiten
- 9.7 Rechtlicher Rahmen
- 9.8 Prävention, Deeskalation und weiteres Vorgehen
- 9.9 Sekundäre Prävention
- 9.10 Tertiäre Prävention
- 9.11 Dokumentation
- 9.12 Zielkontrolle
- 9.13 Mitgeltende Unterlagen
- 9.14 Verteiler
- 9.15 Änderungsdienst
- 9.16 Anlagen
- 10 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines präventiven Konzepts mit Interventionsmaßnahmen zur Gewaltprophylaxe in einer Pflegeeinrichtung. Das Konzept soll den Mitarbeitern als Leitfaden dienen, um bestmöglich auf Gewaltsituationen vorbereitet zu sein. Die Arbeit basiert auf theoretischen Grundlagen, aktuellen Erkenntnissen und der Entwicklung eines „Best Practice“-Beispielkonzepts.
- Definition und Abgrenzung von Aggression und Gewalt im Pflegekontext
- Ursachen von Aggression und Gewalt bei Pflegebedürftigen und Pflegenden
- Theorien und Erklärungsmodelle zur Entstehung von Aggression
- Präventive Maßnahmen und Interventionen zur Gewaltprophylaxe
- Entwicklung eines konkreten Gewaltpräventionskonzepts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die steigende Problematik von Gewalt in der Pflege, die sowohl von Bewohnern als auch von Pflegekräften ausgehen kann. Sie verweist auf aktuelle Studien und Gerichtsurteile, welche die häufig auftretende Misshandlung und Gewalt in Altenheimen verdeutlichen und die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen betonen. Die persönlichen Erfahrungen der Autorin bilden die Motivation für die Erstellung eines präventiven Konzepts zur Gewaltprävention.
2. Definitionen: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Aggression“ und „Gewalt“. Es wird differenziert zwischen verschiedenen Formen der Aggression (verbal, nonverbal, körperlich, selbstgerichtet) und die Bedeutung der Begriffe im Kontext der Pflegearbeit herausgestellt. Die Definitionen basieren auf verschiedenen wissenschaftlichen Quellen und betonen die Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung der Begriffe im Rahmen des Gewaltpräventionskonzepts.
3. Theorien zur Entstehung von Aggression: (An dieser Stelle sollte eine Zusammenfassung der Theorien zur Entstehung von Aggression eingefügt werden, basierend auf dem Originaltext.)
4. Erklärungsmodelle: (An dieser Stelle sollte eine Zusammenfassung der Erklärungsmodelle eingefügt werden, basierend auf dem Originaltext.)
5. Ursachen von Aggressionen und Gewalt in der Pflege: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen von Aggression und Gewalt sowohl bei den Pflegenden als auch bei den Pflegebedürftigen. Es analysiert die Faktoren, die zu gewalttätigen Handlungen beitragen, und stellt Zusammenhänge zwischen diesen Faktoren und den beschriebenen Theorien und Modellen her.
6. Modell Monika Krohwinkel: Dieses Kapitel beschreibt das Modell von Monika Krohwinkel, welches die Grundbedürfnisse von Menschen im Kontext der Pflege beschreibt. Es analysiert die einzelnen Bereiche des Modells (Kommunikation, Bewegung, Vitale Funktionen, etc.) und deren Relevanz für die Prävention von Aggression und Gewalt. Das Modell liefert einen umfassenden Ansatz zum Verständnis der Bedürfnisse von Pflegebedürftigen und deren Auswirkungen auf das Verhalten.
7. Allgemeine Rechte und Pflichten: Dieses Kapitel beleuchtet die Rechte und Pflichten aller Beteiligten im Pflegekontext – der Organisation, der Pflegekräfte und der Pflegebedürftigen. Es betont die Bedeutung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gewaltprävention und die Vermeidung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen. Der Fokus liegt auf der rechtlichen Grundlage für ein verantwortungsvolles und gewaltfreies Miteinander.
8. Gewaltprävention: Dieses Kapitel fokussiert auf verschiedene Strategien der Gewaltprävention, unterteilt in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention. Es beschreibt konkrete Maßnahmen zur Vermeidung von Gewaltsituationen und legt den Schwerpunkt auf die proaktive Gestaltung des Arbeitsumfelds und die frühzeitige Erkennung von Risikofaktoren.
9. Konzept Gewaltprävention: Dieses Kapitel beschreibt ein konkretes Konzept zur Gewaltprävention, einschließlich Zweck, Zielen, Geltungsbereich, Grundsätzen, Zuständigkeiten und rechtlichem Rahmen. Es detailliert Maßnahmen zur Prävention, Deeskalation und dem weiteren Vorgehen in Gewaltsituationen und legt besonderen Wert auf die Dokumentation und Zielkontrolle.
Schlüsselwörter
Gewaltprävention, Aggression, Gewalt, Pflege, Altenpflege, Modell Monika Krohwinkel, Primärprävention, Sekundärprävention, Tertiärprävention, Deeskalation, Rechte und Pflichten, rechtlicher Rahmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Gewaltpräventionskonzept in der Pflege
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Übersicht über ein Gewaltpräventionskonzept für Pflegeeinrichtungen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Definition von Aggression und Gewalt im Pflegekontext, der Analyse von Ursachen, der Vorstellung von Theorien und Modellen, und der Entwicklung eines konkreten Präventionskonzepts inklusive Interventionsmaßnahmen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Aggression und Gewalt in der Pflege, Ursachen von Aggression und Gewalt bei Pflegebedürftigen und Pflegenden, Theorien und Erklärungsmodelle zur Entstehung von Aggression, das Modell von Monika Krohwinkel zu den Grundbedürfnissen von Pflegebedürftigen, Rechte und Pflichten aller Beteiligten, verschiedene Strategien der Gewaltprävention (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention), und schließlich die detaillierte Ausarbeitung eines konkreten Gewaltpräventionskonzepts mit Maßnahmen zur Prävention, Deeskalation und Dokumentation.
Was ist das Ziel des Gewaltpräventionskonzepts?
Ziel ist die Entwicklung eines präventiven Konzepts mit Interventionsmaßnahmen zur Gewaltprophylaxe in Pflegeeinrichtungen. Das Konzept soll den Mitarbeitern als Leitfaden dienen, um bestmöglich auf Gewaltsituationen vorbereitet zu sein und diese zu vermeiden.
Welche Arten von Prävention werden beschrieben?
Das Konzept beschreibt die Primärprävention (Vermeidung von Gewaltsituationen), Sekundärprävention (frühzeitige Erkennung von Risikofaktoren und Interventionen) und Tertiärprävention (Maßnahmen nach Gewaltereignissen zur Vermeidung von Wiederholungen).
Welches Modell wird zur Erklärung von Bedürfnissen verwendet?
Das Modell von Monika Krohwinkel wird verwendet, um die Grundbedürfnisse von Menschen im Pflegekontext zu beschreiben und deren Relevanz für die Prävention von Aggression und Gewalt zu verdeutlichen. Es umfasst Bereiche wie Kommunikation, Bewegung, Vitale Funktionen, sich pflegen, Essen und Trinken, Ausscheiden, etc.
Welche rechtlichen Aspekte werden berücksichtigt?
Das Dokument beleuchtet die Rechte und Pflichten der Organisation, der Pflegekräfte und der Pflegebedürftigen und betont die Bedeutung des rechtlichen Rahmens für die Gewaltprävention, insbesondere im Hinblick auf freiheitsentziehende Maßnahmen.
Wie ist das Gewaltpräventionskonzept aufgebaut?
Das Gewaltpräventionskonzept umfasst Zweck, Ziele, Geltungsbereich, Grundsätze, Definitionen, Zuständigkeiten, den rechtlichen Rahmen, Maßnahmen zur Prävention und Deeskalation, sekundäre und tertiäre Prävention, Dokumentation, Zielkontrolle, und weitere relevante Informationen.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument ist für Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen gedacht, um ihnen einen Leitfaden für die Gewaltprävention und den Umgang mit Gewaltsituationen zu bieten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Gewaltprävention, Aggression, Gewalt, Pflege, Altenpflege, Modell Monika Krohwinkel, Primärprävention, Sekundärprävention, Tertiärprävention, Deeskalation, Rechte und Pflichten, rechtlicher Rahmen.
- Quote paper
- Sindy Rennert (Author), 2019, Gewaltprävention als Managementaufgabe. Interventionsmaßnahmen bei Gewalt in der Pflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/535294