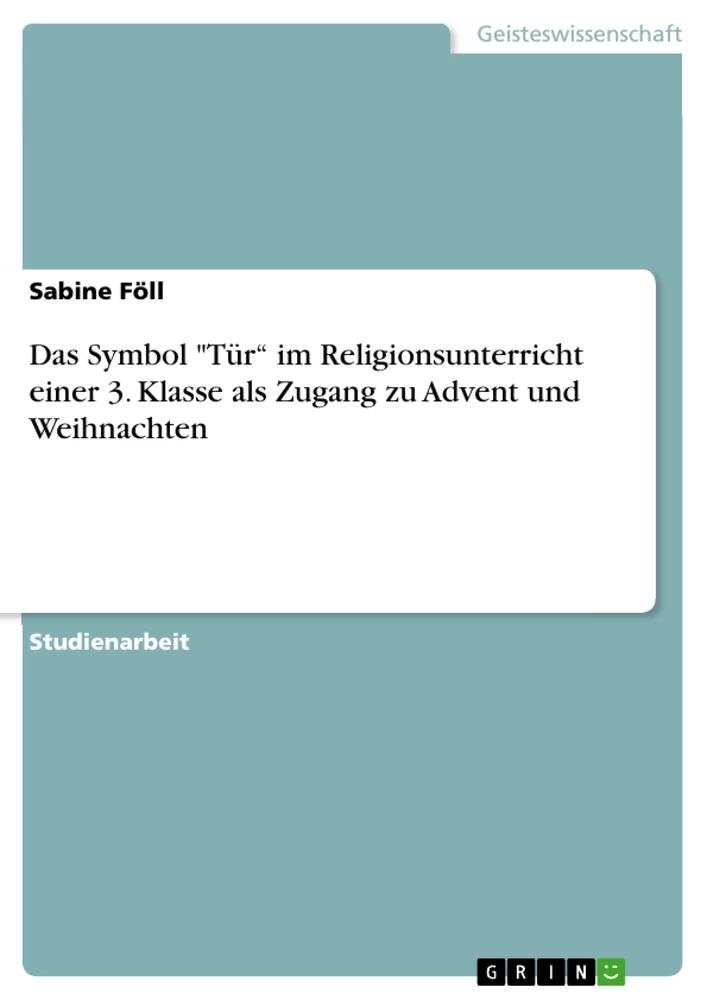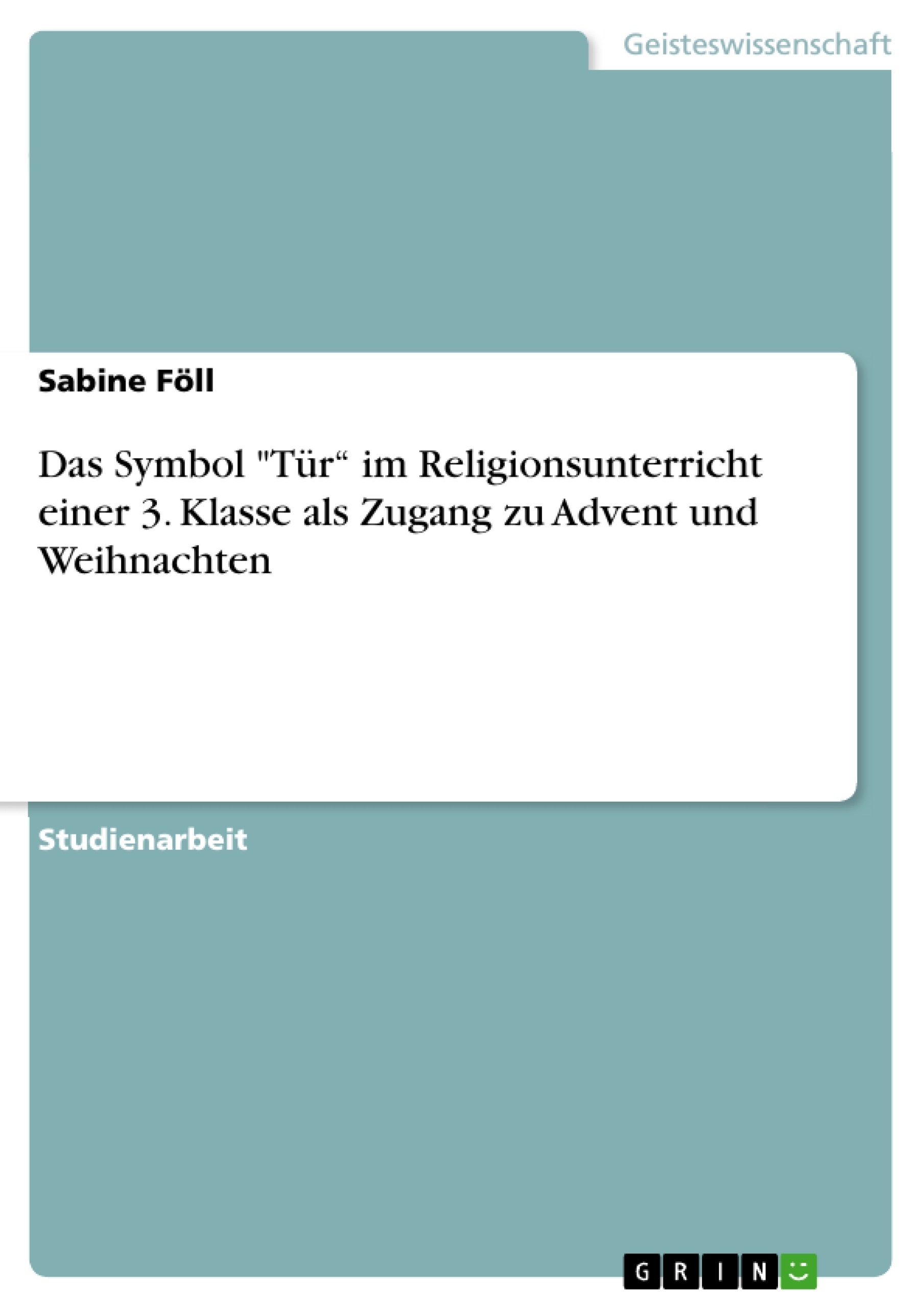Der Begriff „Symbol“ geht auf das griechische Wort „symballein“ zurück, das ursprünglich so viel wie „zusammenwerfen“, „zusammenfügen“ bedeutet. In der antiken Welt spielte das Symbol eine durchaus praktische Rolle. Ein Symbol war ein in zwei Teile auseinandergebrochener Gegenstand, z.B. ein kleines Täfelchen, ein Ring, ein Knochen. Gastfreunde, Boten, Vertragspartner... brachen den Gegenstand beim Abschied auseinander. Später konnte er zur Erkennung wieder zusammengefügt werden.
Heutzutage ist das Wort „Symbol“ angesichts verschiedenster psychoanalytischer, soziologischer, philosophischer, theologischer und sprachwissenschaftlicher Symboltheorien bedeutungsbreit. Ich möchte trotzdem versuchen, den Begriff „Symbol“ grob zu erläutern. Symbole sind eine besondere Gruppe von Zeichen. Sie „weisen auf etwas hin, was außerhalb ihrer selbst liegt.“ Jedes Symbol ist alsozweiteiligund besteht aus einer materiellen sowie einer immateriellen Ebene. Diematerielle Ebeneist etwas physisch Wahrnehmbares und wird Signifikant (das Bezeichnende) genannt, dieimmaterielle Ebeneist etwas physisch Nicht - Wahrnehmbares und wird Signifikat (das Bezeichnete) genannt. Zwischen dem Symbol und dem von ihm Repräsentierten besteht ein innerer Zusammenhang. In der Regel hat jedes Symbol eine Geschichte, in deren Verlauf es entstanden ist. Das Bezeichnete und das Bezeichnende lassen sich - im Gegensatz zum willkürlich gesetzten Zeichen - nicht austauschen. „Die Erscheinung des Symbols ist nicht etwas Zufälliges, sondern gehört letztlich zum Wesen der sich darstellenden Wirklichkeit" Paul Tillich bezeichnet diese Eigenschaft des Symbols als Selbstmächtigkeit.
Außerdem nennt er jedes Symbol uneigentlich, „es weist über sich hinaus auf das im Symbol Gemeinte, das Symbolisierte. Um des Symbolisierten willen muss es sich selbst ständig verneinen und überflüssig machen.“ Der eigentliche Sinn, auf den das Symbol verweist, kann nur dann wirklich zur Geltung kommen, „wenn das Symbol sich selbst in seiner direkten Anschaulichkeit und Gegenständlichkeit transzendiert.“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Sachanalyse
- 1.1 Symbole
- 1.1.1 Allgemein
- 1.1.2 Religiöse Symbole
- 1.2 Symbol „Tür“
- 1.2.1 Allgemein
- 1.2.2 Christliche Bedeutung
- 1.3 Advent
- 2. Didaktische Überlegungen
- 3. Methodische Analyse
- 3.1 Unterrichtseinheit zum Thema „Symbol“
- 3.1.1 Erste Unterrichtsstunde
- 3.1.2 Zweite Unterrichtsstunde
- 3.1.3 Dritte (ausführliche) Unterrichtsstunde
- 3.1.4 Vierte Unterrichtsstunde
- 3.1.5 Folgende Unterrichtsstunden
- 4. Verlaufsplanung
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Symbolkraft der „Tür“ im Kontext des Religionsunterrichts, insbesondere während der Adventszeit. Die Arbeit analysiert den Symbolbegriff allgemein und im christlichen Kontext, um anschließend didaktische und methodische Überlegungen für eine Unterrichtseinheit zum Thema zu entwickeln.
- Der Symbolbegriff nach Paul Tillich
- Die vielschichtige Symbolik der „Tür“
- Die didaktische Bedeutung von Symbolen im Religionsunterricht
- Methodische Umsetzung einer Unterrichtseinheit zum Thema „Tür“ in der Adventszeit
- Einordnung in den Bildungsplan
Zusammenfassung der Kapitel
1. Sachanalyse: Diese Analyse legt den Grundstein für die spätere didaktische Konzeption. Sie beginnt mit einer umfassenden Erörterung des Begriffs „Symbol“, beruht auf der Definition von Paul Tillich und beleuchtet dessen zweigeteilte Natur (Signifikant und Signifikat). Die Analyse hebt die Vieldeutigkeit und Kontextgebundenheit von Symbolen hervor, unterstützt durch Beispiele und Verweise auf verschiedene wissenschaftliche Perspektiven. Anschließend wird das Symbol „Tür“ im Allgemeinen und speziell im christlichen Kontext untersucht, wobei dessen Ambivalenz – Öffnung und Verschließung, Aufnahme und Ausschluss – detailliert dargestellt wird. Die christliche Bedeutung der „Tür“ als Zugang zu Gott und die damit verbundenen theologischen Implikationen werden erläutert, unterstützt durch biblische Bezüge und Beispiele aus religiösen Liedern. Der Abschnitt liefert eine fundierte Basis für die anschließende didaktische und methodische Auseinandersetzung.
2. Didaktische Überlegungen: Dieses Kapitel untersucht die Relevanz des Symbols „Tür“ im Kontext der Lebenswelt der Kinder. Es beleuchtet die Entwicklung des Symbolverständnisses bei Kindern und begründet die Wahl des Themas im Rahmen des Bildungsplans. Die Bedeutung der Unterrichtseinheit wird klar herausgestellt, indem die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit religiösen Symbolen im Unterricht betont wird. Die Lernziele der Unterrichtseinheit werden präzise formuliert und an den Bildungsplan gekoppelt. Dieser Abschnitt bildet die didaktische Grundlage für die nachfolgende methodische Ausarbeitung der Unterrichtseinheit.
3. Methodische Analyse: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Ablauf der geplanten Unterrichtseinheit zum Thema „Symbol“, unterteilt in mehrere aufeinander aufbauende Stunden. Die methodische Vorgehensweise wird für jede Stunde spezifiziert. Das Kapitel erläutert den didaktischen Ansatz und die Auswahl der Methoden, die zur Erreichung der Lernziele beitragen sollen. Der Schwerpunkt liegt auf einer schrittweisen Annäherung an das komplexe Thema „Symbol“ und der „Tür“ als religiöses Symbol. Die Beschreibung umfasst die didaktische Vorbereitung, die Methodenvielfalt und die vorgesehenen Lernmaterialien.
4. Verlaufsplanung: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Übersicht über die zeitliche und inhaltliche Planung der Unterrichtseinheit. Es handelt sich um einen konkreten Fahrplan mit der chronologischen Abfolge der einzelnen Stunden, mit detaillierter Beschreibung der Aktivitäten und der benötigten Materialien. Diese strukturierte Darstellung dient als praktische Anleitung zur Durchführung der Unterrichtseinheit.
Schlüsselwörter
Symbol, Symboltheorie, Paul Tillich, Religiöse Symbole, Tür, Advent, Religionsunterricht, Didaktik, Methodik, Bildungsplan, Lebenswelt der Kinder, Symbolverständnis.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Symbolanalyse der „Tür“ im Religionsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Symbolkraft der „Tür“ im Kontext des Religionsunterrichts, insbesondere während der Adventszeit. Sie analysiert den Symbolbegriff allgemein und im christlichen Kontext und entwickelt daraus didaktische und methodische Überlegungen für eine Unterrichtseinheit.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Sachanalyse des Symbolbegriffs (inkl. der Symboltheorie nach Paul Tillich) und des Symbols „Tür“, didaktische Überlegungen zur Relevanz des Themas im Religionsunterricht, eine detaillierte methodische Analyse einer mehrstündigen Unterrichtseinheit zum Thema „Symbol“ und „Tür“, sowie eine Verlaufsplanung dieser Einheit. Der Bezug zum Bildungsplan wird ebenfalls hergestellt.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Sachanalyse (inkl. Symbolbegriff, Symbol „Tür“ im Allgemeinen und im christlichen Kontext), 2. Didaktische Überlegungen, 3. Methodische Analyse der Unterrichtseinheit (aufgeteilt in einzelne Unterrichtsstunden), 4. Verlaufsplanung der Unterrichtseinheit und 5. Literaturverzeichnis.
Welche Aspekte der Symboltheorie werden behandelt?
Die Arbeit basiert auf der Symboltheorie von Paul Tillich und beleuchtet die zweigeteilte Natur von Symbolen (Signifikant und Signifikat), deren Vieldeutigkeit und Kontextgebundenheit. Es werden verschiedene wissenschaftliche Perspektiven berücksichtigt.
Wie wird das Symbol „Tür“ analysiert?
Das Symbol „Tür“ wird sowohl allgemein als auch im christlichen Kontext analysiert. Die Ambivalenz des Symbols (Öffnung/Verschließung, Aufnahme/Ausschluss) und seine Bedeutung als Zugang zu Gott werden detailliert dargestellt und mit biblischen Bezügen und Beispielen aus religiösen Liedern untermauert.
Welche didaktischen Überlegungen werden angestellt?
Die didaktischen Überlegungen befassen sich mit der Relevanz des Symbols „Tür“ für die Lebenswelt der Kinder, der Entwicklung des Symbolverständnisses bei Kindern und der Einordnung des Themas in den Bildungsplan. Die Lernziele der Unterrichtseinheit werden präzise formuliert.
Wie ist die methodische Analyse der Unterrichtseinheit aufgebaut?
Die methodische Analyse beschreibt detailliert den Ablauf der geplanten Unterrichtseinheit, aufgeteilt in mehrere aufeinander aufbauende Stunden. Für jede Stunde wird die methodische Vorgehensweise, der didaktische Ansatz, die Auswahl der Methoden und die Lernmaterialien spezifiziert. Der Fokus liegt auf einer schrittweisen Annäherung an das Thema.
Was enthält die Verlaufsplanung?
Die Verlaufsplanung bietet eine detaillierte Übersicht über die zeitliche und inhaltliche Planung der Unterrichtseinheit. Sie dient als praktische Anleitung zur Durchführung und enthält eine chronologische Abfolge der einzelnen Stunden mit Beschreibung der Aktivitäten und benötigten Materialien.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Symbol, Symboltheorie, Paul Tillich, Religiöse Symbole, Tür, Advent, Religionsunterricht, Didaktik, Methodik, Bildungsplan, Lebenswelt der Kinder, Symbolverständnis.
- Citar trabajo
- Sabine Föll (Autor), 2002, Das Symbol "Tür“ im Religionsunterricht einer 3. Klasse als Zugang zu Advent und Weihnachten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53506