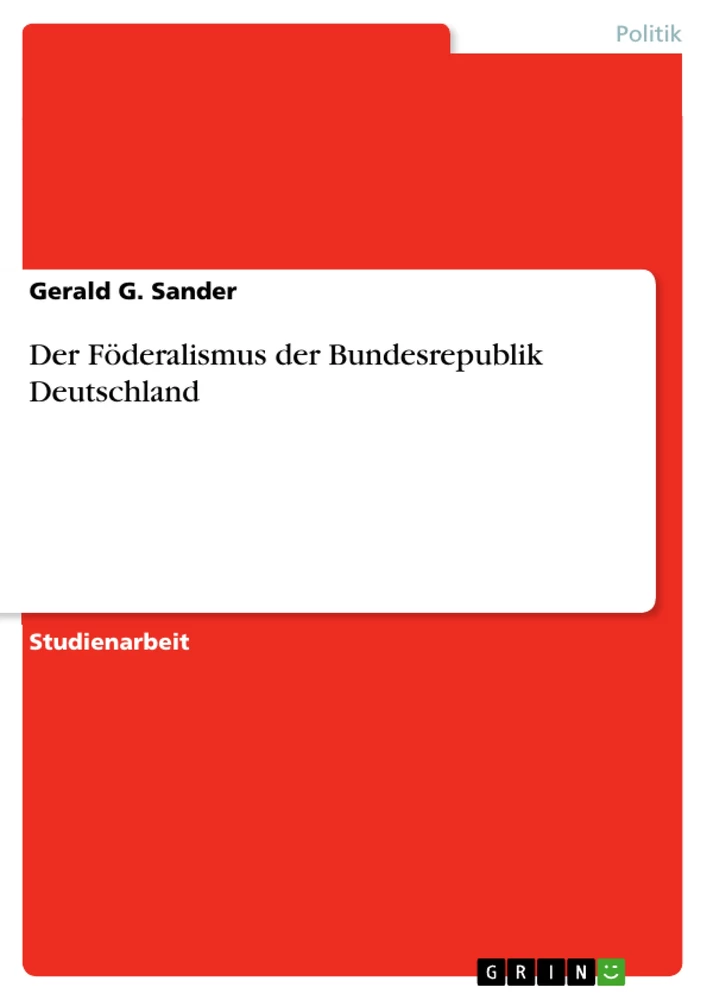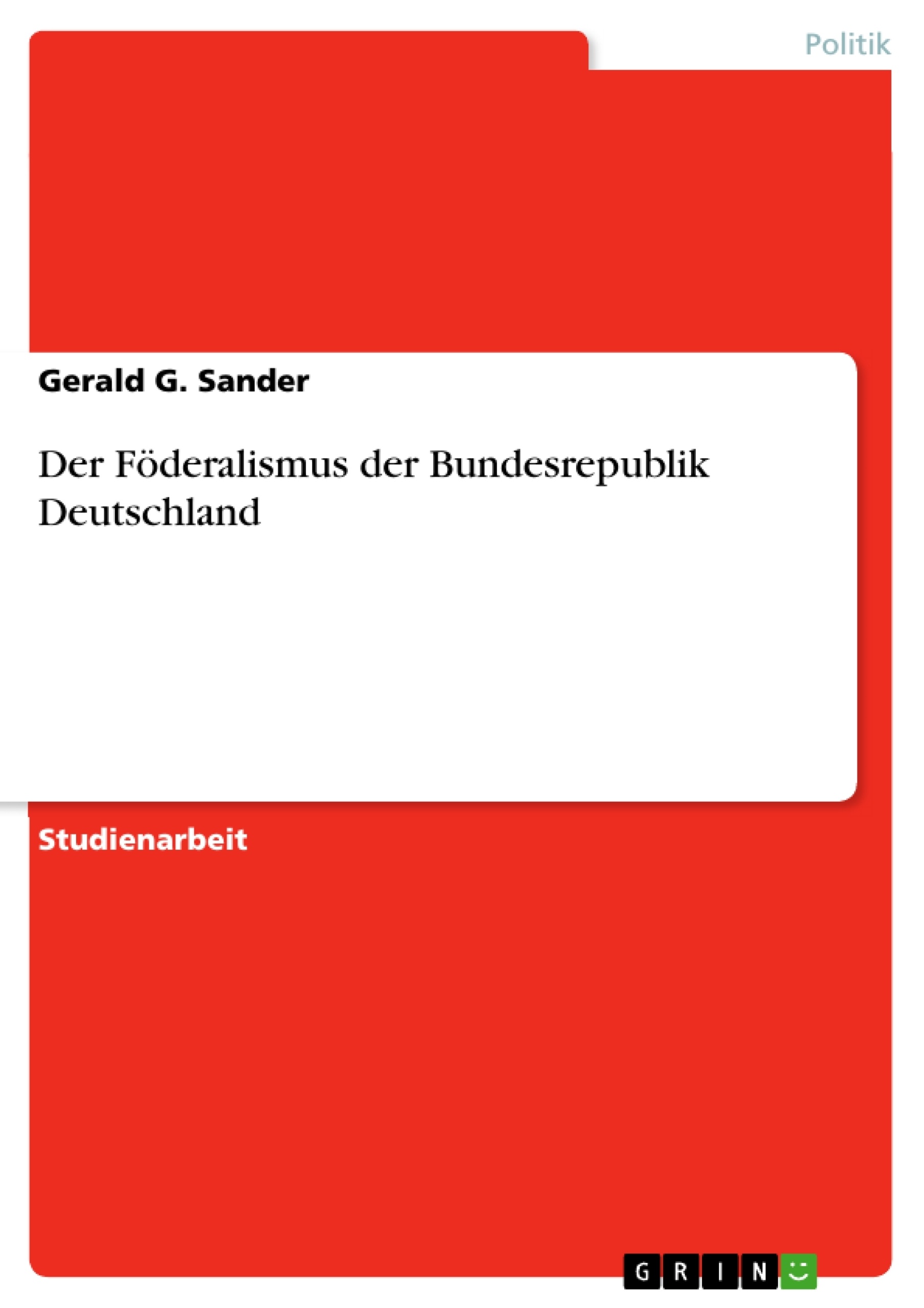m Jahre 1939 prophezeite Harold L. Laski: "Das Zeitalter des Föderalismus ist vorbei." Der Föderalismus wurde häufig nur als geschichtliche Durchgangsstation zu einem zentralistischen Staat gesehen. Er wurde als zu teuer und zu schwerfällig bei politischen Entscheidungen bezeichnet. Trotz allem hat sich der Föderalismus in vielen Staaten der Erde bis zum heutigen Tage behauptet. Zwar unterliegt er in seinen Strukturen und seinen Aufgaben immer neuen Umwandlungen, sein Kern ist aber erhalten geblieben. Auch der Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland unterliegt ständigen Veränderungen, vor allem in Folge der Wiedervereinigung und der europäische Integration. Es muß über einen neuen Finanzausgleich und über eine neue Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern nachgedacht werden. Immer wieder ist auch die Neugliederung des Bundesgebietes in der Diskussion. Im Zuge der Wiedervereinigung wurde als Auftrag aus dem Einigungsvertrag ein Verfassungsausschuß eingesetzt, dessen eines Ziel auch die Stärkung des Föderalismus in der BRD ist. Nach den Erfahrungen in den letzten Jahren hat sich gezeigt, daß der Gedanke des Föderalismus weder tot, noch am Absterben ist, sondern sich als dauerhaft und lebendig präsentiert.
Das Wesen des Föderalismus in der BRD, die Untersuchung, welche Gefahren heute dem Föderalismus drohen und ob er überhaupt noch seinen Namen zurecht trägt, sind Gegenstand der folgenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundprinzipien des Föderalismus
- Begriff und Erscheinungsformen
- Begründungen für den Föderalismus
- Vorteile des Föderalismus
- Der Föderalismus in der deutschen Geschichte
- Das Bundesstaatsprinzip des Grundgesetzes
- Überblick
- Das Wesen des Föderalismus nach dem Grundgesetz
- Staatlichkeit der Gliedstaaten und des Gesamtstaats
- Homogenitätsprinzip
- Vorrang des Bundesrechts
- Gegenseitige Einwirkungsrechte
- Prinzip der Bundestreue
- Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern
- Überblick
- Zuständigkeitsvermutung des Art. 30 GG
- Die Gesetzgebungskompetenz
- Die Verwaltungskompetenz
- Die Rechtsprechungskompetenz
- Die auswärtigen Angelegenheiten
- Die Finanzordnung
- Steuergesetzgebung
- Aufteilung der Steuern
- Finanzausgleich
- Finanzhilfen des Bundes
- Der kooperative Föderalismus
- Der Bundesrat
- Das Bund-Länder-Verhältnis
- Gemeinschaftsaufgaben
- Kooperationen zwischen den Ländern
- Gefahren der Kooperation
- Konfliktbewältigung zwischen dem Bund und den Ländern
- Die Bundesaufsicht
- Der Bundeszwang
- Der Bund-Länder-Streit
- Gefahren für den Föderalismus
- Nachteile des Föderalismus
- Bundesrat und Parteien als unitarisierende Faktoren
- Auswirkungen der europäischen Integration und der deutschen Vereinigung
- Zukunftsperspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, das Wesen des deutschen Föderalismus zu beleuchten, aktuelle Gefahren für dessen Funktionsfähigkeit zu identifizieren und seine Zukunftsperspektiven zu erörtern. Die Arbeit berücksichtigt insbesondere die Auswirkungen der Wiedervereinigung und der europäischen Integration.
- Begriff und Erscheinungsformen des Föderalismus
- Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern
- Kooperativer Föderalismus und Konfliktbewältigung
- Gefahren für den Föderalismus
- Zukunftsperspektiven des Föderalismus in der BRD
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die These auf, dass der Föderalismus, trotz vorhergesagten Niedergangs, eine dauerhafte und lebendige Staatsform ist, die jedoch ständigen Veränderungen unterliegt, insbesondere durch die Wiedervereinigung und die europäische Integration. Die Arbeit wird sich mit dem Wesen des Föderalismus in der BRD, seinen aktuellen Gefahren und seiner Zukunft befassen.
1. Grundprinzipien des Föderalismus: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Föderalismus und unterscheidet seine Erscheinungsformen, insbesondere Staatenbund und Bundesstaat. Es erläutert die Begründungen für föderale Strukturen, sowohl historische als auch geografische. Die Bedeutung der Homogenität und der vertikalen Gewaltenteilung wird hervorgehoben, ebenso wie der Gegensatz zum Unitarismus.
2. Der Föderalismus in der deutschen Geschichte: Dieses Kapitel (dessen Inhalt im Auszug nicht vorhanden ist) würde historische Entwicklungen des Föderalismus in Deutschland beleuchten, möglicherweise von den Kleinstaaten des Heiligen Römischen Reiches bis zur Bundesrepublik. Es würde die verschiedenen Phasen und ihre Auswirkungen auf die heutige föderale Struktur analysieren.
3. Das Bundesstaatsprinzip des Grundgesetzes: Dieses Kapitel analysiert das Bundesstaatsprinzip im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Es untersucht das Wesen des Föderalismus nach dem Grundgesetz, beleuchtet die Staatlichkeit der Gliedstaaten und des Bundes, das Homogenitätsprinzip, den Vorrang des Bundesrechts und die gegenseitigen Einwirkungsrechte von Bund und Ländern. Das Prinzip der Bundestreue wird ebenfalls thematisiert.
4. Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern: Dieses Kapitel befasst sich mit der Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern. Es betrachtet die Zuständigkeitsvermutung des Artikels 30 GG, die Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungskompetenzen sowie die auswärtigen Angelegenheiten. Die verschiedenen Kompetenzbereiche und ihre Abgrenzung werden detailliert untersucht.
5. Die Finanzordnung: Dieses Kapitel untersucht die Finanzordnung des deutschen Bundesstaates. Es analysiert die Steuergesetzgebung, die Aufteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund und Ländern, den Finanzausgleich und die Finanzhilfen des Bundes an die Länder. Die Bedeutung der Finanzordnung für das Gleichgewicht des Föderalismus wird hervorgehoben.
6. Der kooperative Föderalismus: Dieses Kapitel befasst sich mit dem kooperativen Föderalismus. Es analysiert die Rolle des Bundesrates, das Bund-Länder-Verhältnis, die Bedeutung von Gemeinschaftsaufgaben und die Kooperationen zwischen den Ländern. Die Kapitel würden zudem mögliche Gefahren der Kooperation und deren Bewältigung thematisieren.
7. Konfliktbewältigung zwischen dem Bund und den Ländern: Dieses Kapitel behandelt Mechanismen der Konfliktbewältigung zwischen Bund und Ländern. Es beschreibt die Bundesaufsicht, den Bundeszwang und die Verfahren zur Beilegung von Bund-Länder-Streitigkeiten. Die verschiedenen Instrumente und ihre Anwendung werden analysiert.
8. Gefahren für den Föderalismus: Dieses Kapitel untersucht die möglichen Gefahren für den deutschen Föderalismus. Es analysiert potentielle Nachteile des föderalen Systems, den Einfluss von Parteien und Bundesrat auf die föderale Struktur sowie die Auswirkungen der europäischen Integration und der deutschen Wiedervereinigung auf den Föderalismus.
Schlüsselwörter
Föderalismus, Bundesrepublik Deutschland, Grundgesetz, Kompetenzverteilung, Bundesrat, Länder, Bund, Kooperation, Konfliktbewältigung, Wiedervereinigung, Europäische Integration, Finanzausgleich, Staatenbund, Bundesstaat, Unitarismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Deutscher Föderalismus
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den deutschen Föderalismus. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse des Wesens des deutschen Föderalismus, seiner aktuellen Herausforderungen und seiner Zukunftsperspektiven, unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Wiedervereinigung und der europäischen Integration.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende zentrale Themen: Begriff und Erscheinungsformen des Föderalismus, die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, der kooperative Föderalismus und Konfliktbewältigung, Gefahren für den Föderalismus und seine Zukunftsperspektiven in der Bundesrepublik Deutschland. Es werden historische Entwicklungen, das Bundesstaatsprinzip im Grundgesetz, die Finanzordnung und die Rolle des Bundesrates analysiert.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist nach einem klaren logischen Aufbau gestaltet. Es beginnt mit einem Inhaltsverzeichnis, gefolgt von der Zielsetzung und den Themenschwerpunkten. Anschließend werden die einzelnen Kapitel mit ihren jeweiligen Zusammenfassungen dargestellt. Schließlich werden Schlüsselwörter zur besseren Orientierung bereitgestellt.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument enthält die folgenden Kapitel: Einleitung, Grundprinzipien des Föderalismus, Der Föderalismus in der deutschen Geschichte, Das Bundesstaatsprinzip des Grundgesetzes, Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, Die Finanzordnung, Der kooperative Föderalismus, Konfliktbewältigung zwischen Bund und Ländern, Gefahren für den Föderalismus und Zukunftsperspektiven.
Was sind die wichtigsten Schlüsselwörter des Dokuments?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Föderalismus, Bundesrepublik Deutschland, Grundgesetz, Kompetenzverteilung, Bundesrat, Länder, Bund, Kooperation, Konfliktbewältigung, Wiedervereinigung, Europäische Integration, Finanzausgleich, Staatenbund, Bundesstaat, Unitarismus.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, das Wesen des deutschen Föderalismus zu beleuchten, aktuelle Gefahren für seine Funktionsfähigkeit zu identifizieren und seine Zukunftsperspektiven zu erörtern. Ein besonderer Fokus liegt auf den Auswirkungen der Wiedervereinigung und der europäischen Integration.
Welche Gefahren für den Föderalismus werden im Dokument angesprochen?
Das Dokument thematisiert verschiedene Gefahren für den deutschen Föderalismus, darunter potentielle Nachteile des föderalen Systems, den Einfluss von Parteien und des Bundesrates auf die föderale Struktur sowie die Auswirkungen der europäischen Integration und der deutschen Wiedervereinigung.
Wie wird der kooperative Föderalismus im Dokument behandelt?
Das Kapitel zum kooperativen Föderalismus analysiert die Rolle des Bundesrates, das Bund-Länder-Verhältnis, Gemeinschaftsaufgaben und Kooperationen zwischen den Ländern. Es werden auch mögliche Gefahren der Kooperation und deren Bewältigung thematisiert.
Welche Rolle spielt die Finanzordnung im deutschen Föderalismus?
Die Finanzordnung spielt eine entscheidende Rolle für das Gleichgewicht des Föderalismus. Das Dokument analysiert die Steuergesetzgebung, die Aufteilung der Steuereinnahmen, den Finanzausgleich und Finanzhilfen des Bundes an die Länder.
Wie wird die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern im Dokument dargestellt?
Die Kompetenzverteilung wird detailliert untersucht, inklusive der Zuständigkeitsvermutung des Artikels 30 GG, der Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungskompetenzen sowie der auswärtigen Angelegenheiten. Die verschiedenen Kompetenzbereiche und ihre Abgrenzung werden analysiert.
- Quote paper
- Dr. Gerald G. Sander (Author), 1992, Der Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53458