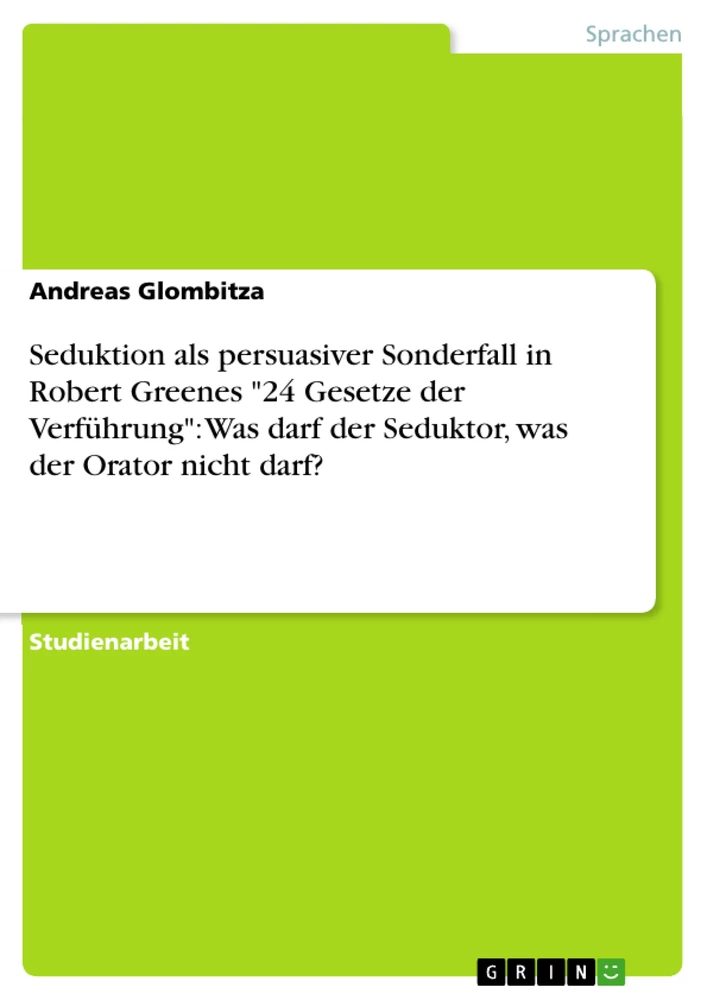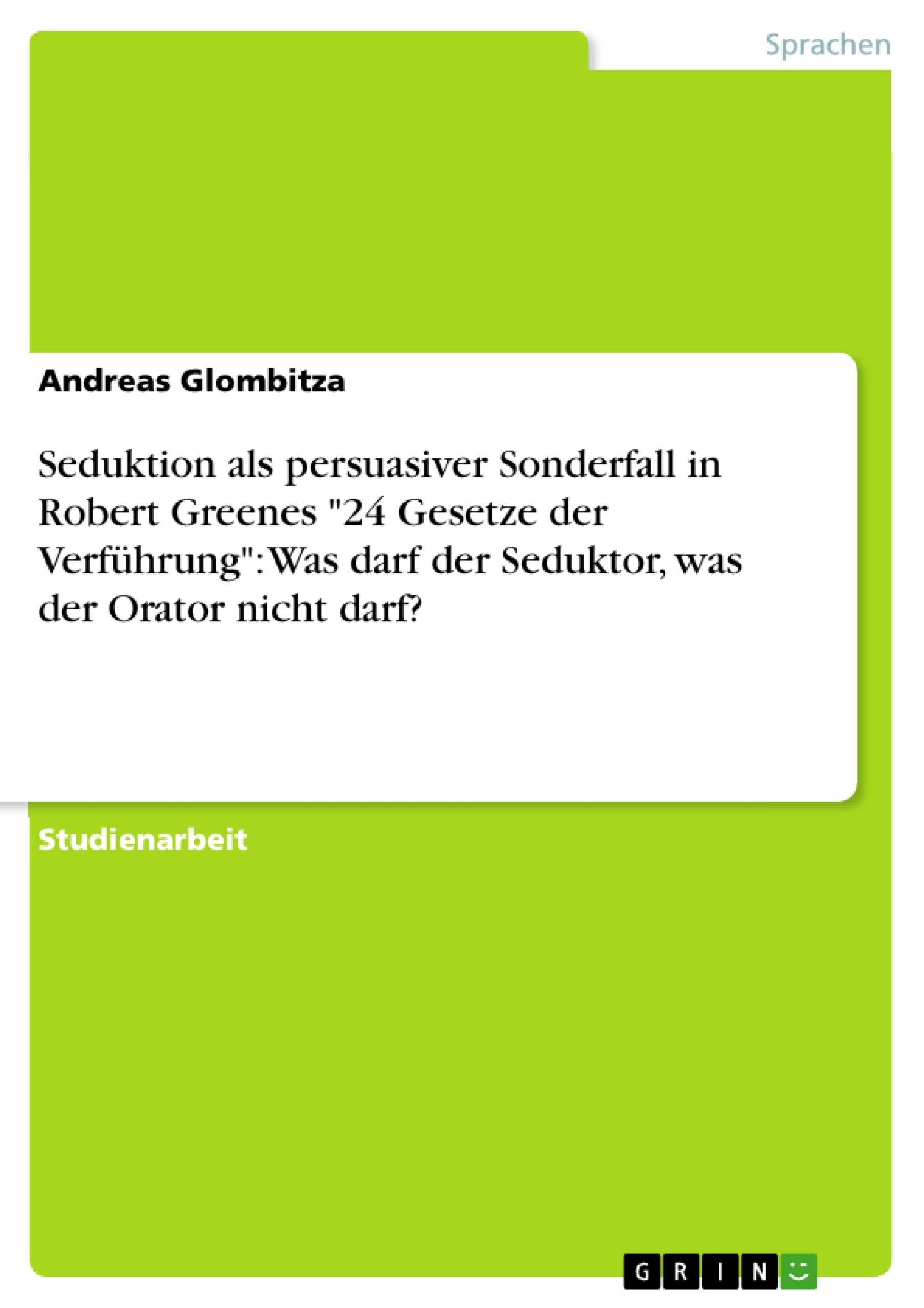„All is fair in love and war“, so sagt ein altes Sprichwort: Im Krieg und in der Liebe sei alles erlaubt. Liest man nur das Vorwort des populären Ratgebers „Die 24 Gesetze der Verführung“ von Robert Greene, bekommt man den Eindruck, dies ist sein Programm. Vom „Kampf um die Macht“1 ist da die Rede, von „Verführung als weiblicher Variante der Kriegführung“2, von der „Perspektive des Kriegers“3, die ein Verführer einnehmen müsse, auch davon, ein Opfer „in die Irre [zu] führen“, bis es schließlich durch den sexuellen Akt „weiter versklavt“4 werde. Das Sprichwort und Greenes martialische Metaphorik implizieren eine Art wesenhafte Verbindung von Liebe und Krieg: sie könnte darin bestehen, daß beide sich schlecht unter herkömmlichen moralischen Kategorien verhandeln lassen – indem beide scheinbar eine Art Verkehrung der Welt mit sich bringen. Zumindest könnte man sagen: einiges ist im Bereich der Partnerwerbung erlaubt, was in der Normalkommunikation verboten ist. Greene geht soweit, zu behaupten, als Verführte (also Verliebte) „verlieren [wir] die Fähigkeit des logischen Denkens und verhalten uns auf mancherlei Weise so irrational, wie wir es sonst nie tun würden“6 – der Verführer solle diesen Zustand induzieren. Verführung sei schließlich „eine Form der Täuschung“, und „Verführer [scheren] sich nicht um die Meinung anderer Menschen“7. Wenn wir uns einer Kunst der Verführung von innerhalb der Rhetoriktheorie aus nähern wollen, können wir mit einem derart kriegerischmanipulativen Ansatz natürlich nur beschränkt operieren. Um Seduktion als Phänomen innerhalb sozialer Systeme ansprechen zu können, müssen wir vielmehr versuchen, die speziellen Voraussetzungen aufzuzeigen, die einer Kommunikation, die auf seduktivpersuasive Beeinflussung abzielt, zugrunde liegen. Davon gilt es, Regelhaftigkeiten für eine ars seducendi abzuleiten, deren Anwendung sich nicht mehr unmittelbar dem Manipulationsvorwurf ausgesetzt sieht. Wir werden uns deshalb, nach Klärung der Grundbegriffe, zunächst klarmachen, was für Voraussetzungen für eine solche ars bestehen. Dann werden wir uns Greenes Verführertypen vornehmen und untersuchen, wo die Unterschiede zwischen Orator und Seduktor zu suchen sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was darf der Seduktor, was der Orator nicht darf?
- 2.1 Begriffe und Grundlagen
- 2.1.1 Techne/Ars
- 2.1.2 Anforderungen an eine Kasualrhetorik
- 2.1.3 Meta-telos und sub-telos der Seduktion, Zeitpunkt der Zertumserlangung
- 2.2 Technographische Bedingungen einer Ars Seducendi
- 2.3 Greene als Kasualrhetorik der Seduktion
- 2.3.1 Selbstanalyse, Image-Projektion, Integritätsproblematik
- 2.4 Bedingungen der erweiterten Seduktions-licentia
- 2.4.1 Das Kooperationsprinzip und seine Maxime
- 2.4.2 Greenes Anti-Verführer: Erkennen seduktiver Sondervoraussetzungen
- 3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Seduktion als persuasiven Sonderfall im Vergleich zur traditionellen Rhetorik. Sie fragt, welche Mittel und Strategien ein Verführer einsetzen darf, die einem Redner verwehrt wären. Der Fokus liegt auf der Entwicklung einer "Ars Seducendi" und der Analyse von Robert Greenes "24 Gesetze der Verführung" als Beispiel einer Kasualrhetorik der Seduktion.
- Abgrenzung von Seduktion und Oratorium
- Definition und Bedingungen einer "Ars Seducendi"
- Analyse von Robert Greenes "24 Gesetze der Verführung"
- Das Kooperationsprinzip in der Seduktion
- Manipulative Aspekte der Verführung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass Seduktion und Krieg Parallelen aufweisen, indem beide herkömmliche moralische Kategorien scheinbar außer Kraft setzen. Sie verweist auf die martialische Metaphorik in Greenes Werk und die Frage nach den spezifischen Voraussetzungen einer auf seduktiv-persuasive Beeinflussung zielenden Kommunikation. Das Ziel ist die Ableitung von Regelhaftigkeiten für eine "Ars Seducendi", die den Manipulationsvorwurf vermeidet.
2. Was darf der Seduktor, was der Orator nicht darf?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von "Techne/Ars" nach Lausberg und den Anforderungen an eine Kasualrhetorik. Es analysiert die Bedingungen für eine "Ars Seducendi" und untersucht Greenes Verführertypen im Vergleich zum Orator. Es werden die Unterschiede in den erlaubten Mitteln und Strategien zwischen dem Redner und dem Verführer herausgearbeitet und die ethischen Implikationen diskutiert. Die Untersuchung umfasst die Rolle des Kooperationsprinzips und die Fähigkeit des Anti-Verführers, seduktive Strategien zu erkennen und zu kontern.
Schlüsselwörter
Seduktion, Rhetorik, Persuasion, Manipulation, Ars Seducendi, Robert Greene, Kasualrhetorik, Kooperationsprinzip, Techne, Verführung, Oratorium.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Ars Seducendi": Eine Analyse der Verführung im Vergleich zur traditionellen Rhetorik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Seduktion als einen besonderen Fall der Persuasion im Vergleich zur traditionellen Rhetorik. Sie analysiert, welche Mittel und Strategien ein Verführer im Gegensatz zu einem Redner einsetzen darf und entwickelt eine "Ars Seducendi". Robert Greenes "24 Gesetze der Verführung" dienen als Fallbeispiel einer Kasualrhetorik der Seduktion.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die Abgrenzung von Seduktion und Oratorium, die Definition und Bedingungen einer "Ars Seducendi", die Analyse von Robert Greenes Werk, die Rolle des Kooperationsprinzips in der Seduktion und die manipulativen Aspekte der Verführung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Was darf der Seduktor, was der Orator nicht darf?"), und eine Zusammenfassung. Das Hauptkapitel untersucht "Techne/Ars" nach Lausberg, die Anforderungen an eine Kasualrhetorik, die Bedingungen einer "Ars Seducendi" und analysiert Greenes Verführertypen im Vergleich zum Orator. Es werden die Unterschiede in erlaubten Mitteln und Strategien sowie ethische Implikationen diskutiert und die Rolle des Kooperationsprinzips beleuchtet.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung vergleicht Seduktion mit Krieg, hinsichtlich der scheinbaren Außerkraftsetzung herkömmlicher moralischer Kategorien. Sie analysiert die martialische Metaphorik in Greenes Werk und fragt nach den Voraussetzungen seduktiv-persuasiver Kommunikation. Ziel ist die Ableitung von Regelhaftigkeiten für eine "Ars Seducendi", die den Manipulationsvorwurf vermeidet.
Was wird im Hauptkapitel ("Was darf der Seduktor, was der Orator nicht darf?") behandelt?
Das Hauptkapitel definiert "Techne/Ars", untersucht die Anforderungen an eine Kasualrhetorik und analysiert die Bedingungen für eine "Ars Seducendi". Es vergleicht Greenes Verführertypen mit dem Orator, untersucht Unterschiede in erlaubten Mitteln und Strategien, diskutiert ethische Implikationen und die Rolle des Kooperationsprinzips sowie die Fähigkeit des "Anti-Verführers", seduktive Strategien zu erkennen und zu kontern.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Seduktion, Rhetorik, Persuasion, Manipulation, Ars Seducendi, Robert Greene, Kasualrhetorik, Kooperationsprinzip, Techne, Verführung und Oratorium.
Welche Parallele wird zwischen Seduktion und Krieg gezogen?
Die Einleitung zieht eine Parallele zwischen Seduktion und Krieg, indem beide scheinbar herkömmliche moralische Kategorien außer Kraft setzen. Diese Parallele wird durch die Analyse der martialischen Metaphorik in Greenes Werk verdeutlicht.
Welche Rolle spielt das Kooperationsprinzip?
Das Kooperationsprinzip spielt eine entscheidende Rolle in der Analyse der Seduktion. Es wird untersucht, wie dieses Prinzip in der seduktiven Kommunikation funktioniert und wie es von einem "Anti-Verführer" genutzt werden kann, um seduktive Strategien zu erkennen und zu kontern.
Wie wird Robert Greenes Werk in die Analyse eingebunden?
Robert Greenes "24 Gesetze der Verführung" dienen als Fallbeispiel für eine Kasualrhetorik der Seduktion. Die Arbeit analysiert Greenes Verführertypen und deren Strategien im Vergleich zu traditionellen rhetorischen Methoden.
- Quote paper
- Andreas Glombitza (Author), 2005, Seduktion als persuasiver Sonderfall in Robert Greenes "24 Gesetze der Verführung": Was darf der Seduktor, was der Orator nicht darf?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53410