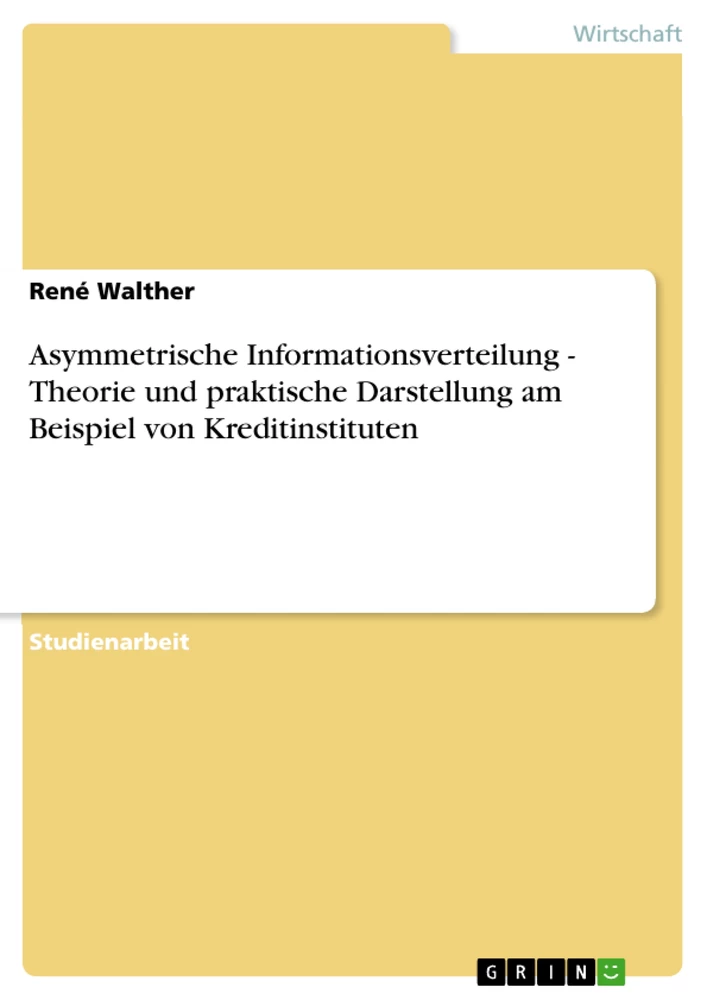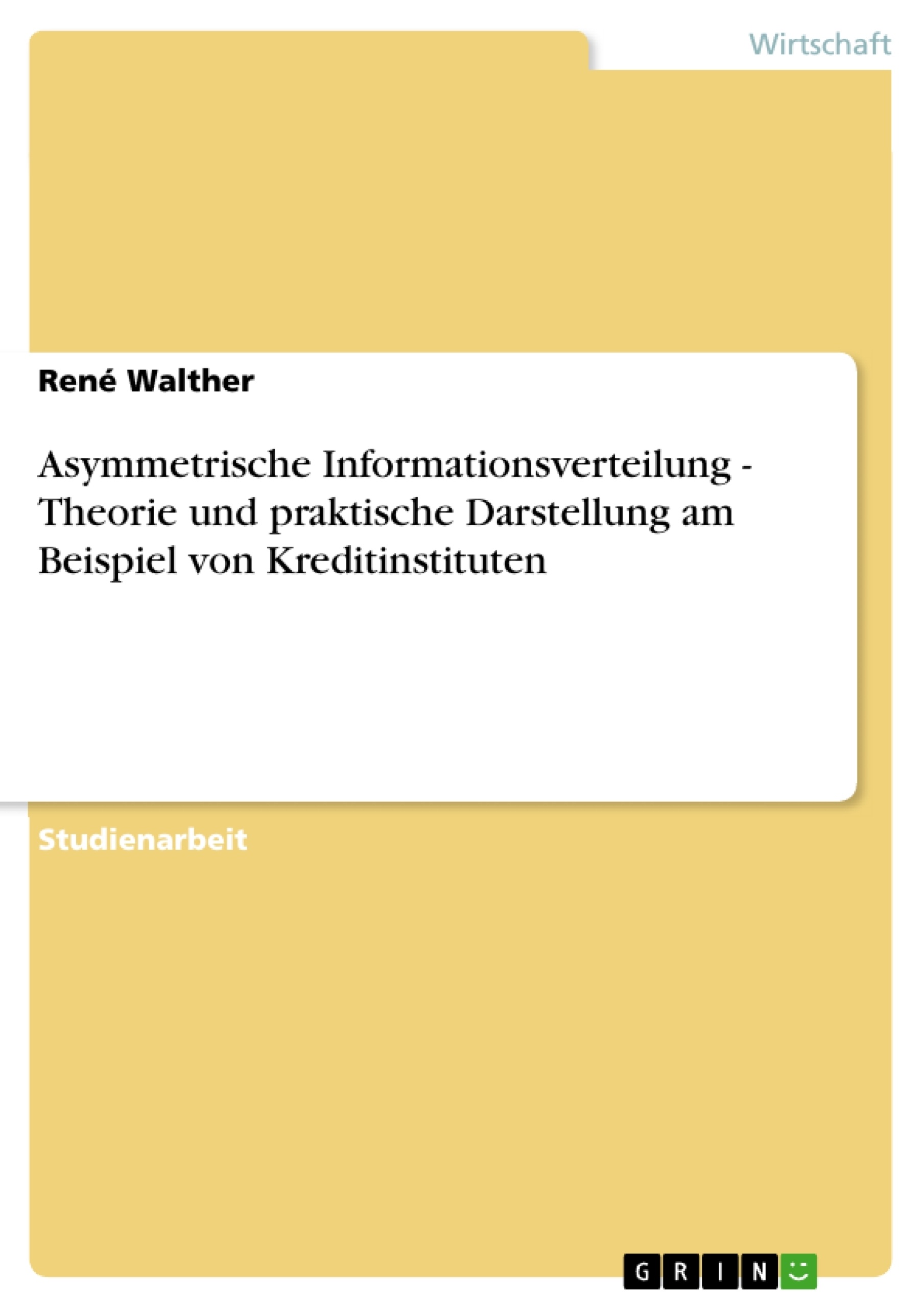In den vergangenen zwei Jahrhunderten nutzte man stets einfache Modelle zur Erklärung wirtschaftlicher Zusammenhänge. Diese Modelle gingen von vollkommener Markttransparenz und einer gleichmäßigen Verteilung von Informationen aus. Es gibt keine Kosten, die durch Informationsbeschaffung entstehen. In einer solchen Modellwelt ließen sich aber Erscheinungen wie Arbeitslosigkeit und Kreditrationierung nicht oder nur unzulänglich erklären. Seit den 70er Jahren gewann die Theorie der asymmetrischen Informationsverteilung (ASIV) immer mehr an Bedeutung. Insbesondere vorangetrieben durch die Arbeiten von George Akerlof und Joseph Stiglitz wurde diese Theorie zu einem Modell entwickelt, welches o.g. Zusammenhänge exakter erklären kann als die einfachen Modelle. In dieser Abhandlung sollen zunächst die Grundlagen der asymmetrischen Informationsverteilung und die Folgen dargestellt werden. Schließlich wird die Anwendung auf Finanzintermediäre und den Markt, in dem diese agieren, vorgenommen. Es soll geklärt werden, wie es zu Kreditrationierung kommt und warum Banken im Umfeld von ASIV auf Gewinn verzichten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Das neoklassische Modell - eine Welt ohne Transaktionskosten
- Die Bedeutung von Transaktionskosten
- Unkenntnis und Unsicherheit als Folge von Transaktionskosten
- Asymmetrische Informationsverteilung
- Adverse Selektion
- Moralisches Risiko
- „Screening“ und „Signaling“ – zwei Marktlösungen
- Kreditinstitute in der Umgebung asymmetrisch verteilter Information
- Die Folgen und die Reaktion des Kreditgebers
- Anwendung der Marktlösungen zur Vermeidung von ASIV
- 2. Einleitung
- Das neoklassische Modell – eine Welt ohne Transaktionskosten
- Die Bedeutung von Transaktionskosten
- Informationsmängel
- Unkenntnis und Unsicherheit als Folge von Transaktionskosten
- Asymmetrische Informationsverteilung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung untersucht die Theorie der asymmetrischen Informationsverteilung (ASIV) und ihre Auswirkungen, insbesondere auf Kreditinstitute. Ziel ist es, die Grenzen des neoklassischen Modells aufzuzeigen und die Bedeutung von Transaktionskosten für das Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge zu erläutern. Die Anwendung der ASIV-Theorie auf den Finanzmarkt und die daraus resultierende Kreditrationierung werden ebenfalls analysiert.
- Das neoklassische Modell und seine Annahmen
- Die Rolle von Transaktionskosten
- Arten von Informationsmängeln (Unkenntnis, Unsicherheit, Ungewissheit)
- Asymmetrische Informationsverteilung und ihre Folgen
- Marktlösungen zur Bewältigung asymmetrischer Information
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit, indem es die Grenzen des neoklassischen Modells in Bezug auf die Erklärung wirtschaftlicher Phänomene wie Arbeitslosigkeit und Kreditrationierung aufzeigt. Es führt die Theorie der asymmetrischen Informationsverteilung (ASIV) als ein besser geeignetes Modell ein und skizziert die zentralen Themen der Abhandlung: die Darstellung der Grundlagen der ASIV, ihrer Folgen und ihrer Anwendung auf Finanzintermediäre, insbesondere im Hinblick auf Kreditrationierung und den Verzicht auf Gewinne durch Banken.
2. Einleitung: Das zweite einleitende Kapitel vertieft die Diskussion der Grenzen des neoklassischen Modells. Es betont die Annahme vollständiger Markttransparenz und die Abwesenheit von Transaktionskosten in diesem Modell und erklärt, warum diese Annahmen zu ungenügenden Erklärungen wirtschaftlicher Realität führen. Die steigende Bedeutung der ASIV-Theorie seit den 1970er Jahren wird hervorgehoben, besonders durch die Arbeiten von Akerlof und Stiglitz. Das Kapitel legt den Fokus auf die Darstellung der ASIV-Grundlagen und ihrer Folgen im Kontext von Finanzintermediären und den damit verbundenen Marktmechanismen, wie z.B. der Kreditrationierung.
Das neoklassische Modell – eine Welt ohne Transaktionskosten: Dieses Kapitel analysiert das neoklassische Modell als ein System ohne Transaktionskosten, in dem vollkommene Information für alle Marktteilnehmer verfügbar ist. Es erklärt, wie dieses Modell zu einer unrealistischen Darstellung wirtschaftlicher Vorgänge führt, da es Phänomene wie Kreditrationierung nicht erklären kann. Das Weglassen von Transaktionskosten ermöglicht den Akteuren den uneingeschränkten Zugriff auf Informationen und den Abschluss von Arrow-Debreu-Verträgen, die für alle zukünftigen Umweltveränderungen entsprechende Klauseln enthalten. In der Realität fehlen jedoch diese idealen Bedingungen.
Die Bedeutung von Transaktionskosten: Dieses Kapitel betont die entscheidende Rolle von Transaktionskosten im Gegensatz zum neoklassischen Modell. Es definiert Transaktionskosten als Kosten, die mit Austauschbeziehungen und Vertragsabschlüssen verbunden sind. Die Höhe dieser Kosten wird diskutiert und ihr Einfluss auf die Entscheidung von Wirtschaftssubjekten bezüglich Transaktionen wird erläutert. Im Gegensatz zum neoklassischen Modell, wo rationale Entscheidungen auf vollständiger, kostenloser Information beruhen, muss man im realen Modell sowohl Produktions- als auch Transaktionskosten berücksichtigen. Die erhebliche Größe von Transaktionskosten in modernen Marktwirtschaften (geschätzt bis zu 50-60% des Nettosozialprodukts) wird hervorgehoben, um die Unzulänglichkeit des neoklassischen Modells zu verdeutlichen.
Unkenntnis und Unsicherheit als Folge von Transaktionskosten: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Arten von Informationsmängeln, die durch Transaktionskosten entstehen: Unkenntnis, Unsicherheit und Ungewissheit. Es erläutert die Unterschiede zwischen diesen Begriffen und wie sie die Entscheidungen der Marktteilnehmer beeinflussen. Der Fokus liegt dabei auf der Unkenntnis als zentraler Aspekt asymmetrischer Informationsverteilung, da diese sowohl die Qualität und den Preis von Gütern als auch deren Nutzen betreffen kann. Die unterschiedliche Verteilung von Unkenntnis und Information zwischen den Akteuren wird als Grundlage der asymmetrischen Informationsverteilung dargelegt.
Asymmetrische Informationsverteilung: Dieses Kapitel stellt die asymmetrische Informationsverteilung als zentralen Punkt der Principal-Agent-Theorie vor. Es zeigt auf, wie die im vorherigen Kapitel beschriebenen Informationsmängel zu einer ungleichen Informationsverteilung unter den Marktteilnehmern führen. Die Konsequenzen dieser Asymmetrie für wirtschaftliches Handeln werden im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht.
Schlüsselwörter
Asymmetrische Informationsverteilung, Transaktionskosten, Neoklassisches Modell, Kreditrationierung, Informationsmängel, Adverse Selektion, Moralisches Risiko, Screening, Signaling, Principal-Agent-Theorie, Finanzintermediäre, Banken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Abhandlung: Asymmetrische Informationsverteilung und ihre Auswirkungen
Was ist das Hauptthema der Abhandlung?
Die Abhandlung untersucht die Theorie der asymmetrischen Informationsverteilung (ASIV) und ihre Auswirkungen, insbesondere auf Kreditinstitute. Sie zeigt die Grenzen des neoklassischen Modells auf und erläutert die Bedeutung von Transaktionskosten für das Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Anwendung der ASIV-Theorie auf den Finanzmarkt und die daraus resultierende Kreditrationierung.
Welche Modelle werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht das neoklassische Modell, das von vollständiger Markttransparenz und fehlenden Transaktionskosten ausgeht, mit einem Modell, das die ASIV und Transaktionskosten berücksichtigt. Es wird gezeigt, dass das neoklassische Modell unzureichend ist, um Phänomene wie Kreditrationierung zu erklären.
Welche Rolle spielen Transaktionskosten?
Transaktionskosten spielen eine entscheidende Rolle. Sie werden definiert als Kosten, die mit Austauschbeziehungen und Vertragsabschlüssen verbunden sind. Ihr Einfluss auf die Entscheidungen von Wirtschaftssubjekten und die Entstehung von Informationsmängeln wird ausführlich diskutiert. Die erhebliche Größe von Transaktionskosten in modernen Marktwirtschaften wird hervorgehoben.
Welche Arten von Informationsmängeln werden behandelt?
Die Abhandlung unterscheidet zwischen Unkenntnis, Unsicherheit und Ungewissheit als Arten von Informationsmängeln, die durch Transaktionskosten entstehen. Der Fokus liegt dabei auf der Unkenntnis als zentraler Aspekt der ASIV.
Was ist asymmetrische Informationsverteilung (ASIV)?
ASIV beschreibt eine ungleiche Informationsverteilung unter Marktteilnehmern. Die Abhandlung erklärt, wie Informationsmängel zu ASIV führen und welche Konsequenzen diese Asymmetrie für wirtschaftliches Handeln hat. Sie wird im Kontext der Principal-Agent-Theorie betrachtet.
Welche Folgen hat ASIV?
ASIV führt zu verschiedenen Problemen, darunter Adverse Selektion und Moralisches Risiko. Die Abhandlung analysiert die Folgen von ASIV für den Finanzmarkt und die daraus resultierende Kreditrationierung, sowie die Reaktionen von Kreditgebern (z.B. „Screening“ und „Signaling“).
Wie werden Marktlösungen zur Bewältigung von ASIV dargestellt?
Die Abhandlung beschreibt Mechanismen wie „Screening“ und „Signaling“, die als Marktlösungen zur Bewältigung asymmetrischer Information dienen. Diese werden im Kontext von Kreditinstituten und dem Umgang mit ASIV analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Abhandlung?
Die Abhandlung umfasst mindestens zwei einführende Kapitel, die die Grenzen des neoklassischen Modells und die Bedeutung der ASIV-Theorie erläutern. Weitere Kapitel befassen sich mit den Transaktionskosten, Informationsmängeln, ASIV, Marktlösungen und deren Anwendung im Finanzsektor.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Asymmetrische Informationsverteilung, Transaktionskosten, Neoklassisches Modell, Kreditrationierung, Informationsmängel, Adverse Selektion, Moralisches Risiko, Screening, Signaling, Principal-Agent-Theorie, Finanzintermediäre, Banken.
Für wen ist diese Abhandlung relevant?
Diese Abhandlung ist für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere im Bereich Finanzwirtschaft und Mikroökonomie, sowie für alle Interessierten an der Theorie der asymmetrischen Informationsverteilung und ihren Auswirkungen auf reale Märkte relevant.
- Citation du texte
- René Walther (Auteur), 2004, Asymmetrische Informationsverteilung - Theorie und praktische Darstellung am Beispiel von Kreditinstituten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53240