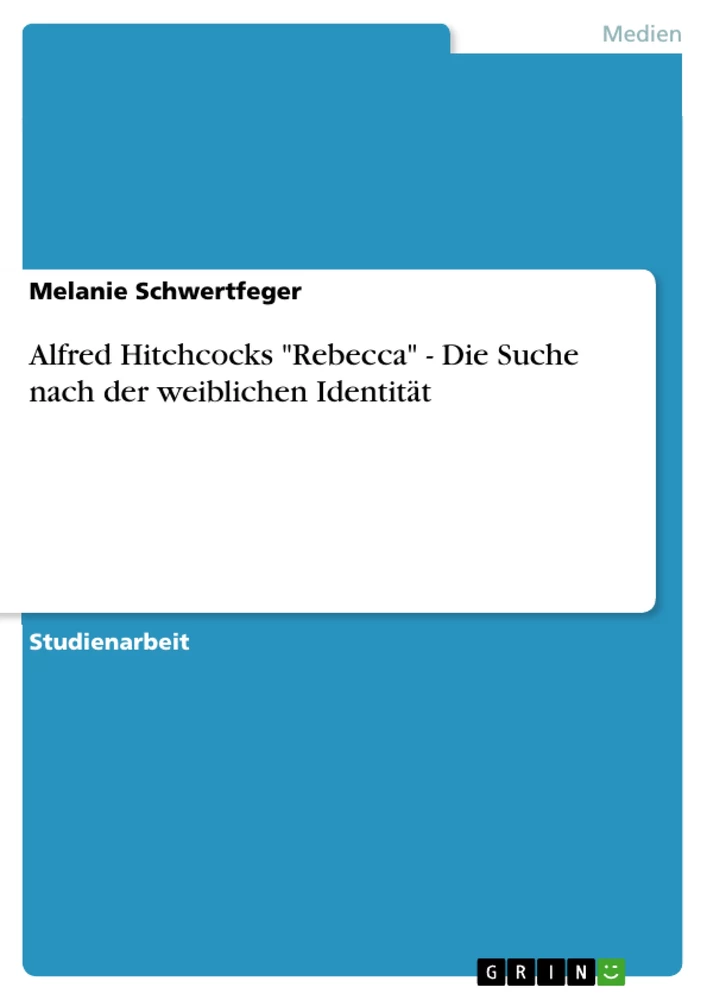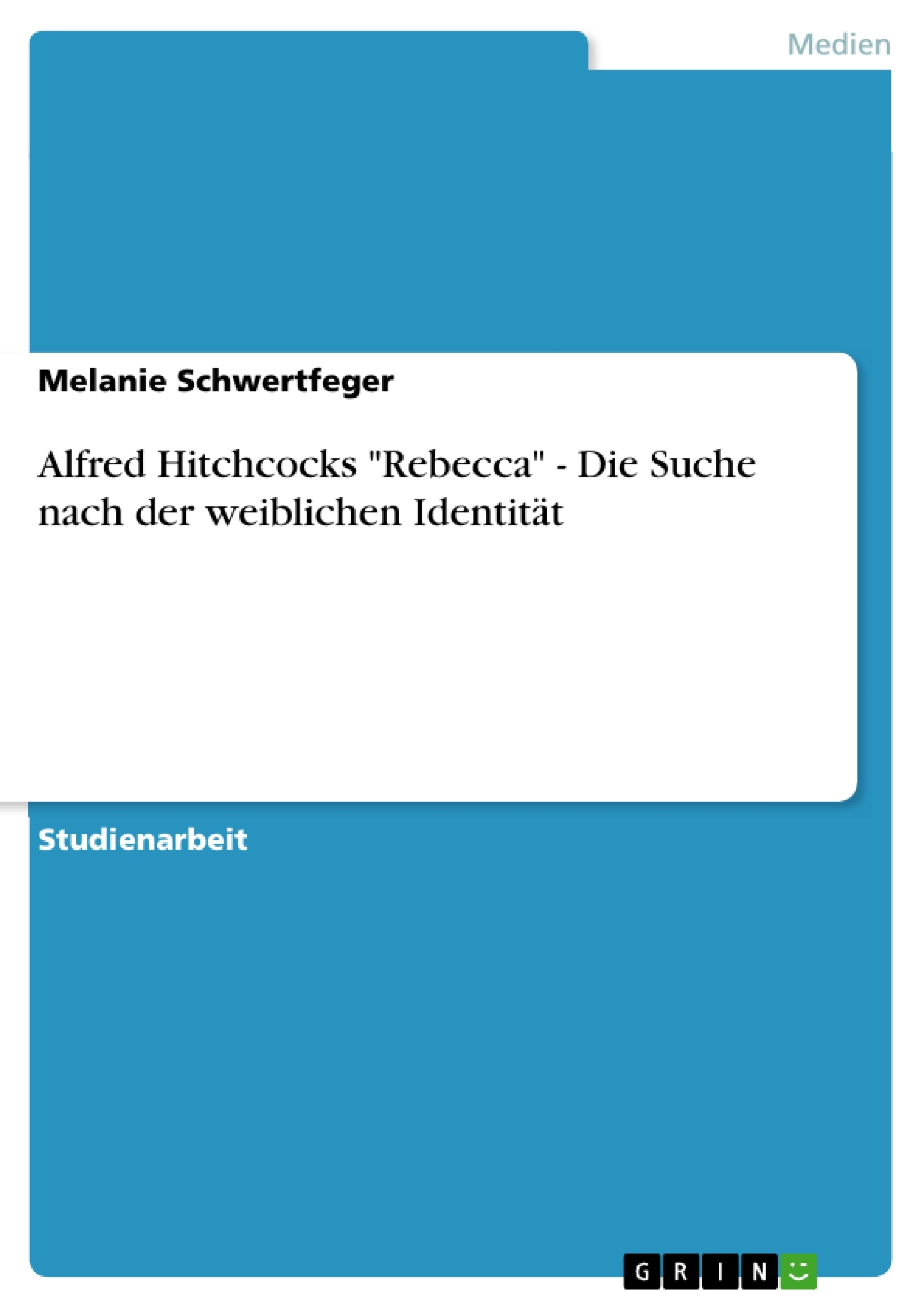Als Alfred Hitchcock 1939 mit seiner Familie in die USA ging, tat er dies auf Einladung des dort damals erfolgreichsten Produzenten, David O. Selznick. Der Niedergang der Filmindustrie hatte seinen Höhepunkt in England zwar schon überwunden, doch Hitchcock fehlte es hier an ausreichend Anerkennung. Er sagte hierzu später: „Die Kunst des Filme Machens wurde von den Intellektuellen oft verachtet. … Kein Engländer, der etwas auf sich hielt, hätte sich dabei ertappen lassen, ins Kino zu gehen. Das machte man einfach nicht.“ Besonders attraktiv waren aber auch die vorhandenen Ressourcen, die ihm Hollywood und in diesem Fall die Selznick-Studios boten. Die größeren Budgets und die gesteigerten technischen Innovationen der amerikanischen Studios versprachen Hitchcock optimale Bedingungen für seine Arbeit. Doch im Gegensatz zu den künstlerischen Freiheiten, die er innerhalb des englischen Produzenten- und Studiosystems genossen hatte, galt in Hollywood damals der Produzent als der Filmemacher. Der Regisseur war nur für die Umsetzung seiner Vorstellungen zuständig. „In those days the individual producer was the man who made the pictures. He was king.”Alfred Hitchcock in “In the Hall of Mogul Kings” veröffentlicht in der London Times am 23. Juni 1969. Aus dieser Erfahrung, im Laufe der nächsten Jahre, zog er die Konsequenzen und wurde selbst zum Produzenten seiner Filme.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Hinter den Kulissen
- 2.1 Selznick und Hitchcock - Der erste Film in Amerika
- 2.2 Der Kampf ums Drehbuch
- 2.2.1 Änderungen am Original von Daphne du Maurier
- 2.3 Casting und Schauspieler
- 2.4 Zahlen, Daten und Fakten zum Film
- 3.0 Inhaltliche Analyse
- 3.1 Psychoanalytische Interpretationsansätze
- 3.1.1 Das Kind in ihr – Begehren des Vaters und Ablösung von der Mutter
- 3.1.2 „Werde nie erwachsen!“
- 3.2 R. de W. Der Terror einer Toten
- 3.2.1 Die Macht der Mutter
- 3.2.2 Identifikation mit der Weiblichkeit
- 3.2.3 Missglückte Selbstfindung
- 3.3 Weibliche Stärke und männliche Schwäche
- 3.4 Rebecca als Femme Fatale – Bedrohung der männlichen Macht
- 3.5 Die weibliche Identität – namenlos im Patriarchat
- 3.1 Psychoanalytische Interpretationsansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Alfred Hitchcocks Film „Rebecca“ unter verschiedenen interpretativen Ansätzen. Ziel ist es, die Geschichte aus feministischer Perspektive zu beleuchten und die Darstellung weiblicher Identität im Kontext des Patriarchats zu analysieren. Dabei werden sowohl psychoanalytische als auch biografische Aspekte berücksichtigt.
- Weibliche Identität und Identitätsfindung im Film
- Die Rolle der Frau im Patriarchat und die Darstellung weiblicher Stärke und Schwäche
- Psychoanalytische Interpretationen des Films als weibliches Ödipus-Drama
- Die Beziehung zwischen Hitchcock und Selznick und deren Einfluss auf die Filmproduktion
- Der Vergleich zwischen Romanvorlage und Film
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt den Fokus auf die Suche nach der weiblichen Identität in Alfred Hitchcocks Film „Rebecca“. Sie skizziert die Methode der Analyse, die sowohl inhaltliche als auch biografische Aspekte des Films berücksichtigt. Die Einleitung stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor und gibt einen Überblick über die Struktur der folgenden Kapitel.
2.0 Hinter den Kulissen: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Films „Rebecca“, beginnend mit der Zusammenarbeit zwischen Hitchcock und Selznick in Hollywood. Es beschreibt die Herausforderungen bei der Adaption des Romans von Daphne du Maurier, den Castingprozess und die Produktion des Films. Der Fokus liegt auf den besonderen Umständen und den Kompromissen, die Hitchcock in Hollywood eingehen musste, im Gegensatz zu seinen früheren Arbeiten in England. Die Kapitel detaillieren die finanziellen und künstlerischen Aspekte der Produktion.
3.0 Inhaltliche Analyse: Dieser Abschnitt bietet eine eingehende Analyse des Inhalts von „Rebecca“. Er untersucht den Film unter verschiedenen psychoanalytischen Perspektiven, indem er die Protagonistin Joan Fontaine als Figur mit einer komplexen psychischen Entwicklung und dem Kampf um Selbstfindung darstellt. Dabei werden die Konzepte von Mutter-Tochter-Beziehungen, der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Rolle der "unsichtbaren" Rebecca im Leben der Protagonistin untersucht. Es werden zudem die Beziehungen zwischen weiblicher Abhängigkeit und männlicher Kontrolle, sowie das Thema des weiblichen Masochismus und männlichen Sadismus diskutiert, um die komplexe Darstellung weiblicher Identität im Kontext eines patriarchalen Systems zu erhellen. Das Kapitel vergleicht die dargestellten weiblichen und männlichen Charaktere und deren jeweilige Stärken und Schwächen.
Schlüsselwörter
Alfred Hitchcock, Rebecca, Daphne du Maurier, Filmdeutung, Psychoanalyse, Weibliche Identität, Patriarchat, Geschlechterverhältnisse, Hollywood, David O. Selznick, Feministische Filmtheorie, Mutter-Tochter-Beziehung, Identitätsfindung.
Häufig gestellte Fragen zu „Rebecca“: Eine feministische Filmanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Alfred Hitchcocks Film „Rebecca“ aus feministischer Perspektive. Der Fokus liegt auf der Darstellung weiblicher Identität im Kontext des Patriarchats und der Identitätsfindung der Protagonistin. Die Analyse berücksichtigt sowohl psychoanalytische als auch biografische Aspekte der Filmproduktion.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit untersucht die weibliche Identität und Identitätsfindung im Film, die Rolle der Frau im Patriarchat und die Darstellung weiblicher Stärke und Schwäche. Sie beleuchtet psychoanalytische Interpretationen des Films als weibliches Ödipus-Drama, die Beziehung zwischen Hitchcock und Selznick und deren Einfluss auf die Filmproduktion sowie den Vergleich zwischen Romanvorlage und Film. Die Analyse umfasst die Mutter-Tochter-Beziehung, den Einfluss der „unsichtbaren“ Rebecca und die komplexe Darstellung weiblicher Identität im patriarchalen System.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein und skizziert die Methodik. Kapitel 2 („Hinter den Kulissen“) beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Films, die Zusammenarbeit von Hitchcock und Selznick, den Castingprozess und die Produktion. Kapitel 3 („Inhaltliche Analyse“) bietet eine detaillierte Analyse des Filminhalts unter verschiedenen psychoanalytischen Perspektiven, untersucht die Darstellung weiblicher und männlicher Charaktere und deren Stärken und Schwächen, sowie die Beziehungen zwischen weiblicher Abhängigkeit und männlicher Kontrolle.
Welche psychoanalytischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit nutzt psychoanalytische Ansätze, um die komplexe psychische Entwicklung der Protagonistin Joan Fontaine und ihren Kampf um Selbstfindung zu analysieren. Konzepte wie Mutter-Tochter-Beziehungen, die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und die Rolle der „unsichtbaren“ Rebecca werden untersucht. Die Beziehung zwischen weiblicher Abhängigkeit und männlicher Kontrolle sowie das Thema weiblicher Masochismus und männlichen Sadismus werden im Kontext des Patriarchats diskutiert.
Wie wird der Film im Vergleich zum Roman behandelt?
Die Arbeit vergleicht die Romanvorlage von Daphne du Maurier mit der Filmadaption von Hitchcock. Sie beleuchtet die Herausforderungen bei der Adaption und die Änderungen, die Hitchcock am Original vorgenommen hat.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Alfred Hitchcock, Rebecca, Daphne du Maurier, Filmdeutung, Psychoanalyse, Weibliche Identität, Patriarchat, Geschlechterverhältnisse, Hollywood, David O. Selznick, Feministische Filmtheorie, Mutter-Tochter-Beziehung, Identitätsfindung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Geschichte von „Rebecca“ aus einer feministischen Perspektive zu beleuchten und die Darstellung der weiblichen Identität im Kontext des Patriarchats zu analysieren. Sie untersucht die komplexe psychische Entwicklung der Protagonistin und die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern im Film.
- Arbeit zitieren
- Melanie Schwertfeger (Autor:in), 2005, Alfred Hitchcocks "Rebecca" - Die Suche nach der weiblichen Identität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53190