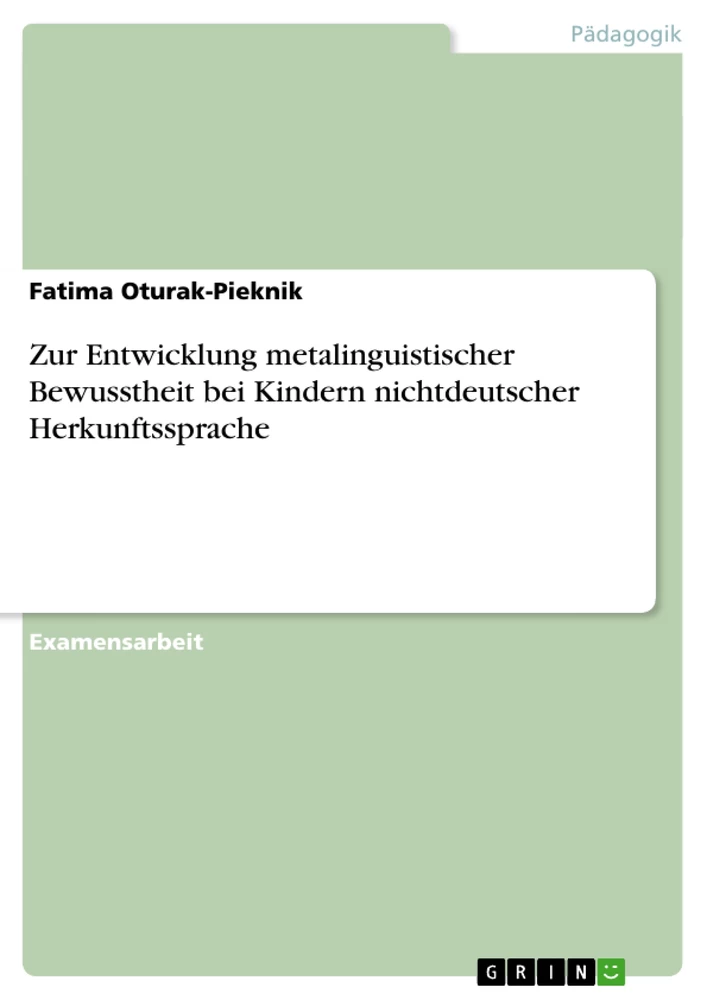1. Einleitung
Es kommt immer wieder vor, dass Kinder aus Migrantenfamilien (teilweise bis hin zur 4. Generation) eingeschult werden und zu Beginn der Schulpflicht mit kaum nennenswerten Sprachkenntnissen der deutschen Sprache ausgestattet sind. Nach Glumpler und Apeltauer scheint dies ein "neueres Phänomen" zu sein. Häufiges Beklagen der Lehrkräfte über den sprachlichen Stand der Schüler/Innen und auch Frustration in punkto Sprachentwicklung, trotz großer Bemühungen der Lehrer/Innen, kommt häufig zum Vorschein.
In meiner Arbeit werde ich zwar nicht auf das oben genannte Problem eingehen, doch werde ich versuchen aufzuzeigen, inwieweit Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache über ein "Sprachgefühl" oder gar über ein metasprachliches Bewusstsein verfügen. Dies wird mein Schwerpunkt in der vorliegenden Arbeit sein.
Da ich vermute, dass Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache eine frühe metalinguistische Entwicklung oder zumindest ein spezifisches Bewusstsein für Sprache entwickeln, dies aber häufig verkannt wird, habe ich mich entschlossen in Form einer wissenschaftlichen Hausarbeit dieser Vermutung nachzugehen. Durch meine Themenwahl: "Gespräche über Texte. Zur Entwicklung metalinguistischer Bewusstheit bei Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache", sehe ich die Möglichkeit, anhand der Äußerungen der Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache festhalten zu können, auf welcher sprachlichen Ebene sie sich befinden. Dieser Frage werde ich durch eine 3 - wöchige Beobachtung in zwei Grundschulen nachgehen. Meine Zielgruppen sind zwei Klassen der 3. Jahrgangsstufe zweier Frankfurter Schulen. Meine Fragen lauten wie folgt:
a. Welche Äußerungen werden über den vorliegenden Text von den Schüler/Innen gemacht?
b. Was ist für sie Gesprächsthema? / Was ist ihnen wichtig?
c. Wie klinken sie sich in das Thema ein?
d. Mit wem sprechen sie über den Text?
e. Ist eine Fachsprache vorhanden? / Wie ist die Beteiligung am Fachgespräch?
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- Teil 1
- 2. Was sagt uns Wode zum Thema Psycholinguistik?
- 2.1 Was bedeutet die Theorie Wodes für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache?
- 2.2 Merkmale der Persönlichkeitsstruktur nach Wode
- 2.3 Zusammenfassung von Wode
- 3. Verschiedene Standpunkte der Wissenschaft zur Metalinguistik
- 3.1 Jakob Ossner zum Thema Metalinguistik
- 3.1.1 Differenzierung der Begriffe „Sprachthematisierung-Sprachaufmerksamkeit“ in Bezug auf die Metalinguistik (J. Ossner)
- 3.2 Hildegard Gornik und ihre Position zur metasprachlichen Entwicklung bei Kindern
- 3.3 Gudula Lists Bezug zur Entwicklung metasprachlicher Fähigkeiten (aus der Sicht der Sprachpsychologie)
- 3.3.1 Das Sprachmodell Gomberts, bezogen auf die Darstellung von G. List
- 3.4 Raphael Bertheles Standpunkt zur Metalinguistik
- 3.5 Zusammenfassung der verschiedenen Standpunkte
- Teil 2 A
- 4. Die verschiedenen Spracherwerbstypen
- 5. Zum Problem der Fachsprachen
- 5.1 Sprachliche Bezugsnormen in der Schule
- Teil 2 B
- 16. Ablauf zum praktischen Teil, Beobachtungsphase
- 6.1 Zielgruppe
- 6.1.1 Methodische Grundlagen
- 6.1.2 Ablauf
- 6.1.3 Gesprächsprotokolle
- 7. Beobachtung in der Grundschulklasse, 3b, Comeniusschule, VPN 1 und VPN 2
- 7.1 Zusammensetzung der Klasse 3b (nichtdeutscher Schüler/Innen)
- 7.1.2 Die Sitzordnung der Klasse 3b, Comeniusschule
- 8. Gesprächsprotokolle (Comeniusschule) VPN 1 und VPN 2
- 8.1 Comeniusschule, 11.04.2002, Donnerstag, 3b
- 8.1.1 Unterrichtsinhalt
- 8.1.2 Gesprächsprotokoll (1)
- 8.1.3 Analyse zum Gesprächsverhalten von VPN 1 und VPN 2
- 8.1.4 Bemerkungen zur Semantik, zur Morphologie und Syntax
- 8.1.5 Analyse zum Gesprächsverhalten der Lehrerin unter dem Aspekt der sozioemotionalen Färbung
- 8.2 Comeniusschule, 12.04.2002, Freitag, 3b
- 8.2.1 Unterrichtsinhalt
- 8.2.2 Gesprächsprotokoll (2)
- 8.2.3 Analyse zum Gespräch von VPN 1 und VPN 2
- 8.2.4 Bemerkungen zur Semantik, zur Morphologie und Syntax
- 8.2.5 Analyse zum Gesprächsverhalten der Lehrerin unter dem Aspekt der sozioemotionalen Färbung
- 9. Beobachtung in der Grundschulklasse, 3c, Münzengergerschule, VP 1 UND VP 2
- 9.1 Zusammensetzung der Klasse 3c, Münzenbergerschule (nichtdeutscher Schüler/Innen)
- 9.1.2 Die Sitzordnung der Klasse 3c
- 10. Gesprächsprotokolle (Münzenbergerschule)
- 10.1 Münzenbergerschule, 22.04.2002, Montag, 3c
- 10.1.1 Unterrichtsinhalt
- 10.1.2 Gesprächsprotokoll (1a)
- 10.1.3 Analyse zum Gespräch von VPN 1 und VPN 2
- 10.1.4 Bemerkungen zur Semantik, zur Morphologie und Syntax
- 10.1.5 Analyse zum Gesprächsverhalten der Lehrerin unter dem Aspekt der sozioemotionalen Färbung
- 10.2 Münzenbergerschule, 23.04.2002, Dienstag, 3c
- 10.2.1 Unterrichtsinhalt
- 10.2.2 Gesprächsprotokoll (2a)
- 10.2.3 Analyse zum Gespräch von VPN 1 und VPN 2
- 10.2.4 Bemerkungen zur Semantik, zur Morphologie und Syntax
- 10.2.5 Analyse zum Gesprächsverhalten der Lehrerin unter dem Aspekt der sozioemotionalen Färbung
- 10.3 Münzenbergerschule, 24.04.2002, Mittwoch, 3c
- 10.3.1Unterrichtsinhalt
- 10.3.2 Gesprächsprotokoll (3a)
- 10.3.3 Analyse zum Gespräch von VPN 1 und VPN 2
- 10.3.4 Bemerkungen zur Semantik, zur Morphologie und Syntax
- 10.3.5 Analyse zum Gesprächsverhalten der Lehrerin unter dem Aspekt der sozioemotionalen Färbung
- 10.4 Münzenbergerschule, 29.04.2002, Montag, 3c
- 10.4.1Unterrichtsinhalt
- 10.4.2 Gesprächsprotokoll (4a)
- 10.4.3 Analyse zum Gespräch von VPN 1 und VPN 2
- 10.4.4 Bemerkungen zur Semantik, zur Morphologie und Syntax
- 10.4.5 Analyse zum Gesprächsverhalten der Lehrerin unter dem Aspekt der sozioemotionalen Färbung
- 10.5 Münzenbergerschule, 30.04.2002, Dienstag, 3c
- 10.5.1Unterrichtsinhalt
- 10.5.2 Gesprächsprotokoll (5a)
- 10.5.3 Analyse zum Gespräch von VPN 1 und VPN 2
- 10.5.4 Bemerkungen zur Semantik, zur Morphologie und Syntax
- 10.5.5 Analyse zum Gesprächsverhalten der Lehrerin unter dem Aspekt der sozioemotionalen Färbung
- Teil 3
- 11. Gesamtauswertung der beobachteten Unterrichtsstunden
- 12. Gesamtauswertung des Gesprächsverhaltens der Lehrerin unter dem Aspekt der sozioemotionalen Färbung
- 13. Analyse zur gesamten Beobachtungsphase in Bezug auf die Semantik, der Morphologie und der Syntax
- 14. Die Möglichkeit eines interkulturellen Unterrichts
- Entwicklung metasprachlicher Fähigkeiten bei Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache
- Vergleich verschiedener Standpunkte der Wissenschaft zur Metalinguistik
- Analyse von Gesprächsprotokollen aus zwei Grundschulklassen
- Untersuchung des Einflusses der sozioemotionalen Färbung des Gesprächsverhaltens der Lehrerin
- Möglichkeiten eines interkulturellen Unterrichts
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt das Problem von Kindern aus Migrantenfamilien vor, die mit geringen Sprachkenntnissen in die Schule kommen. Die Autorin erläutert ihre Forschungsfrage, die die Entwicklung metasprachlicher Fähigkeiten bei Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache im Fokus hat.
- Kapitel 2: Was sagt uns Wode zum Thema Psycholinguistik?: Dieses Kapitel beleuchtet die Theorie von Wode, die sich mit der Psycholinguistik beschäftigt. Die Relevanz dieser Theorie für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache wird analysiert.
- Kapitel 3: Verschiedene Standpunkte der Wissenschaft zur Metalinguistik: Das Kapitel stellt verschiedene wissenschaftliche Standpunkte zur Metalinguistik dar, darunter die Positionen von Jakob Ossner, Hildegard Gornik und Gudula List.
- Kapitel 4: Die verschiedenen Spracherwerbstypen: Dieses Kapitel untersucht die unterschiedlichen Typen des Spracherwerbs.
- Kapitel 5: Zum Problem der Fachsprachen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle von Fachsprachen im Bildungssystem.
- Kapitel 16: Ablauf zum praktischen Teil, Beobachtungsphase: Hier werden die methodischen Grundlagen und der Ablauf der Beobachtungsphase in zwei Grundschulklassen beschrieben.
- Kapitel 7: Beobachtung in der Grundschulklasse, 3b, Comeniusschule, VPN 1 und VPN 2: Die Zusammensetzung der Klasse 3b an der Comeniusschule und die Sitzordnung werden vorgestellt.
- Kapitel 8: Gesprächsprotokolle (Comeniusschule) VPN 1 und VPN 2: Dieses Kapitel enthält Gesprächsprotokolle aus zwei Unterrichtsstunden in der Klasse 3b an der Comeniusschule und analysiert das Gesprächsverhalten der Schüler/innen und der Lehrerin.
- Kapitel 9: Beobachtung in der Grundschulklasse, 3c, Münzengergerschule, VP 1 UND VP 2: Die Zusammensetzung der Klasse 3c an der Münzenbergerschule und die Sitzordnung werden vorgestellt.
- Kapitel 10: Gesprächsprotokolle (Münzenbergerschule): Dieses Kapitel enthält Gesprächsprotokolle aus mehreren Unterrichtsstunden in der Klasse 3c an der Münzenbergerschule und analysiert das Gesprächsverhalten der Schüler/innen und der Lehrerin.
- Kapitel 11: Gesamtauswertung der beobachteten Unterrichtsstunden: Die Autorin fasst die Ergebnisse der Beobachtungsphase zusammen.
- Kapitel 12: Gesamtauswertung des Gesprächsverhaltens der Lehrerin unter dem Aspekt der sozioemotionalen Färbung: Dieses Kapitel analysiert das Gesprächsverhalten der Lehrerin unter dem Aspekt der sozioemotionalen Färbung.
- Kapitel 13: Analyse zur gesamten Beobachtungsphase in Bezug auf die Semantik, der Morphologie und der Syntax: Die Autorin analysiert die Sprache der Schüler/innen im Hinblick auf Semantik, Morphologie und Syntax.
- Kapitel 14: Die Möglichkeit eines interkulturellen Unterrichts: In diesem Kapitel wird die Möglichkeit eines interkulturellen Unterrichts im Hinblick auf die Erkenntnisse der Arbeit diskutiert.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache über ein „Sprachgefühl“ oder ein metasprachliches Bewusstsein verfügen. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der metalinguistischen Entwicklung bei Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache, da vermutet wird, dass diese eine frühe metalinguistische Entwicklung oder zumindest ein spezifisches Bewusstsein für Sprache entwickeln, welches jedoch oft übersehen wird.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Metalinguistik, der Entwicklung metasprachlicher Fähigkeiten, Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache, Gesprächsprotokollen, sozioemotionaler Färbung des Gesprächsverhaltens, Semantik, Morphologie, Syntax und dem Potential eines interkulturellen Unterrichts.
Häufig gestellte Fragen
Was ist metalinguistische Bewusstheit?
Metalinguistische Bewusstheit bezeichnet die Fähigkeit, Sprache nicht nur als Kommunikationsmittel zu nutzen, sondern sie als Objekt des Denkens und der Reflexion zu betrachten.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit in Bezug auf Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache?
Die Arbeit untersucht, inwieweit diese Kinder über ein spezifisches Sprachgefühl oder metasprachliches Bewusstsein verfügen, das im Schulalltag oft verkannt wird.
Welche wissenschaftlichen Standpunkte werden verglichen?
Es werden Positionen von Experten wie Jakob Ossner, Hildegard Gornik, Gudula List und Raphael Berthele zur Metalinguistik herangezogen.
Wie wurde die Untersuchung praktisch durchgeführt?
Durch eine dreiwöchige Beobachtung und Analyse von Gesprächsprotokollen in zwei dritten Klassen an Frankfurter Grundschulen.
Welche sprachlichen Ebenen werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Bereiche Semantik, Morphologie und Syntax in den Äußerungen der Kinder.
Was bedeutet sozioemotionale Färbung im Unterricht?
Es bezieht sich auf die emotionale Ebene des Gesprächsverhaltens der Lehrkraft und deren Einfluss auf die Beteiligung der Schüler am Fachgespräch.
- Quote paper
- Fatima Oturak-Pieknik (Author), 2002, Zur Entwicklung metalinguistischer Bewusstheit bei Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5317