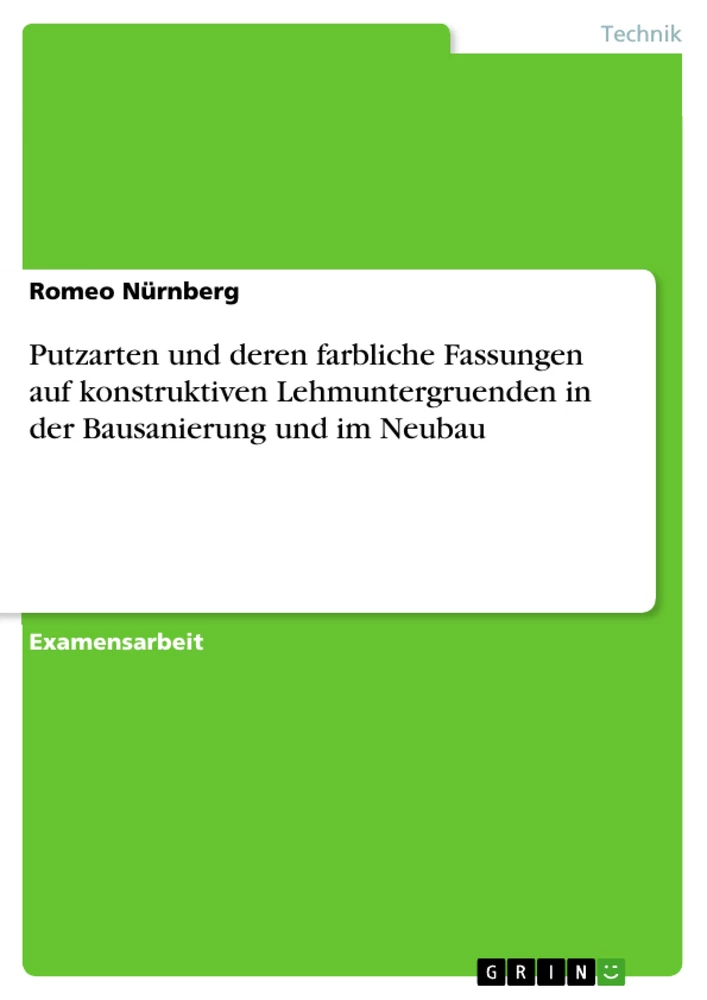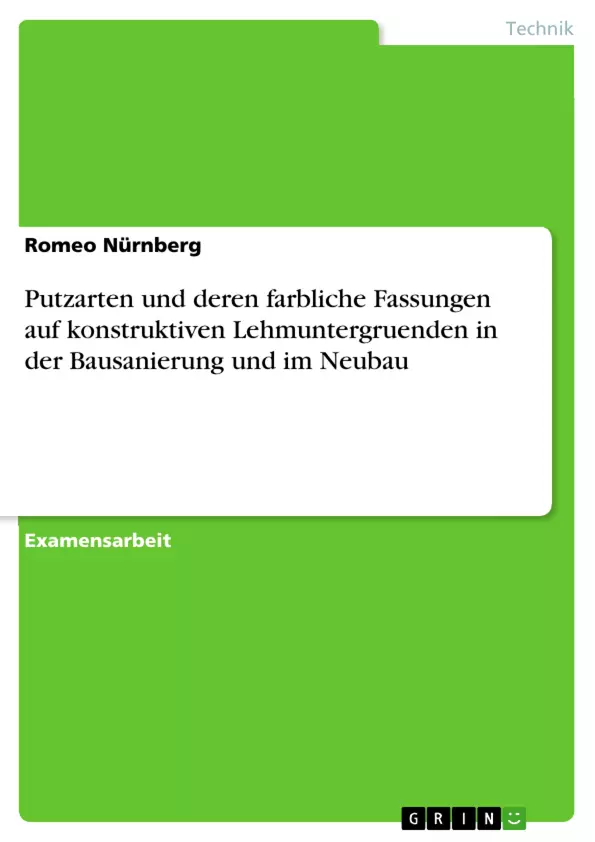Lehm und Kalk ist einer der ältesten Baustoffe der Menschheit - und zählt deshalb zu jenen, die bis heute lange und gründlich erprobt wurden. Schon vor Jahrtausenden hat man die Technik erfunden, mit mineralischen Bindemitteln und damals verfügbaren Zuschlägen das Aussehen von Fassaden und Innenräumen zu verschönern. Unter historischen Putzarten werden im Allgemeinen solche Putzmischungen verstanden, die etwa bis zur Entwicklung und Anwendung von Kunstharz- und Siliconharzputz verwendet wurden. Zeitlich eingegrenzt bedeutet dies etwa bis zum Anfang der 50er Jahre. Lehm, Ton und Flussschlamm sind die ältesten Baustoffe zur Putzherstellung. Durch die Zubereitung z.B. durch Wasserzusatz und Schlämmen, die leichte Verarbeitbarkeit mit den Händen und mit Holzwerkzeug war die Herstellung von Putz einfach. Aufgrund ihrer arbeitstechnischen Eigenschaften wurde dieser Naturputz zum Glätten von Wänden verwendet.
Noch vor wenigen Jahren interessierten sich neben Denkmalpflegern nur äußerst ökologisch überzeugte Bauherren für Lehm- und Kalkputz. Inzwischen sind feuchtigkeitsregulierende Innenputzarten längst aus der „Ökonische“ hervorgetreten. Immer häufiger trifft man nicht nur in historischen Gebäuden auf Lehmputz, sondern auch im modernen Neubau auf Wände, welche mit Lehm- und Kalkputz verputzt sind. Worauf ist diese „Renaissance“ zurückzuführen?
Während Lehmputz von unseren Vorfahren wegen der leichten Verfügbarkeit und seiner geringen Kosten angewandt wurde, beeinflussen heute raumklimatische und immer öfter auch ästhetische Argumente die Entscheidung für diese natürliche Wandbeschichtung. Lehm wird mit verhältnismäßig wenig Energieeinsatz gewonnen, ist vielerorts regional vorhanden und löst keine Allergien aus. Seine herausragende Eigenschaft als Feuchtepuffer macht ihn für moderne Wohn- und Bürobauten interessant. Fassaden aus Glas und Wellaluminium sind heute im Gewerbebau häufig anzutreffen. Im Wohnungsbau werden Innenräume immer häufiger mit Trockenbauelementen ausgebildet. Sind keine massiven Wände vorhanden, so entsteht für die Nutzer ein problematisches Raumklima. Beim Heizen im Winter fehlt der natürliche Wärmespeicher und die Luftfeuchtigkeit ist zu niedrig. Hier liegt die Chance für konstruktive Lehmuntergründe und Lehmputz bzw. neben Kalk- putz als dekoratives und funktionelles Element. Lehm und Kalk nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Vom traditionellen Fachwerkbau sind diese Erfahrungen bekannt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. LEHMPUTZ
- 1.1 Allgemeine Zusammenhänge und Eigenschaften
- 1.1.1 Zur allgemeinen Beschreibung und Zusammensetzung früher und heute
- 1.1.2 Zu den Besonderheiten durch Zusatzmittel und Zuschlagstoffe
- 1.1.2.1 Zu den Zuschlagstoffen
- 1.1.2.2 Zu den Zusatzmitteln
- 1.1.3 Physikalische und chemische Eigenschaften eines Lehmputzes
- 1.1.3.1 zur chemischen Beschaffenheit der Grundbestandteile eines Lehmputzes
- 1.1.3.2 Zum Trockenschwund
- 1.1.3.3 Zur Abriebfestigkeit
- 1.1.3.4 Zur Druckfestigkeit
- 1.1.3.5 Zur Biegezugfestigkeit
- 1.1.3.6 Zur Diffusion von Luftfeuchtigkeit / Raumklima
- 1.1.3.7 Zum Brandverhalten
- 1.1.4 Konstruktive Schlussfolgerung aus den Eigenschaften
- 1.1.4.1 Plastisches Gestalten mit Lehmputz
- 1.1.4.2 Kantenschutz
- 1.2 Unterscheidung der Lehmputzarten
- 1.3 Vorbehandlung der zu verputzenden Lehmoberflächen
- 1.4 Lehmputz auf Trägerschicht in Abhängigkeit von der Schichtdicke
- 1.5 Zu Schäden an Lehmputz
- 1.6 Arbeitstechniken früher und heute
- 1.6.2 Einsatzmöglichkeiten im Hinblick auf die Besonderheiten des Standortes
- 1.6.2.1 Zum Außenraumklima / Regionale Abhängigkeit
- 1.6.2.2 Zum Innenraumklima
- 2. KALKPUTZ
- 2.1 Allgemeine Zusammenhänge und Eigenschaften
- 2.2 Einteilung des Kalkputzes
- 2.3 Kalkputz auf Trägerschicht in Abhängigkeit von der Schichtdicke
- 2.4 Schäden an Kalkputz
- 2.5 Arbeitstechniken früher und heute
- 2.5.2 Einsatzmöglichkeiten im Hinblick auf die Besonderheiten des Standortes
- 2.5.2.1 Zum Außenraumklima
- 2.5.2.2 Zum Innenraumklima
- 3. ANSTRICHE
- 3.1 Faktoren vor einer Beschichtung allgemein
- 3.2 Untergrundprüfungen eines unbeschichteten Lehmputzes vor einer Beschichtung mit geeigneten Anstrichstoffen
- 3.3 Untergrundprüfungen eines unbeschichteten Kalkputzes vor einer Beschichtung mit geeigneten Anstrichstoffen
- 3.4 Beschichtungen auf Lehm- und Kalkputz
- 3.5 Geeignete Beschichtungssysteme für Lehm- und Kalkputz (Auswahl)
- 3.5.1 anorganische Bindemittel
- 3.5.2 organische Bindemittel
- 3.5.3 Zusammenfassung
- 4. ZU HISTORISCHEN UND MODERNEN ANSTRICHREZEPTUREN
- 5. ZUR AUSFÜHRUNG
- 6. ZU DEN INSTANDHALTUNGSINTERVALLEN
- 7. RESÜMEE
- 7.1 Grenzen und Möglichkeiten unserer heutigen Zeit
- Eigenschaften und Anwendung von Lehmputz
- Eigenschaften und Anwendung von Kalkputz
- Geeignete Anstrichstoffe für Lehm- und Kalkputz
- Historische und moderne Anstrichrezepturen
- Schadensbilder und Instandhaltung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht Putzarten und deren farbliche Fassungen auf konstruktiven Lehmuntergründen im Kontext der Bausanierung und des Neubaus. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Eigenschaften verschiedener Putzarten (Lehm- und Kalkputz), ihrer Anwendung und der geeigneten Beschichtungssysteme zu vermitteln.
Zusammenfassung der Kapitel
1. LEHMPUTZ: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Auseinandersetzung mit Lehmputz, beginnend mit einer allgemeinen Beschreibung seiner Zusammensetzung, Eigenschaften und der Entwicklung von traditionellen zu modernen Anwendungen. Es werden die physikalischen und chemischen Eigenschaften, wie Trockenschwund, Abriebfestigkeit und Diffusionsverhalten, umfassend analysiert. Die verschiedenen Lehmputzarten werden nach Rohdichte, Zuschlagstoffen und Verarbeitungsweisen differenziert, und die Vorbehandlung von Lehmoberflächen sowie die Ausführung von Putzaufbauten werden im Detail erläutert. Schließlich werden typische Schäden an Lehmputz und deren Ursachen sowie historische und moderne Arbeitstechniken im Vergleich dargestellt. Das Kapitel betont die Bedeutung der regionalen klimatischen Bedingungen für die Auswahl und Anwendung von Lehmputz.
2. KALKPUTZ: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Kalkputz, analog zum vorherigen Kapitel über Lehmputz. Es beinhaltet eine umfassende Beschreibung der Zusammensetzung, der physikalischen und chemischen Eigenschaften sowie der verschiedenen Einteilungsmethoden von Kalkputz. Die unterschiedlichen Einteilungen erfolgen nach Mörtelgruppen, Bindemitteln, Zuschlagstoffen, Bearbeitungsverfahren und Anwendung (Innen- und Außenbereich). Die Ausführungen zu den Putzträgern und deren Ausführung, sowie die Darstellung typischer Schadensbilder (Rissbildungen etc.) und deren Ursachen bieten eine detaillierte Grundlage. Der Vergleich zwischen historischen und modernen Arbeitstechniken mit ihren jeweiligen Einsatzmöglichkeiten in Abhängigkeit von den Standortgegebenheiten rundet das Kapitel ab.
3. ANSTRICHE: Das Kapitel befasst sich eingehend mit der Beschichtung von Lehm- und Kalkputz. Es werden die Faktoren vor einer Beschichtung, wie Grundanstrichstoffe, Eindringtiefe und Beanspruchungsgruppen, erläutert. Die notwendigen Untergrundprüfungen für sowohl Lehm- als auch Kalkputz werden detailliert beschrieben. Die Kapitel behandelt geeignete Beschichtungssysteme, wobei eine Unterscheidung zwischen anorganischen (z.B. Kalkfarben, Silikatfarben) und organischen Bindemitteln (z.B. Kasein, Dispersionsfarben, Bitumen) vorgenommen wird. Die Ausführungen umfassen auch die Putzvorbehandlung und die verschiedenen Eigenschaften der einzelnen Anstrichstoffe. Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der geeigneten Systeme ab.
4. ZU HISTORISCHEN UND MODERNEN ANSTRICHREZEPTUREN: Dieses Kapitel liefert detaillierte Informationen zu verschiedenen historischen und modernen Anstrichrezepturen. Es werden Kalkanstriche, Kalkkaseinanstriche, moderne Kaseinwandfarben und Lehmfarben behandelt, und jeweils die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche erläutert. Die einzelnen Rezepturen werden im Detail beschrieben, und es wird auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den historischen und modernen Varianten eingegangen.
Schlüsselwörter
Lehmputz, Kalkputz, Anstrichstoffe, Bausanierung, Neubau, Farbfassungen, historische Techniken, moderne Techniken, Materialeigenschaften, Raumklima, Schadensanalyse, Instandhaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Putzarten und deren farbliche Fassungen auf konstruktiven Lehmuntergründen"
Was ist der Inhalt dieser wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Arbeit befasst sich umfassend mit Putzarten (Lehm- und Kalkputz) und deren farblichen Fassungen auf Lehmuntergründen im Kontext von Bausanierung und Neubau. Sie untersucht die Eigenschaften der Putzarten, deren Anwendung, geeignete Beschichtungssysteme, historische und moderne Anstrichrezepturen sowie Schadensbilder und Instandhaltungsmaßnahmen.
Welche Putzarten werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt im Detail Lehmputz und Kalkputz. Für jeden Putztyp werden die Zusammensetzung, die physikalischen und chemischen Eigenschaften, verschiedene Arten und Untertypen, die Verarbeitung, typische Schäden und historische sowie moderne Arbeitstechniken beschrieben.
Welche Aspekte des Lehmputzes werden behandelt?
Der Abschnitt über Lehmputz umfasst die allgemeine Beschreibung und Zusammensetzung (früher und heute), Besonderheiten durch Zusatzmittel und Zuschlagstoffe, physikalische und chemische Eigenschaften (Trockenschwund, Abriebfestigkeit, Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Diffusionsverhalten, Brandverhalten), konstruktive Schlussfolgerungen aus den Eigenschaften (plastisches Gestalten, Kantenschutz), Unterscheidung der Lehmputzarten, Vorbehandlung der Oberflächen, Anwendung in Abhängigkeit von der Schichtdicke, Schadensbilder und historische sowie moderne Arbeitstechniken inklusive der regionalen Abhängigkeit des Außen- und Innenraumklimas.
Welche Aspekte des Kalkputzes werden behandelt?
Die Behandlung des Kalkputzes ist analog zu der des Lehmputzes aufgebaut. Es werden allgemeine Zusammenhänge und Eigenschaften, die Einteilung des Kalkputzes, die Anwendung in Abhängigkeit von der Schichtdicke, Schäden an Kalkputz und historische sowie moderne Arbeitstechniken inklusive der regionalen Abhängigkeit des Außen- und Innenraumklimas behandelt.
Welche Anstrichstoffe werden betrachtet?
Der Abschnitt über Anstrichstoffe konzentriert sich auf geeignete Beschichtungssysteme für Lehm- und Kalkputz. Es werden Faktoren vor der Beschichtung, notwendige Untergrundprüfungen, anorganische (z.B. Kalkfarben, Silikatfarben) und organische Bindemittel (z.B. Kasein, Dispersionsfarben, Bitumen) sowie die Putzvorbehandlung und die Eigenschaften der einzelnen Anstrichstoffe behandelt. Es gibt auch eine Zusammenfassung geeigneter Systeme.
Wie werden historische und moderne Anstrichrezepturen behandelt?
Die Arbeit liefert detaillierte Informationen zu historischen und modernen Anstrichrezepturen, einschließlich Kalkanstriche, Kalkkaseinanstriche, moderne Kaseinwandfarben und Lehmfarben. Die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche werden erläutert, und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen historischen und modernen Varianten werden hervorgehoben.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Eigenschaften und Anwendung von Lehmputz und Kalkputz, geeignete Anstrichstoffe für beide Putzarten, historische und moderne Anstrichrezepturen, Schadensbilder und Instandhaltung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Lehmputz, Kalkputz, Anstrichstoffe, Bausanierung, Neubau, Farbfassungen, historische Techniken, moderne Techniken, Materialeigenschaften, Raumklima, Schadensanalyse, Instandhaltung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Eigenschaften verschiedener Putzarten (Lehm- und Kalkputz), ihrer Anwendung und der geeigneten Beschichtungssysteme zu vermitteln.
- Arbeit zitieren
- Romeo Nürnberg (Autor:in), 2005, Putzarten und deren farbliche Fassungen auf konstruktiven Lehmuntergruenden in der Bausanierung und im Neubau, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53111