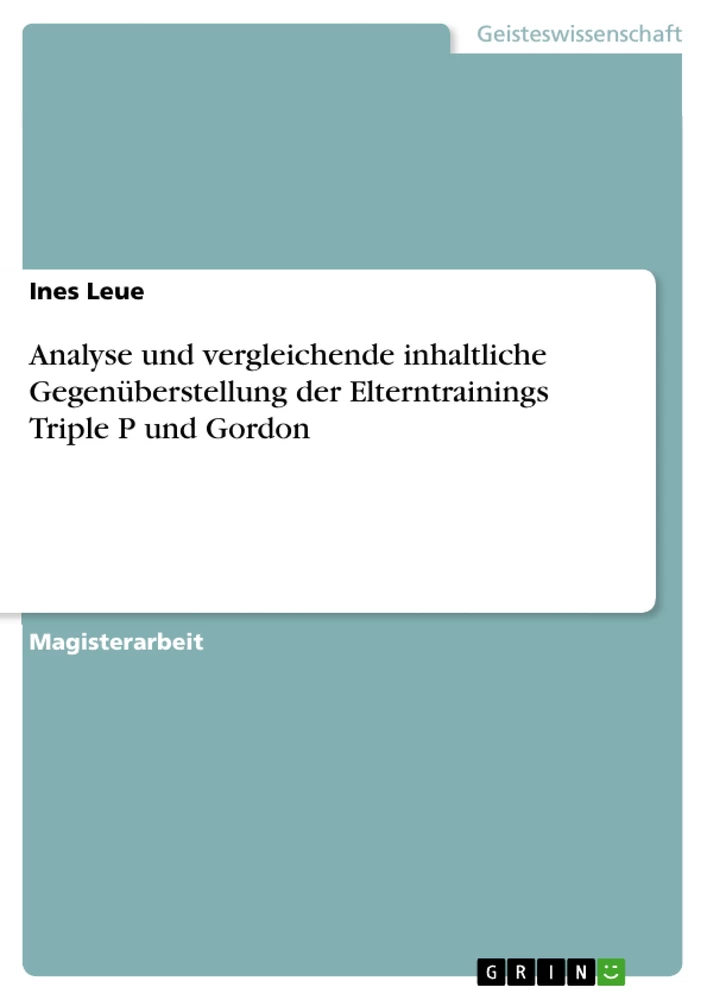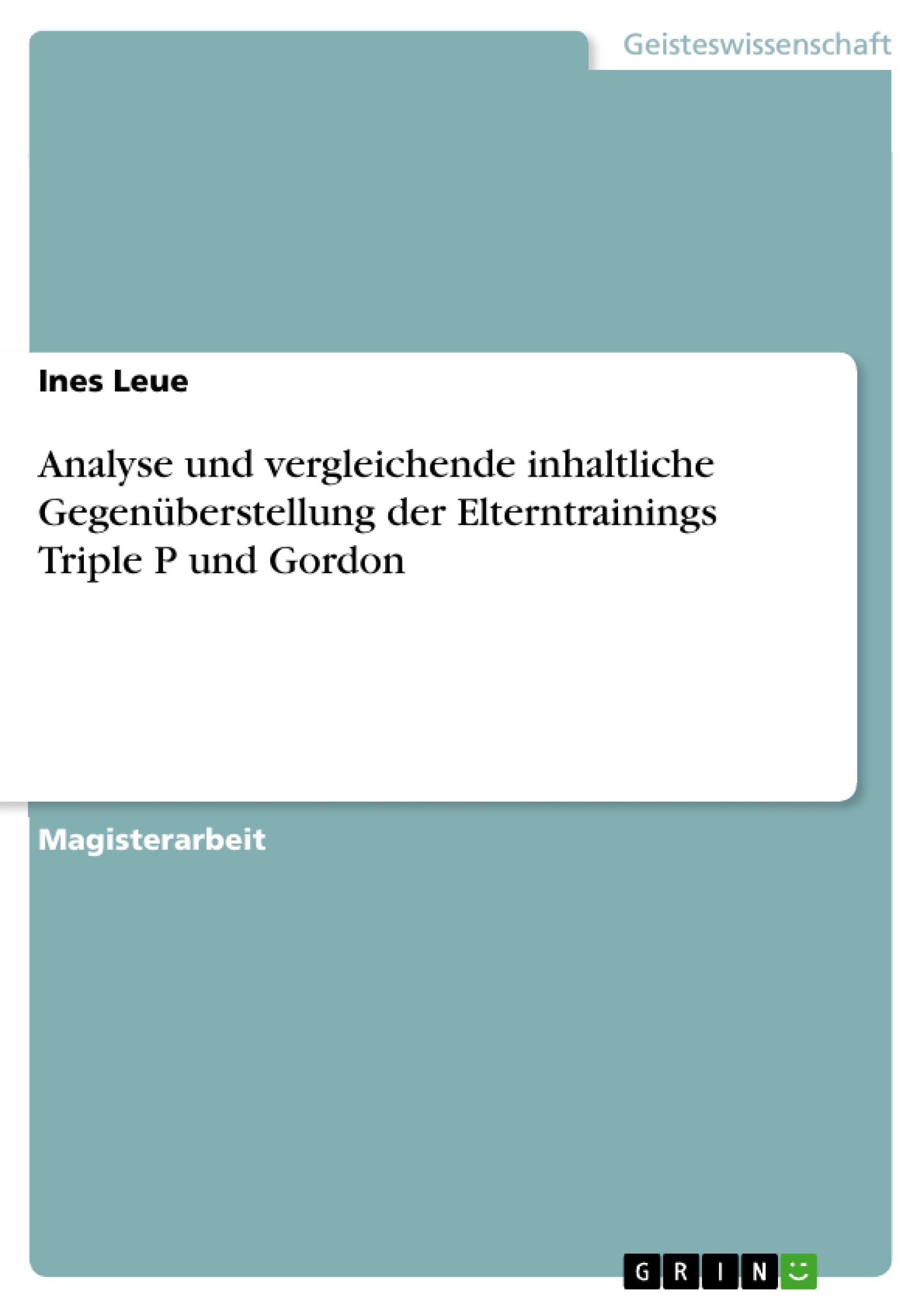Erziehung stellt eine zentrale, alltägliche Aufgabe der Familie dar (vgl. Tschöpe-Scheffler, 2003), kann aber von immer weniger Eltern verantwortungsvoll ausgeübt werden, weil „Väter und Mütter sich unsicher, überfordert, hilflos und allein gelassen fühlen“ (S. 13). Der Spiegel (29/2005; 18.07.05) macht diese Hilflosigkeit zum Titelthema mit der Überschrift „Die Erziehung der Eltern“, „Abends in die Elternschule“ (S. 124) und beginnt den Artikel mit „Deutschlands Väter und Mütter sind überfordert...“. Gleichzeitig wird die Frage diskutiert, ob sich der richtige Umgang mit Kindern überhaupt lernen lässt. „Erziehen üben!“ überschrieb Die Zeit ihr Dossier bezüglich dieses Themas bereits im Oktober 2004 (Ausgabe Nr. 44, vom 21.10.2004). Die Zeitschrift „Spielen und Lernen“ (Heft 11, November 2004) stellt unter „Ghandi im Kinderzimmer“ eine spezielle Kunst des gewaltfreien Widerstands vor, ein Elterncoaching für Familien mit aggressiven und schwierigen Kindern. Die Zeitschrift „Hörzu“ beschäftigt sich unter dem Titelthema „Eltern in der Klemme“ mit der Frage, warum sich „Mutter und Vater als Erzieher heute so schwer tun und was Experten raten, um den Familienfrieden zu retten“ (S.7, Ausgabe 3, 14.01.2005). In all diesen beispielhaft genannten Artikeln werden die allgemeine Hilflosigkeit der Eltern, das „Erziehungselend“ (Hörzu), die Ratlosigkeit sowie die vielen Fragen der Eltern zur Erziehung ihrer Kinder thematisiert. Dass sich viele Väter und Mütter mit den Fragen überdierichtige Erziehung beschäftigen, zeigt neben der Zuschauerquote der „SuperNanny“ (4,4 Millionen, vgl. Gorris, im Spiegel 29/2005; bis zu 5,5 Millionen, vgl. Hoffman, in Hörzu Ausgabe 3) auch der Betrag, der für Erziehungsbücher und Zeitschriften ausgegeben wurde: im vergangenen Jahr waren dies 750 Mio. Euro laut Spiegel, die Hörzu spricht sogar von über 1 Milliarde, die die Deutschen pro Jahr für entsprechende Ratgeberliteratur ausgeben. Dabei kann aus einem breiten Angebot gewählt werden, eine Marktforschung ergab 360 Titel, 360 Erziehungsberater, Handreichungen usw. (vgl. Gorris, Spiegel 29/2005, S. 135). In dieses Angebot reihen sich ein die Vielzahl an Elterntrainings oder Elternschulen. Allgemeine Zielsetzung von Elterntrainings ist es, den Eltern eine professionelle Hilfestellung zu geben, um den Erziehungsalltag besser bewältigen zu können. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretische Einordnung
- 2.1 Erziehung und Erziehungsstile
- 2.2 Eltern-Training
- 3. Triple P: Positive Parenting Programm oder Positives Erziehungsprogramm
- 3.1 Die Ziele
- 3.2 Das Angebot von Triple P
- 3.2.1 Der Mehrebenen- Ansatz
- 3.2.2 Die Materialien
- 3.3 Inhaltliche Darstellung von Triple P
- 3.4 Methoden und Arbeitsweisen im Elterntraining
- 3.5 Evaluation
- 3.6 Theoretischer Hintergrund
- 3.6.1 Verhaltenstherapie
- 3.6.2 Geschichte und Entwicklung
- 3.6.3 Das Menschenbild
- 4. Das Gordon-Familientraining
- 4.1 Die Ziele
- 4.2 Das Verhaltensfenster
- 4.3 Das Prinzip des Problembesitzes
- 4.3.1 Der Bereich des annehmbaren Verhaltens
- 4.3.2 Der Bereich des nicht annehmbaren Verhaltens
- 4.3.3 Der Konflikt
- 4.4 Methoden und Arbeitsweisen im Familientraining
- 4.5 Evaluation
- 4.6 Theoretischer Hintergrund
- 4.6.1 Der klienten- oder personzentrierte Ansatz von Carl Rogers
- 4.6.2 Das Menschenbild der personzentrierten Psychotherapie
- 4.6.3 Die Persönlichkeits- und Beziehungstheorie
- 4.7 Kurzer Vergleich der Verhaltens- und der personzentrierten Therapie
- 5. Vergleichende Gegenüberstellung der Elterntrainings anhand ausgewählter Schwerpunkte
- 5.1 Das Menschenbild
- 5.2 Die Ziele
- 5.3 Kontrolle - Beeinflussung
- 5.3.1 Angemessenes Verhalten fördern (Triple P) – akzeptables Verhalten (Gordon)
- 5.3.2 Umgang mit Problemverhalten (Triple P) - nicht akzeptables Verhalten (Gordon)
- 5.3.3 Diskussion von Konfliktlösungen
- 5.3.4 Konsequenz (Triple P) - Inkonsequenzprinzip (Gordon)
- 5.4 Ausrichtung und Ziele der Elterntrainings
- 6. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert und vergleicht die Elterntrainings Triple P und Gordon. Ziel ist es, die Inhalte und Zielsetzungen beider Programme herauszuarbeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf den zugrundeliegenden Wertvorstellungen und Erziehungsvorstellungen, sowie den unterschiedlichen Menschenbildern. Eine Diskussion der generellen Notwendigkeit von Elternkursen oder ein Vergleich der Effektivität der Programme findet nicht statt.
- Analyse der Inhalte und Ziele von Triple P und Gordon
- Vergleich der Methoden und Arbeitsweisen beider Programme
- Untersuchung der unterschiedlichen Menschenbilder, die den Trainings zugrunde liegen
- Hervorhebung der verschiedenen Erziehungsvorstellungen
- Gegenüberstellung der Konzepte von Kontrolle und Einflussnahme auf das Kind
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel beleuchtet die aktuelle Situation vieler Eltern, die sich in ihrer Erziehungsrolle überfordert und unsicher fühlen. Es verweist auf zahlreiche Medienberichte, die diese Hilflosigkeit thematisieren und auf den wachsenden Markt an Erziehungsratgebern und Elterntrainings hinweisen. Die Arbeit begründet die Wahl der beiden untersuchten Elterntrainings, Triple P und Gordon, und definiert die zentrale Forschungsfrage: Welche Wertvorstellungen und Erziehungsvorstellungen liegen den Inhalten dieser beiden Elterntrainings zugrunde?
2. Theoretische Einordnung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die anschließende Analyse der Elterntrainings. Es werden die Begriffe „Erziehung“ und „Elterntraining“ definiert und in ihren verschiedenen Facetten beleuchtet. Dies dient als Rahmen für das Verständnis der in den folgenden Kapiteln dargestellten Konzepte.
3. Triple P: Positive Parenting Programm oder Positives Erziehungsprogramm: Dieses Kapitel stellt das Elterntraining Triple P ausführlich dar. Es beschreibt die Ziele, das Angebot (inklusive des Mehrebenen-Ansatzes und der Materialien), die inhaltliche Ausrichtung, die Methoden, die Evaluation sowie den verhaltenstherapeutischen Hintergrund und das dazugehörige Menschenbild. Der Fokus liegt auf der systematischen Darstellung des Programms und der Einordnung in den verhaltenstherapeutischen Kontext.
4. Das Gordon-Familientraining: Analog zu Kapitel 3 wird hier das Gordon-Familientraining umfassend präsentiert. Es werden die Ziele, das Verhaltensfenster, das Prinzip des Problembesitzes, die Methoden und die Evaluation beschrieben. Besonderes Augenmerk liegt auf dem personenzentrierten Ansatz und dem humanistischen Menschenbild, das dem Training zugrunde liegt. Der Unterschied zur verhaltenstherapeutischen Orientierung von Triple P wird angedeutet.
5. Vergleichende Gegenüberstellung der Elterntrainings anhand ausgewählter Schwerpunkte: In diesem Kapitel werden Triple P und Gordon anhand ausgewählter Kriterien verglichen. Die Gegenüberstellung fokussiert auf das Menschenbild, die Ziele, unterschiedliche Konzepte von Kontrolle und Beeinflussung, den Umgang mit Problemverhalten und die Diskussion von Konfliktlösungen. Die jeweiligen Ansätze werden detailliert analysiert und ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgestellt.
Schlüsselwörter
Elterntraining, Triple P, Gordon-Familientraining, Erziehungsstile, Verhaltenstherapie, personzentrierte Therapie, Menschenbild, Eltern-Kind-Beziehung, Konfliktlösung, Erziehungsziele, Verhaltenskontrolle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Elterntrainings Triple P und Gordon
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert und vergleicht die beiden Elterntrainingsmethoden Triple P (Positive Parenting Programm) und Gordon-Familientraining. Der Fokus liegt auf den zugrundeliegenden Werten, Erziehungsvorstellungen und Menschenbildern beider Programme. Ein Vergleich der Effektivität oder die allgemeine Notwendigkeit von Elternkursen wird nicht behandelt.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit untersucht die Inhalte und Ziele beider Programme, vergleicht deren Methoden und Arbeitsweisen, analysiert die unterschiedlichen Menschenbilder, die ihnen zugrunde liegen, hebt die verschiedenen Erziehungsvorstellungen hervor und stellt die Konzepte von Kontrolle und Einflussnahme auf das Kind gegenüber.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Eine Einführung, eine theoretische Einordnung der Begriffe Erziehung und Elterntraining, eine detaillierte Darstellung von Triple P, eine detaillierte Darstellung des Gordon-Familientrainings, einen vergleichenden Abschnitt, der beide Methoden anhand ausgewählter Kriterien gegenüberstellt, und abschließend ein Resümee.
Wie wird Triple P in der Arbeit dargestellt?
Kapitel 3 beschreibt Triple P umfassend: Ziele, Angebot (inkl. Mehrebenen-Ansatz und Materialien), inhaltliche Ausrichtung, Methoden, Evaluation und den verhaltenstherapeutischen Hintergrund mit dem dazugehörigen Menschenbild. Der Fokus liegt auf der systematischen Darstellung und Einordnung in den verhaltenstherapeutischen Kontext.
Wie wird das Gordon-Familientraining dargestellt?
Kapitel 4 präsentiert das Gordon-Familientraining analog zu Kapitel 3: Ziele, Verhaltensfenster, Prinzip des Problembesitzes, Methoden, Evaluation und der personenzentrierte Ansatz mit dem humanistischen Menschenbild. Der Unterschied zur verhaltenstherapeutischen Orientierung von Triple P wird hervorgehoben.
Wie werden Triple P und Gordon verglichen?
Kapitel 5 vergleicht beide Methoden anhand von Kriterien wie Menschenbild, Zielen, Konzepten von Kontrolle und Beeinflussung, Umgang mit Problemverhalten und Konfliktlösungen. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der jeweiligen Ansätze werden detailliert analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Elterntraining, Triple P, Gordon-Familientraining, Erziehungsstile, Verhaltenstherapie, personzentrierte Therapie, Menschenbild, Eltern-Kind-Beziehung, Konfliktlösung, Erziehungsziele, Verhaltenskontrolle.
Welche zentrale Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Wertvorstellungen und Erziehungsvorstellungen liegen den Inhalten dieser beiden Elterntrainings zugrunde?
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Schwerpunkte jedes Kapitels kurz und prägnant beschreibt.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum und dient der Analyse von Erziehungsmethoden. Die Informationen sollen für strukturierte, professionelle Themenanalysen im akademischen Kontext verwendet werden.
- Quote paper
- M.A. Ines Leue (Author), 2005, Analyse und vergleichende inhaltliche Gegenüberstellung der Elterntrainings Triple P und Gordon, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/53099