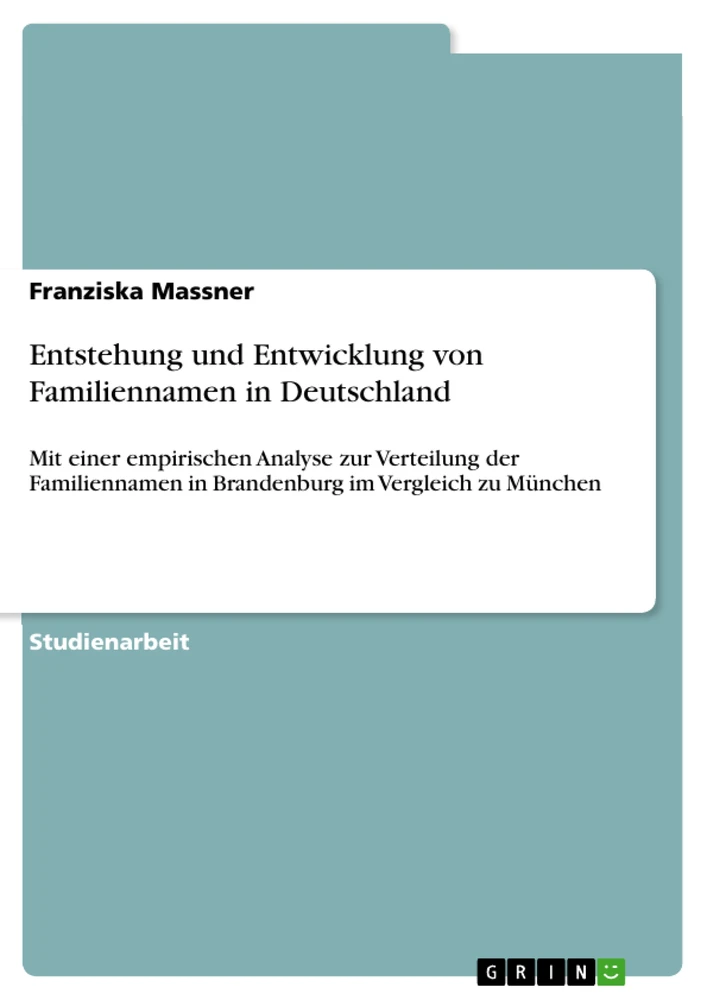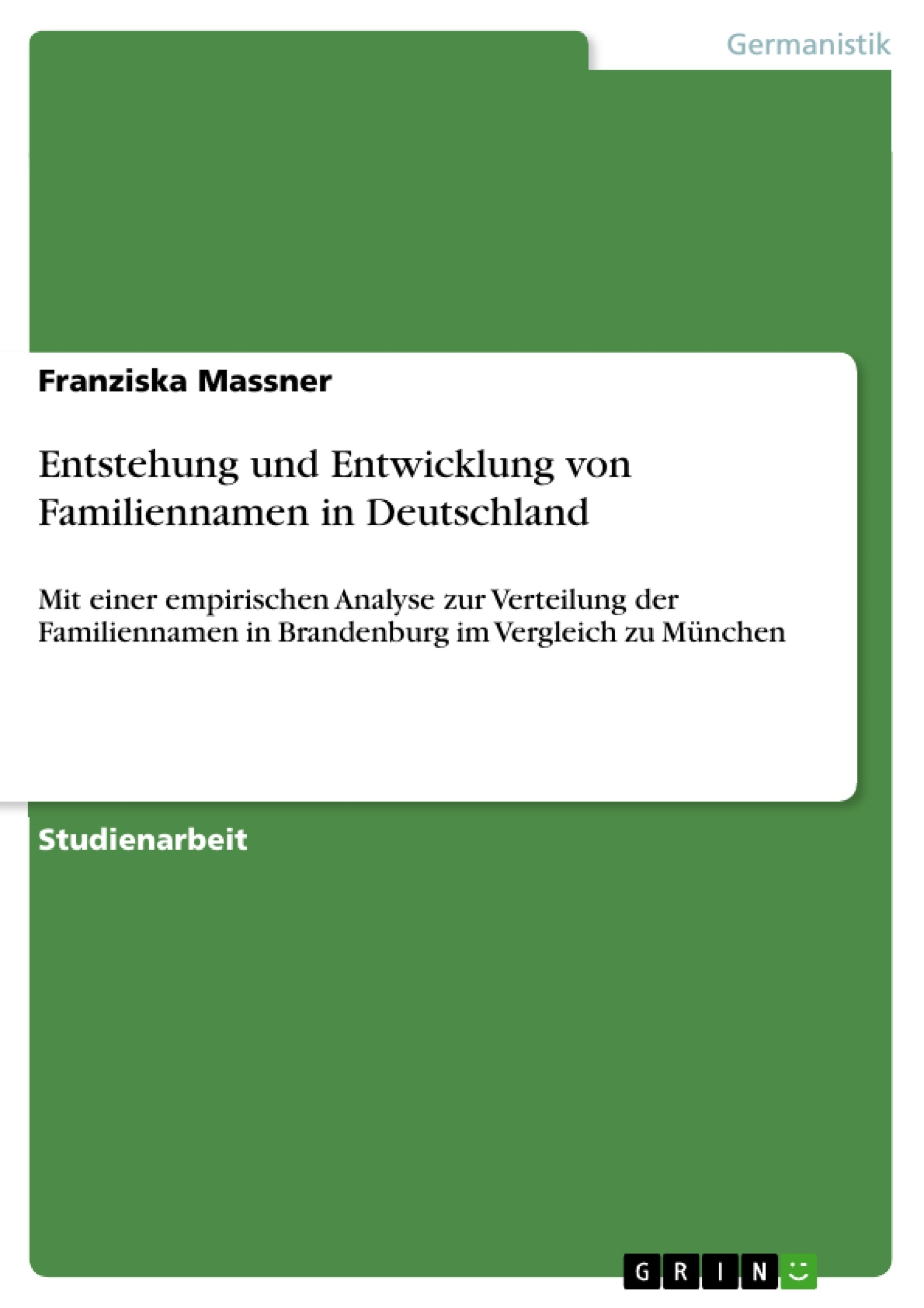"Jeder hundertste heißt Müller"1. Diese Aussage wird wahrscheinlich von Vielen bestätigt werden. Würde man nun Laien fragen, wie dieser Name entstanden ist, könnte wohl auch jeder ohne Probleme die Berufsbezeichnung als Grund für die Entstehung dieses Familiennamens ausmachen. Dass es natürlich noch weit mehr Motive für die Familiennamengebung gegeben hat, soll diese Arbeit zeigen.
Im theoretischen Teil wird daher auf die Entstehung und Entwicklung von Familiennamen eingegangen, sowie auf die einzelnen Bildungstypen und das Phänomen der Sprachlandschaften.
Im empirischen Teil folgt anschließend eine Erhebung der Familiennamen in der Stadt Brandenburg an der Havel. Es soll untersucht werden, wie die Familiennamen hier verteilt sind und welche Besonderheiten es gibt. Dafür wird auch die Verteilung einzelner Namen in der Stadt München herbeigezogen. Der Vergleich der beiden Städte in Bezug auf bestimmte Namen soll die sprachgeographischen Unterschiede der Familiennamengebung in Deutschland verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einnamigkeit und Mehrnamigkeit
- Bildung der Familiennamen
- Familiennamen aus Rufnamen
- Familiennamen nach der Herkunft
- Familiennamen nach der Wohnstätte
- Familiennamen aus Berufsbezeichnungen
- Familiennamen aus Übernamen
- Konkurrenzen bei Familiennamen
- Morphologie und Wortbildung der deutschen Familiennamen
- Familiennamenentwicklung bis in die Gegenwart
- Kulturräume und Sprachgeographie
- Namenräume
- Wortgeographie und Familiennamen
- Einfluss der Slawen
- Empirische Untersuchung zur Verteilung von Familiennamen in Deutschland
- Verteilung der Familiennamen in der Stadt Brandenburg
- Regionale Unterschiede der Familiennamen am Beispiel von Brandenburg und München
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung von Familiennamen in Deutschland. Die Hauptziele sind die Erläuterung der verschiedenen Bildungstypen von Familiennamen und die Analyse der sprachgeographischen Verteilung anhand eines Vergleichs zwischen Brandenburg und München. Die Arbeit basiert auf theoretischen Überlegungen und einer empirischen Untersuchung.
- Entstehung und Entwicklung von Familiennamen in Deutschland
- Die verschiedenen Bildungstypen von Familiennamen (Rufnamen, Herkunft, Wohnstätte, Beruf, Übernamen)
- Sprachgeographische Verteilung von Familiennamen
- Vergleich der Familiennamenverteilung in Brandenburg und München
- Der Übergang von Einnamigkeit zu Mehrnamigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Familiennamenforschung ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie hebt die Bedeutung der Namensgebung hervor und kündigt den Vergleich der Familiennamenverteilung in Brandenburg und München an, um sprachgeographische Unterschiede zu verdeutlichen. Die methodische Vorgehensweise, basierend auf theoretischen Grundlagen und empirischen Daten aus Telefonbüchern, wird kurz erläutert.
Einnamigkeit und Mehrnamigkeit: Dieses Kapitel beschreibt den historischen Wandel vom System der Einnamigkeit zur Mehrnamigkeit. Es wird erläutert, wie man in der Zeit der Einnamigkeit versuchte, Familienmitglieder durch ähnliche Rufnamen zu kennzeichnen, etwa durch Stabreim. Der Übergang zur Mehrnamigkeit wird im Zusammenhang mit der Sesshaftwerdung der Bevölkerung, dem Bevölkerungswachstum und den daraus resultierenden Anforderungen an die Verwaltung erklärt. Die zunehmende Bedeutung der Unterscheidung von Individuen wird anhand von Beispielen aus dem 12. Jahrhundert in Köln verdeutlicht. Die Vorteile des Familiennamens, sowohl zur individuellen Unterscheidung als auch zur Kennzeichnung der Familienzugehörigkeit mit juristischen und ökonomischen Implikationen, werden hervorgehoben.
Bildung der Familiennamen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die fünf Hauptgruppen der Familiennamenbildung: aus Rufnamen (Patronymika und Metronymika), Herkunft, Wohnstätte, Beruf und Übernamen. Es erklärt die Entstehung dieser Namenstypen und zeigt, wie diese verschiedenen Herleitungen zu den heutigen Familiennamen geführt haben. Die ausführliche Beschreibung der einzelnen Kategorien verdeutlicht die Vielfalt der Entstehungszusammenhänge von Familiennamen.
Schlüsselwörter
Familiennamen, Namensforschung, Onomastik, Einnamigkeit, Mehrnamigkeit, Patronymika, Metronymika, Sprachgeographie, Brandenburg, München, Deutschland, Namensgebung, Berufsbezeichnungen, Herkunft, Wohnstätte, Übernamen, Empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung und Verbreitung deutscher Familiennamen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung deutscher Familiennamen. Sie untersucht die verschiedenen Bildungstypen von Familiennamen und analysiert deren sprachgeographische Verteilung, insbesondere im Vergleich zwischen Brandenburg und München.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Übergang von Einnamigkeit zu Mehrnamigkeit, die verschiedenen Bildungstypen von Familiennamen (aus Rufnamen, Herkunft, Wohnstätte, Beruf, Übernamen), die sprachgeographische Verteilung von Familiennamen und einen detaillierten Vergleich der Familiennamenverteilung in Brandenburg und München. Die methodische Vorgehensweise kombiniert theoretische Überlegungen mit einer empirischen Untersuchung.
Welche Bildungstypen von Familiennamen werden erklärt?
Die Arbeit erläutert ausführlich fünf Hauptgruppen der Familiennamenbildung: Familiennamen aus Rufnamen (Patronymika und Metronymika), aus Herkunftsangaben, aus Wohnstätten, aus Berufsbezeichnungen und aus Übernamen. Es wird gezeigt, wie diese verschiedenen Herleitungen zu den heutigen Familiennamen geführt haben.
Wie wird die sprachgeographische Verteilung von Familiennamen untersucht?
Die sprachgeographische Verteilung wird anhand eines Vergleichs der Familiennamenverteilung in Brandenburg und München untersucht. Dieser Vergleich soll regionale Unterschiede verdeutlichen. Die empirische Untersuchung basiert auf Daten, die vermutlich aus Telefonbüchern gewonnen wurden (dies wird in der Zusammenfassung der Einleitung angedeutet).
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema der Familiennamenforschung ein, skizziert den Aufbau der Arbeit und hebt die Bedeutung der Namensgebung hervor. Sie kündigt den Vergleich der Familiennamenverteilung in Brandenburg und München an und erläutert kurz die methodische Vorgehensweise (theoretische Grundlagen und empirische Daten).
Was wird im Kapitel über Einnamigkeit und Mehrnamigkeit behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den historischen Wandel vom System der Einnamigkeit zur Mehrnamigkeit, die Notwendigkeit der Unterscheidung von Individuen im Kontext von Bevölkerungswachstum und Sesshaftwerdung, und die Vorteile des Familiennamens für die individuelle Unterscheidung und die Kennzeichnung der Familienzugehörigkeit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Familiennamen, Namensforschung, Onomastik, Einnamigkeit, Mehrnamigkeit, Patronymika, Metronymika, Sprachgeographie, Brandenburg, München, Deutschland, Namensgebung, Berufsbezeichnungen, Herkunft, Wohnstätte, Übernamen, Empirische Untersuchung.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet Kapitel zu: Einleitung, Einnamigkeit und Mehrnamigkeit, Bildung der Familiennamen (inklusive Unterkapiteln zu den verschiedenen Bildungstypen), Kulturräume und Sprachgeographie (inkl. Einfluss der Slawen), Empirische Untersuchung zur Verteilung von Familiennamen in Deutschland (inkl. Brandenburg und München) und Schlussbetrachtung.
- Quote paper
- Franziska Massner (Author), 2005, Entstehung und Entwicklung von Familiennamen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52811