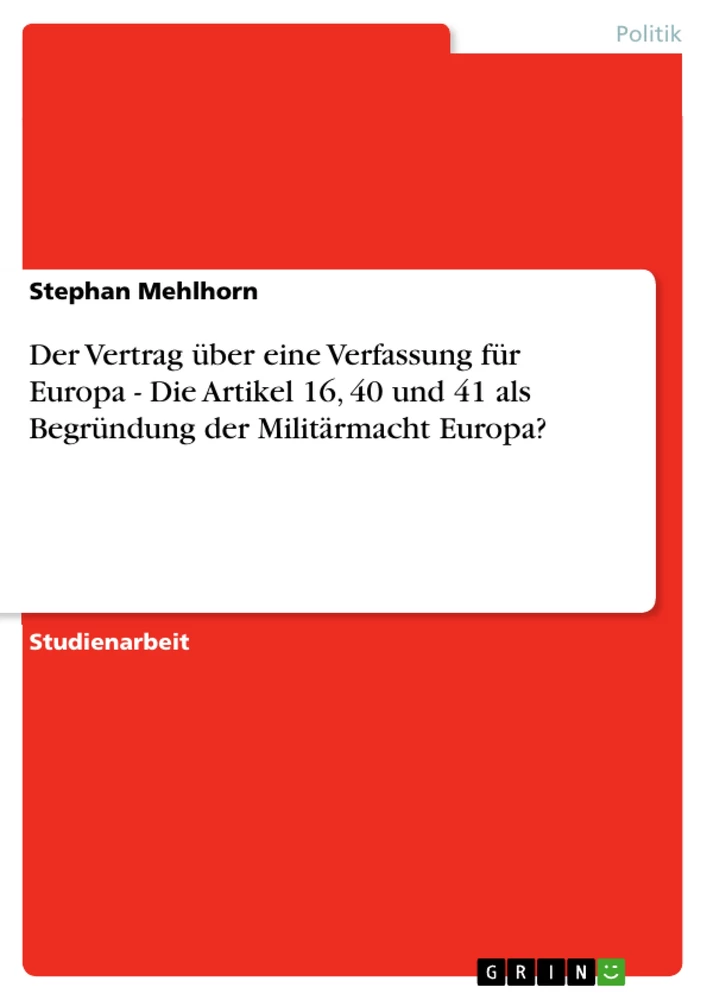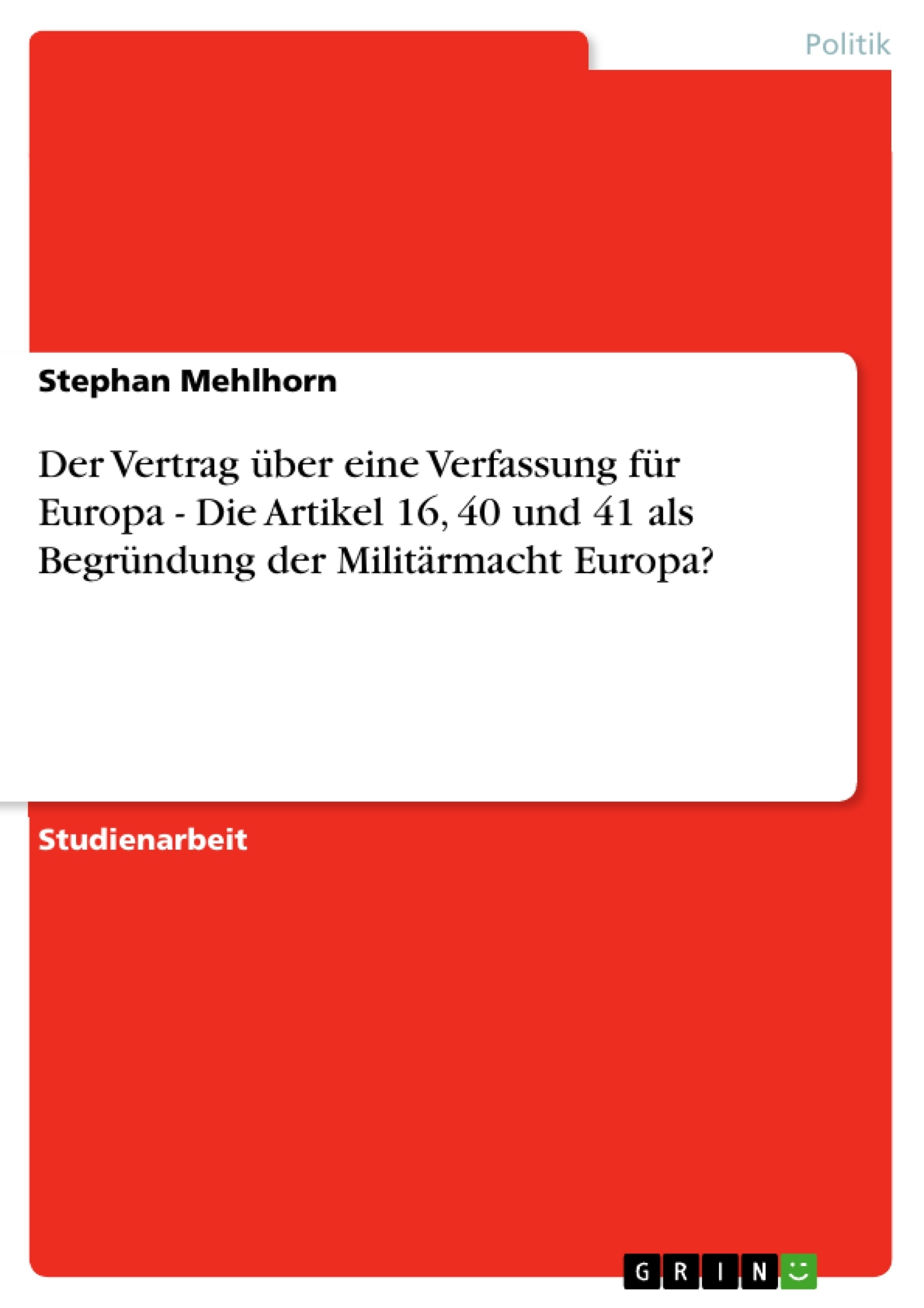„Es ist notwendig, die derzeitige Neustrukturierung der Weltordnung zu nutzen, um die Teilnahme Europas als Global Player zu fördern. […] Ohne militärische Handlungsfähigkeit, ohne die autonome Fähigkeit, militärische Operationen unter der Leitung der Europäischen Union durchzuführen, ohne geeignete militärische Kapazitäten und Ausrüstungen, ohne ein eigenes Informationssystem, ohne ein Budget für militärische Angelegenheiten, das den realen Bedürfnissen entspricht, wird Europa niemals mehr als ein Riese sein, der auf tönernen Füßen steht.“
Nach über 60 Jahren europäischer Nachkriegsgeschichte, nach einer beispiellosen friedlichen Entwicklung und Internationalisierung West-, Mittel- und inzwischen auch Osteuropas; 55 Jahre nach Gründung der EGKS und pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum der Römischen Verträge tritt am 1. November 2006 der Vertrag über eine Verfassung für Europa in Kraft. Dieser ersetzt dann die bisherigen Verträge über Gründung der EG und der EU von Maastricht 1993, beziehungsweise ihre Nachfolgeverträge von Amsterdam 1999 und Nizza 2001. In der Zeit vom 28.02.2002 bis zum 10.07.2003 sollte ein Konvent unter Beteiligung aller fünfzehn Mitgliedstaaten sowie den damaligen zehn Beitrittskandidaten, „[…] die wesentlichen Fragen […] prüfen, welche die künftige Entwicklung der Union aufwirft, und sich um verschiedene mögliche Antworten […] bemühen.“ Eine Vereinfachung, möglicherweise Zusammenfassung, der bisherigen Verträge sollte angedacht werden. Statt jedoch nur seine Aufgabe zu erfüllen, also eine Agenda aufzustellen und bereits mögliche Lösungen vorzustellen, entwickelte sich der Konvent unter Leitung von Valery Giscard d’Estaing zu einem Gremium, das schon bald grundlegende Arbeiten an einem neuen Gemeinschaftsvertrag leistete. Das Endprodukt, der Entwurf eines Vertrages über eine Verfassung für Europa wurde am 18. Juli dem Präsidenten des Europäischen Rates in Rom überreicht. Das Werk wurde allerdings nicht in vorliegender Form angenommen, da letztlich einige Regierungen ihre nationalstaatlichen Interessen verstärkt sehen wollten und deshalb einen Aufschub erwirkten. Nach einigen Änderungen wurde der Entwurf am 29. Oktober 2004 erneut vorgelegt und diesmal verabschiedet. Nun ist es an den Bürgern und Parlamenten der einzelnen Mitgliedstaaten, dem Vertrag zuzustimmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Historischer Kontext
- Von der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft zur Europäischen Politischen Zusammenarbeit
- Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik im Spiegel von Maastricht, Amsterdam und Nizza
- Der Vertrag über eine Verfassung für Europa vom 29. Oktober 2004
- Der Diskurs im Konvent
- Die Artikel betreffend Sicherheits- und Verteidigungspolitik
- Allgemeine Bestimmungen
- Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (Art. 16)
- Besondere Bestimmungen der GASP und ESVP (Art. 40 – 41)
- Sicherheitspolitischer Fortschritt oder militaristischer Rückschritt?
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob die Europäische Union durch den Vertrag über eine Verfassung für Europa zu einer Großmacht mit signifikanter militärischer Stärke wird. Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik vom Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart, wobei der Fokus auf der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) liegt. Sie untersucht zudem die relevanten Artikel des Verfassungsvertrages und analysiert die potenziellen Auswirkungen auf die Rolle der EU in der Welt.
- Entwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
- Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
- Der Vertrag über eine Verfassung für Europa
- Sicherheitspolitischer Fortschritt oder Militarisierung?
- Analyse der Standpunkte von einzelnen Staaten und NGOs
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Fragestellung: Diese Einleitung beleuchtet die zentrale Frage, ob die Europäische Union durch den Vertrag über eine Verfassung für Europa zu einer militärischen Großmacht aufsteigt. Sie argumentiert, dass die militärische Handlungsfähigkeit für die EU essentiell ist, um als "Global Player" eine bedeutende Rolle einzunehmen.
- Historischer Kontext: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. Es untersucht die Herausforderungen und Chancen, die sich aus dem Kalten Krieg und der Integration Deutschlands ergaben, und beleuchtet die Entstehung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, der Europäischen Politischen Zusammenarbeit und schließlich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP).
- Der Vertrag über eine Verfassung für Europa vom 29. Oktober 2004: Dieses Kapitel analysiert den Vertrag über eine Verfassung für Europa und seine Relevanz für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. Es konzentriert sich auf die Artikel, die sich mit der GASP befassen, insbesondere auf die Artikel 16, 40 und 41.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie der europäischen Integration, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Europäische Verfassung, militärische Macht, Global Player, und den Auswirkungen der europäischen Integration auf die Rolle der EU in der Welt.
- Quote paper
- B.A. Stephan Mehlhorn (Author), 2005, Der Vertrag über eine Verfassung für Europa - Die Artikel 16, 40 und 41 als Begründung der Militärmacht Europa?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52475