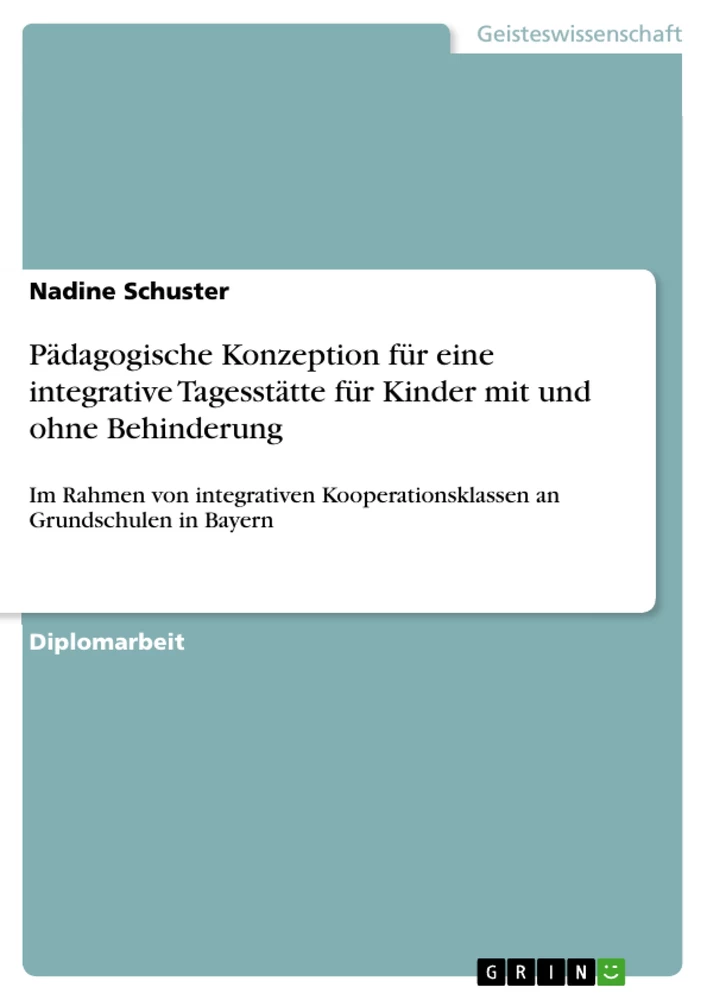Die Idee für das Thema „Entwurf einer pädagogischen Konzeption einer integrativen Tagesstätte für Kinder mit und ohne Behinderung im Rahmen von Integrativen Kooperationsklassen an Grundschulen in Bayern“ entwickelte sich im Zusammenhang mit meinem Praktikum in einer Integrativen Kooperationsklasse an der Melchior-Franck-Schule in Coburg und der dort angeschlossenen Tagesstätte.
Immer wieder habe ich während meiner Arbeit in der Integrativen Kooperationsklasse Begriffe gehört wie Behinderung und Nichtbehinderung, Integration und Ausgrenzung, normal und behindert. Je mehr ich mich mit diesen Themen auseinander setzte, desto mehr Fragen ergaben sich: „Was steckt eigentlich hinter diesen Begrifflichkeiten? Warum ist die Auseinandersetzung mit Definitionen und bestehenden Gesetzen von so großer Bedeutung? Warum schult man nicht einfach alle Kinder gemeinsam in eine Schule ein? Welches ist denn nun der „richtige“ Weg der Integration?“
Ich spüre oft die Angst und Unsicherheit, wenn ich mit Freunden über Behinderung spreche bzw. sie mit Menschen mit Behinderung persönlich konfrontiert werden. Wiederholt bekam ich zu Ohren: „Wieso Integration? – Die sind nun mal nicht die Norm, also sind sie doch in ihren Sondereinrichtungen besser aufgehoben.“
Während des Praktikums in der ‚Integrativen Kooperationsklasse’ von September 2002 bis März 2003 beobachtete ich, wie die Kinder nach anfänglicher Unsicherheit mehr und mehr ohne Scheu miteinander agierten. Dies hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck. Wenn die Kinder in der Lage sind derart unbefangen mit dem jeweils „Anderen“ umzugehen, warum bereitet uns dann die Frage nach der Notwendigkeit von Integration überhaupt Kopfzerbrechen?
Ziel meiner Arbeit ist es, die Problematiken von Integration zu erörtern und zu analysieren sowie Wege einer gelingenden Integration aufzuzeigen, um schließlich mit dem Entwurf einer pädagogischen Konzeption die Grundlage für professionelles integratives Arbeiten zu schaffen.
Ich möchte in diesem Sinne versuchen, eine pädagogische Konzeption zu entwickeln, welche die integrative Arbeit in der heilpädagogischen Tagesstätte an der Melchior-Franck-Schule ermöglicht. Sie soll den Mitarbeitern als Grundlage für ihre pädagogische Arbeit dienen und ihnen Orientierung und Sicherheit geben.Durch eine mögliche praktische Umsetzung der Konzeption möchte ich dazu beitragen, dass Unterrichtsschluss nicht zwangsläufig „Integrationsschluss“ sein muss.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 BEGRIFFSKLÄRUNG
- 2.1 Konzept versus Konzeption
- 2.2 Behinderungsbegriffe und ihre Integrationsrelevanz
- 2.2.1 Der medizinische Behinderungsbegriff
- 2.2.2 Der erziehungswissenschaftliche Behinderungsbegriff
- 2.2.3 Das normative Verständnis von Behinderung
- 2.2.4 Behinderung als „Systemfolge"
- 2.2.5 Auswirkungen auf die Integration
- 2.3 Integration: Ein Begriff – viele Bedeutungen
- 2.3.1 Allgemeines
- 2.3.2 Ulrich Bleidicks Operationalisierung des Integrationsbegriffs
- 2.3.3 Die sieben Gegensatzpaare von Emil E. Kobi
- 2.3.4 Georg Feusers Integrationsdefinition
- 2.3.5 Weitere Definitionsversuche
- 2.3.6 Neue Begriffe für ein „in die Jahre gekommenes“ Thema
- 2.3.7 Abschließende Gedanken
- 3 VON DER VERGANGENHEIT ZUR GEGENWART: DIE ENTWICKLUNG DER
INTEGRATION VON KINDERN UND JUGENDLICHEN MIT UND OHNE
BEHINDERUNG
- 3.1 Wurzeln des Integrationsgedankens
- 3.2 Historischer Abriss
- 3.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
- 3.3.1 Gegenwärtiger Stand der Integrationsbemühungen
- 3.3.2 Von der Integration zur Inklusion
- 3.3.3 Gegenströmung: Förderung der Elite
- 3.3.4 Eine allgemeine (integrative) Pädagogik
- 3.4 Abschließende Gedanken
- 4 FORMEN INTEGRATIVEN ARBEitens mit KindeRN UND JUGENDLICHEN
- 4.1 Grundsätze und Prinzipien von Integration
- 4.2 Gemeinsame Erziehung im Elementarbereich
- 4.2.1 Allgemeines
- 4.2.2 Die Grundformen der Erziehung im Elementarbereich
- 4.2.3 Richtungen der Konzeptentwicklung gemeinsamer Erziehung im Elementarbereich
- 4.3 Gemeinsame Erziehung im Sekundarbereich
- 4.3.1 Allgemeines
- 4.3.2 Möglichkeiten schulischer Integration nach Empfehlung des deutschen Bil- dungsrates von 1973
- 4.3.3 Formen schulischer Integration
- 4.3.4 Organisationsformen schulischer Integration
- 4.3.5 Erfahrungsberichte: Schwierigkeiten und Chancen schulischer Integration im Anschluss an die Grundschulzeit
- 4.4 Integrative Freizeitangebote
- 5 MÖGLICHKEITEN DER ÜBERTRAGUNG VON BESTEHENDEN KONZEPTEN FÜR
BETREUUNGEN AM NACHMITTAg auf Integrative KooperatIONSKLASSEN
AN GRUNDSCHULEN IN BAYERN
- 5.1 Das Konzept der Integrativen Kooperationsklasse
- 5.1.1 Allgemeines
- 5.1.2 Das Coburger Modell
- 5.2 Konzepte der Nachmittagsbetreuung von Schüler/innen der Integra-
tiven Kooperationsklassen in bayerischen Grundschulen
- 5.2.1 Allgemeines
- 5.2.2 Betreuung am Wohnort
- 5.2.3 Mittagsbetreuung an Volksschulen
- 5.2.4 Heilpädagogische Tagesstätten der Schulen zur individuellen Lebensbewäl- tigung nach dem Rahmenplan der Diakonie
- 5.2.5 Kindertageseinrichtungen am Beispiel „Hort"
- 5.2.6 Ganztagsschule
- 5.3 Das Für und Wider vorhandener Konzepte
- 5.4 Abschließende Gedanken
- 5.1 Das Konzept der Integrativen Kooperationsklasse
- 6 ENTWURF EINER PÄDAGOGISCHEN KONZEPTION FÜR EINE INTEGRATIVE
TAGESSTÄTTE FÜR KINDER MIT UND OHNE BEHINDERUNG IM RAHMEN VON
INTEGRATIVEN KOOPERATIONSKLASSEN AN Grundschulen IN BAYERN
- 6.1 Vorwort
- 6.2 Grundlagen zum Thema
- 6.3 Leitbild der Einrichtung
- 6.4 Strukturen der Einrichtung
- 6.4.1 Träger
- 6.4.2 Gesetzliche Grundlagen
- 6.4.3 Finanzierung
- 6.4.4 Personelle Besetzung
- 6.4.5 Gruppenzusammensetzung
- 6.4.6 Lage
- 6.4.7 Räumlichkeiten
- 6.4.8 Öffnungszeiten
- 6.5 Zielgruppe
- 6.6 Zielsetzung
- 6.7 Pädagogische Grundgedanken und Methoden
- 6.7.1 Tagesablauf
- 6.7.2 Mittagstisch
- 6.7.3 Hausaufgabenbetreuung
- 6.7.4 Freizeitgestaltung
- 6.7.5 Arbeit mit dem Kind
- 6.7.6 Gestaltung des Gruppenraumes
- 6.7.7 Aufgaben der Mitarbeiter
- 6.7.8 Teamarbeit
- 6.7.9 Therapie und therapieunterstützende Arbeit
- 6.7.10 Elternarbeit
- 6.8 Vernetzungsarbeit
- 6.8.1 Zusammenarbeit mit der Grundschule
- 6.8.2 Zusammenarbeit mit der Förderschule
- 6.8.3 Zusammenarbeit mit den Therapeuten
- 6.8.4 Kooperation mit den Kindergärten
- 6.9 Gemeinwesen- und Öffentlichkeitsarbeit
- 6.10 Qualitätssicherung
- 6.11 Nachwort
- 7 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das vorliegende Werk widmet sich der Integration von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung. Es analysiert die Entwicklung des Integrationsgedankens, beleuchtet verschiedene Integrationsmodelle und untersucht die Möglichkeiten der Umsetzung integrativer Konzepte in der Praxis.
- Begriffsdefinitionen von Behinderung und Integration
- Historische Entwicklung der Integration von Kindern und Jugendlichen
- Aktuelle Trends und Herausforderungen in der Integration
- Formen integrativen Arbeitens im Elementar- und Sekundarbereich
- Konzepte für integrative Tagesstätten im Rahmen von Kooperationsklassen an Grundschulen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Klärung der Begriffe Behinderung und Integration. Es werden verschiedene Definitionen und Perspektiven auf diese Themen beleuchtet.
Kapitel 3 gibt einen historischen Überblick über die Entwicklung des Integrationsgedankens, von den Ursprüngen bis hin zu den aktuellen Trends und Entwicklungen.
Kapitel 4 präsentiert verschiedene Formen integrativen Arbeitens mit Kindern und Jugendlichen, sowohl im Elementar- als auch im Sekundarbereich.
Kapitel 5 untersucht die Möglichkeiten der Übertragung bestehender Konzepte für Betreuungen am Nachmittag auf Integrative Kooperationsklassen an Grundschulen in Bayern. Es werden verschiedene Modelle und ihre Vor- und Nachteile beleuchtet.
Kapitel 6 widmet sich dem Entwurf einer pädagogischen Konzeption für eine integrative Tagesstätte für Kinder mit und ohne Behinderung im Rahmen von Integrativen Kooperationsklassen an Grundschulen in Bayern. Es werden die Ziele, Strukturen, pädagogischen Grundgedanken und die Vernetzungsarbeit der Einrichtung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Integration, Inklusion, Behinderung, Sonderpädagogik, Elementarbereich, Sekundarbereich, Schulische Integration, Integrative Kooperationsklasse, Tagesstätte, pädagogische Konzeption, Bayern.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Inklusion?
Integration bedeutet die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in bestehende Strukturen. Inklusion geht weiter und fordert, dass das System von vornherein so gestaltet ist, dass alle Menschen ohne Barrieren teilhaben können.
Was zeichnet eine integrative Tagesstätte aus?
Sie bietet eine gemeinsame Betreuung und Förderung für Kinder mit und ohne Behinderung, wobei heilpädagogische Fachkräfte und Therapeuten eng mit dem pädagogischen Personal zusammenarbeiten.
Was ist das "Coburger Modell" der Kooperationsklasse?
Es ist ein spezifisches Modell in Bayern, bei dem Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemeinsam mit Kindern ohne Förderbedarf in einer Grundschulklasse unterrichtet und nachmittags betreut werden.
Welche Rolle spielt die Architektur in einer integrativen Einrichtung?
Räumlichkeiten müssen barrierefrei sein und Rückzugsmöglichkeiten sowie Therapieräume bieten, um den unterschiedlichen Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden.
Warum ist Elternarbeit in integrativen Konzepten so wichtig?
Eltern von Kindern mit Behinderung benötigen oft besondere Unterstützung und Beratung, während der Austausch zwischen allen Eltern Vorurteile abbaut und die Gemeinschaft stärkt.
- Citar trabajo
- Dipl.-Sozialpäd. Nadine Schuster (Autor), 2004, Pädagogische Konzeption für eine integrative Tagesstätte für Kinder mit und ohne Behinderung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52367