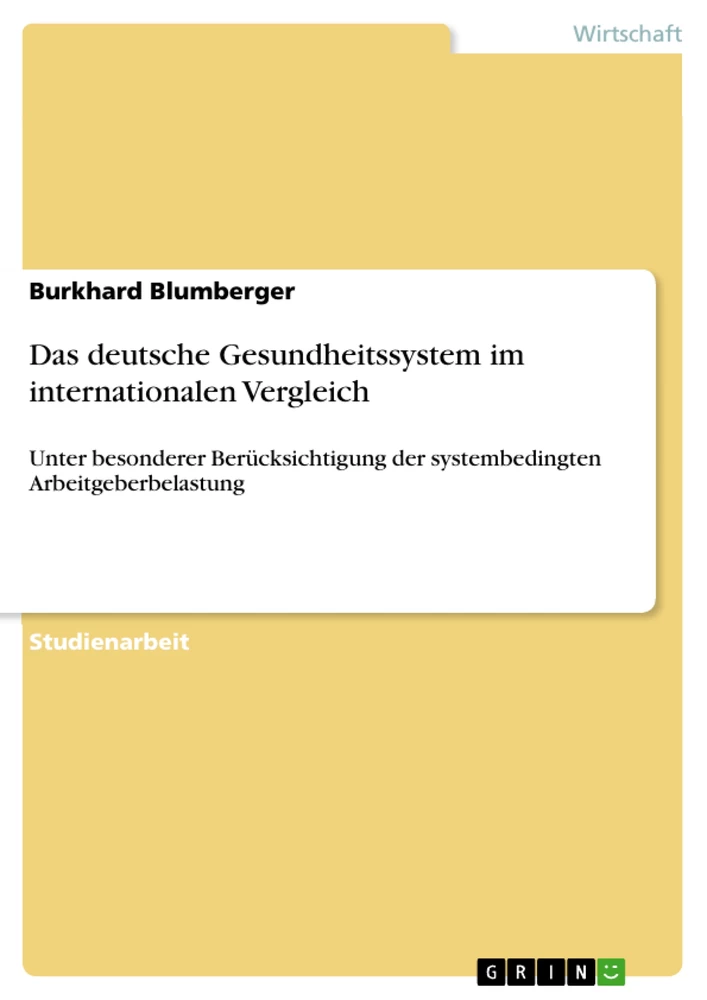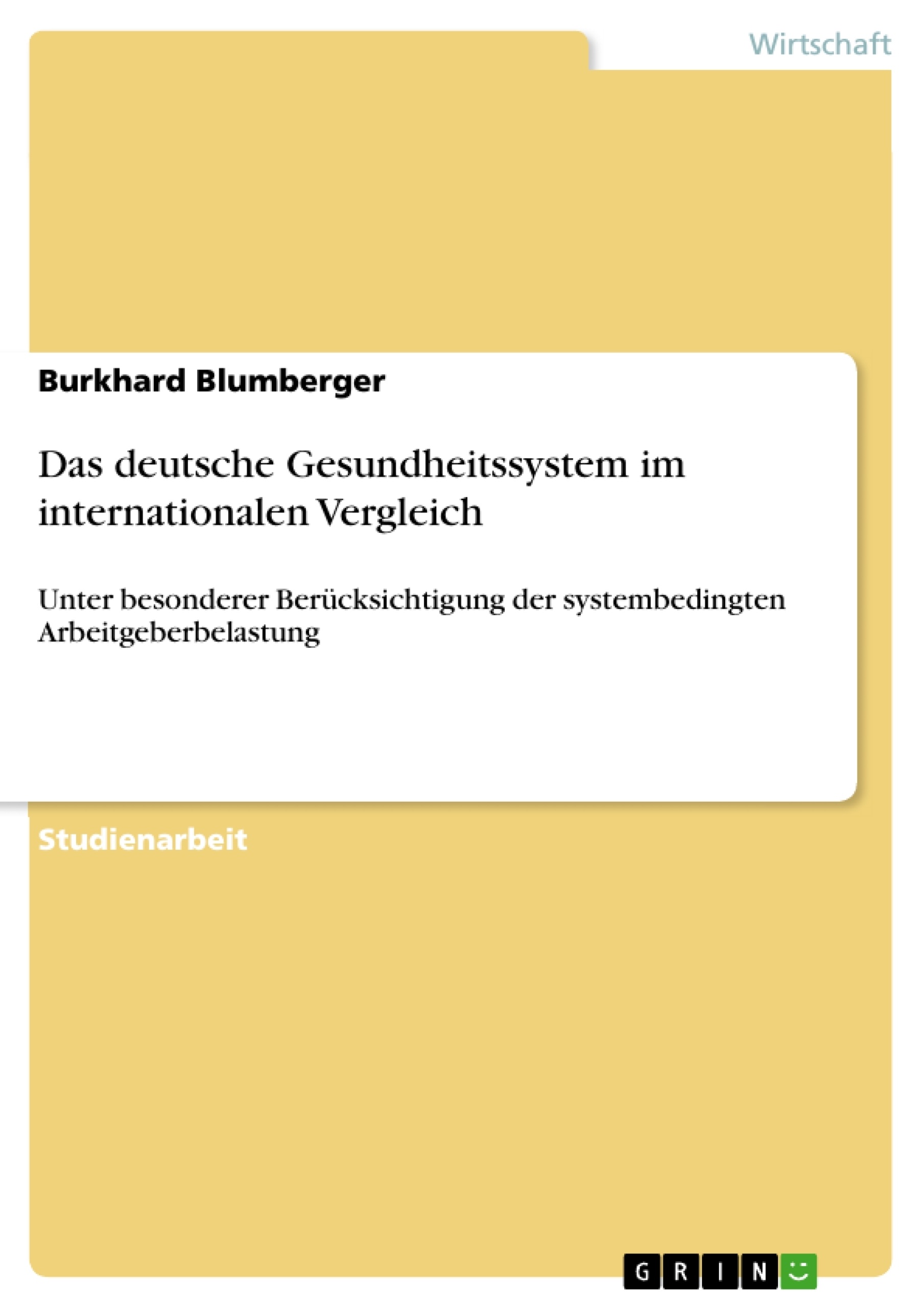Neben anderen Reformvorhaben steht auf der Agenda der neuen Bundesregierung eine Reorganisation des deutschen Gesundheitssystems. Vor allem die Finanzierung steht im Vordergrund der Bestrebungen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Es gilt, die Finanzierung des derzeitigen Modells aus privater und gesetzlicher Krankenversicherung langfristig auf ein solides und gleichsam sozialverträgliches Fundament zu stellen – eine grundlegende Modifizierung der Einnahme- und Ausgabepolitik ist geboten.
Alternativ werden aber auch andere Grundkonzepte diskutiert. Dies ist in erster Linie das Modell der „Kopfpauschale“, auch als „Gesundheitsprämie“ bezeichnet, sowie die sogenannte „Bürgerversicherung“. Diese und andere Reformvorschläge sind dabei keineswegs eindeutig und abschließend definiert. Selbst innerhalb der Parteien und diversen Interessengruppen existieren unterschiedliche Auffassungen über Inhalt und Struktur der Varianten sowie nicht zuletzt über den Modus Operandi.
Inhaltsverzeichnis
Bibliografische Beschreibung
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Probleme und Reformen in Gesundheitssystemen
1.1 Anlass
1.2 Intention und Methode
2 Grundlagen
2.1 Gesundheitssysteme
2.2 Das deutsche Gesundheitssystem
2.2.1 Krankenversicherung – Organisation und gesetzliche Grundlagen
2.2.2 Versicherungspflicht
3 Internationaler Vergleich von Gesundheitssystemen
3.1 Typisierung
3.2 Ziele
3.3 Reformen
3.4 Leistungskatalog
3.5 Kostenbeteiligung
3.6 Staatliche Steuerung
3.7 Qualität
4 Arbeitgeberbelastung durch gesundheitssystembedingte Kosten
5 Reformoption Bürgerversicherung
6 Zusammenfassung und Resümee
Literaturverzeichnis
Erklärung
Bibliografische Beschreibung
Name, Vorname: Blumberger, Burkhard
Thema der Hausarbeit: Das deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich – unter besonderer Berücksichtigung der systembedingten Arbeitgeberbelastung
2005/36 Seiten/1 Tabelle/11 Abbildungen/1 CD-ROM
Bernburg: Hochschule Anhalt (FH) Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachbereich Landwirtschaft/Ökotrophologie/ Landespflege – Hausarbeit
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 3-1: Kosten des Gesundheitswesens in Relation zum Bruttoinlandsprodukt
Abbildung 3-2: Kosten des Gesundheitswesens im internationalen Vergleich pro Kopf
Abbildung 4-1: Elemente der gesundheitssystembedingten Belastung der Arbeitgeber
Abbildung 4-2: Arbeitgeberanteil an den Gesundheitsausgaben
Abbildung 4-3: Gesundheitssystembedingte Belastung der Arbeitgeber pro Beschäftigtem
Abbildung 4-4: Gesundheitssystembedingte Belastung der Arbeitgeber bezüglich des Produktionswertes
Abbildung 4-5: Gesundheitssystembedingte Belastung der Arbeitgeber bezüglich der Arbeitskosten
Abbildung 4-6: Variation der Arbeitskosten pro Beschäftigtem
Abbildung 4-7: Variation der gesundheitssystembedingten Belastung der Arbeitgeber pro Beschäftigtem
Abbildung 4-8: Variation der Beschäftigung
Abbildung 5-1:Beziehung zw. Lohnzurückhaltung und Beschäftigungszuwachs
Tabellenverzeichnis
Tabelle 3-1: Daten zum Gesundheitswesen europäischer Staaten
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Länderkürzel
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Probleme und Reformen in Gesundheitssystemen
Neben anderen Reformvorhaben steht auf der Agenda der neuen Bundesregierung eine Reorganisation des deutschen Gesundheitssystems. Vor allem die Finanzierung steht im Vordergrund der Bestrebungen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Es gilt, die Finanzierung des derzeitigen Modells aus privater und gesetzlicher Krankenversicherung langfristig auf ein solides und gleichsam sozialverträgliches Fundament zu stellen – eine grundlegende Modifizierung der Einnahme- und Ausgabepolitik ist geboten.
Alternativ werden aber auch andere Grundkonzepte diskutiert. Dies ist in erster Linie das Modell der „Kopfpauschale“, auch als „Gesundheitsprämie“ bezeichnet, sowie die sogenannte „Bürgerversicherung“. Diese und andere Reformvorschläge sind dabei keineswegs eindeutig und abschließend definiert. Selbst innerhalb der Parteien und diversen Interessengruppen existieren unterschiedliche Auffassungen über Inhalt und Struktur der Varianten sowie nicht zuletzt über den Modus Operandi.
1.1 Anlass
Zunächst stellt sich die Frage, welche Faktoren die Krise des deutschen Gesundheitswesens ausgelöst haben. Wesentliches Element ist die demographische Entwicklung. Die Ausgaben der Sozialversicherung müssen in der Masse durch Beiträge von privaten Haushalten, Unternehmen und dem Staat finanziert und gedeckt werden – aber seit den 60er Jahren sinkt die Geburtenrate und damit das Bevölkerungswachstum. Gleichzeitig nimmt die durchschnittliche Lebenserwartung der Bundesbürger konstant zu. „Es fehlen die Beitragszahler“ – um es salopp auszudrücken. Es entsteht eine Diskrepanz einerseits zwischen der unausbleiblichen Zunahme von Ausgaben und Kosten, der andererseits eine parallele Einnahmeregression gegenübersteht. Verschärft wird diese Situation durch eine anhaltend hohe Arbeitslosenquote, neuartige Formen der Beschäftigung und in gewisser Weise auch durch den medizinisch-technischen Fortschritt. Die Kompensierung der Finanzierungsengpässe respektive Einnahmeausfälle im Sozialversicherungswesen wurde bislang über Beitragssatzerhöhungen zu praktizieren versucht. Diese Handhabe trägt nicht zur Lösung des ursächlichen Budgetproblems bei. Zudem ergeben sich steigende Arbeitskosten, die dem im globalen Wettbewerb konkurrierenden Wirtschaftsstandort Deutschland abträglich sind.
1.2 Intention und Methode
Nicht nur Deutschland hat sich den oben beschriebenen Phänomen zu stellen. Im Grunde standen oder stehen alle westlichen Industrienationen vor ähnlich mitunter tiefgreifenden Veränderungen ihrer Gesundheitspolitik. Deren Unverzichtbarkeit ist allein schon mit dem Faktum zu begründen, dass ein solides Gesundheitssystem für die Leistungsfähigkeit einer modernen Industriegesellschaft von elementarer Bedeutung ist. Vor diesem Hintergrund erscheint es angebracht, die Gesundheitssysteme anderer Staaten zu analysieren. Die gewonnenen Erkenntnisse können bei der Diskussion über mögliche konzeptionelle Veränderungen und Adaptionen in Deutschland hilfreich sein. Die Reflexion der Erfahrungen anderer Staaten, welche ihr System reformiert haben, macht es möglich, Fehler zu vermeiden und erfolgreiche Ansätze zu übertragen – frei nach dem Motto „was wir noch diskutieren, haben andere bereits realisiert“ (und das mehr oder weniger erfolgreich).
Voraussetzung für einen sachdienlichen Diskurs sind Basisfachkenntnisse. Dementsprechend folgt im Anschluss an dieses Kapitel eine Darlegung wesentlicher Grundlagen zu Gesundheitssystemen im Allgemeinen. Dabei findet die Abbildung des deutschen Systems besondere Berücksichtigung. Darauf aufbauend werden im dritten Kapitel die Gesundheitssysteme ausgewählter Staaten einem synoptischen Vergleich unterzogen. Die Arbeitgeber stehen im Vordergrund der nachfolgenden Abschnitte. Sonach konzentriert sich das vierte Kapitel auf die gesundheitssystembedingten Kosten der Arbeitgeber. In Entsprechung zur aktuellen Reformdebatte werden die Auswirkungen des exemplarisch vorgestellten Modells „Bürgerversicherung“ auf Arbeitgeber und Beschäftigung im fünften Kapitel erörtert. Die Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Resümee im sechsten und damit letzten Passus bringen diese Hausarbeit zum Abschluss.
2 Grundlagen
In diesem Kapitel werden zunächst grundlegende Aspekte von Gesundheitssystemen im Allgemeinen betrachtet. Die Darstellung des deutschen Modells folgt im Anschluss.
2.1 Gesundheitssysteme
Per definitionem umfasst ein Gesundheitssystem (Gesundheitswesen) eines Staates alle Personen, Organisationen, Einrichtungen, Regelungen und Prozesse, deren Aufgabe die Förderung und Erhaltung der Gesundheit respektive die Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten und Verletzungen ist. Die übergeordnete Zielsetzung besteht in einem vorzugsweise paritätischen Zugang für alle Bürger, Qualität, Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit sowie nicht zuletzt der Zufriedenheit der Patienten und des medizinischen Personals. Im Hinblick auf eine Typisierung von Gesundheitssystemen ist die Finanzierungskonzeption als wesentliches Element anzusehen. Sie gilt als zentrales politisches Steuerungsinstrument. Für den Bereich der OECD-Länder[1] lässt sich die folgende dreiteilige Gliederung vornehmen:
- Finanzierung über das Steueraufkommen – Typ Nationaler Gesundheitsdienst (Großbritannien, Italien)
- Finanzierung durch Beiträge zu einer gesetzlichen Krankenversicherung/Pflichtversicherung – Typ Sozialversicherung (Deutschland, Frankreich)
- Finanzierung individuell oder durch Beiträge der Arbeitgeber – Typ Privatversicherung (USA)
Nicht immer kann eine eindeutige Zuordnung vorgenommen werden. In einigen Ländern sind Überschneidungen und Mischformen dieser Einteilung gegeben. Eine tiefere Differenzierung zeigt folgende Zuordnung:
- Finanzierung vorrangig aus Steuermitteln (Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Portugal, Schweden)
- Finanzierung nahezu gleichverteilt über Steuermittel und Sozialbeiträge (Griechenland, Italien, Spanien)
- Finanzierung mehrheitlich durch Sozialversicherungsbeiträge (Deutschland, Belgien, Luxemburg)
- Finanzierung annähernd ausschließlich über Sozialversicherungsbeiträge (Frankreich, Niederlande)
Das ambulante Leistungsangebot steht in einer Wechselbeziehung zum Finanzierungskonzept des jeweiligen Gesundheitssystems. Die extramurale Versorgung wird in Deutschland, den Benelux-Ländern und Frankreich in der Mehrheit durch niedergelassene, selbstständige Ärzte vollzogen. Im Gegensatz dazu erfolgt in Dänemark, Finnland, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Schweden, Spanien und Portugal die ambulante Versorgung durch staatliche Gesundheitsdienste.[2]
2.2 Das deutsche Gesundheitssystem
Das deutsche Gesundheitssystem wird von staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen, Einrichtungen und juristischen wie natürlichen Personen getragen. Partizipierende Glieder sind der Staat in Form von Bund, Ländern und Kommunen, Kranken-, Unfall-, Pflege- und Rentenversicherung, Kassenärztliche Vereinigungen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, Interessenverbände sowie die Patienten, diese fallweise vertreten durch Patientenverbände und Selbsthilfeorganisationen. Die medizinische Versorgung erfolgt im weitesten Maße durch freiberufliche Ärzte, Apotheker und Angehörige diverser Heilberufe; ferner durch die pharmazeutische und medizintechnische Industrie. Die Krankenhäuser sind in privater oder gemeinnütziger Trägerschaft. Hier zeigt sich ein Trend zur Privatisierung. Der Staat selbst tritt als Leistungserbringer lediglich sekundär auf. Ihm obliegen die Gesundheitsämter, kommunale Krankenhäuser und Universitätskliniken. Die in Deutschland praktizierte Differenzierung von ambulanter und stationärer Versorgung ist im globalen Vergleich relativ selten vorzufinden. Überdurchschnittlich ist dagegen das Quantum der Ärzte und Fachärzte einschließlich der Zahnärzte, Psychotherapeuten, Pflegekräfte sowie der Bettenplätze in Krankenhäusern; ebenso das der Angehörigen der verschiedenen Heilberufe, Apotheker und deren Personal. Finanziert wird das Gesundheitssystem in Deutschland maßgeblich über paritätisch verteilte Versicherungsbeiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber (partiell Ausnahmen). Eine allgemein gültige Krankenversicherungspflicht besteht nicht.
[...]
[1] Mitgliedsstaaten sind gegenwärtig Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Südkorea, Tschechien, Türkei, Ungarn, USA.
[2] Vgl. ESS-Europe (2005), Internet; Schmid (2002), S. 82ff.
- Quote paper
- Burkhard Blumberger (Author), 2005, Das deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52308