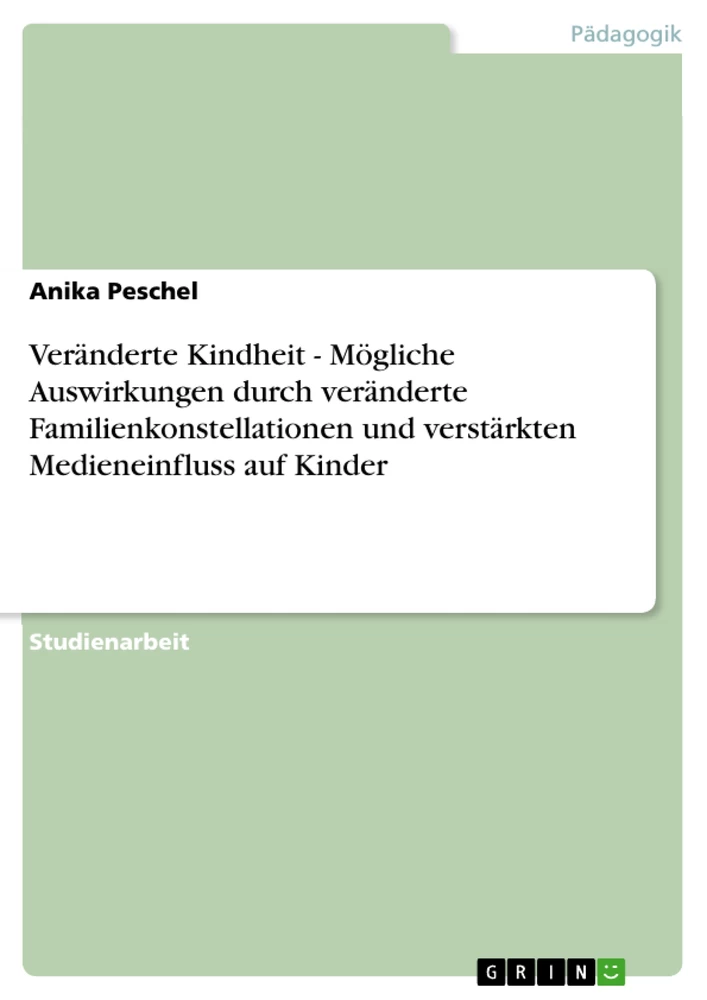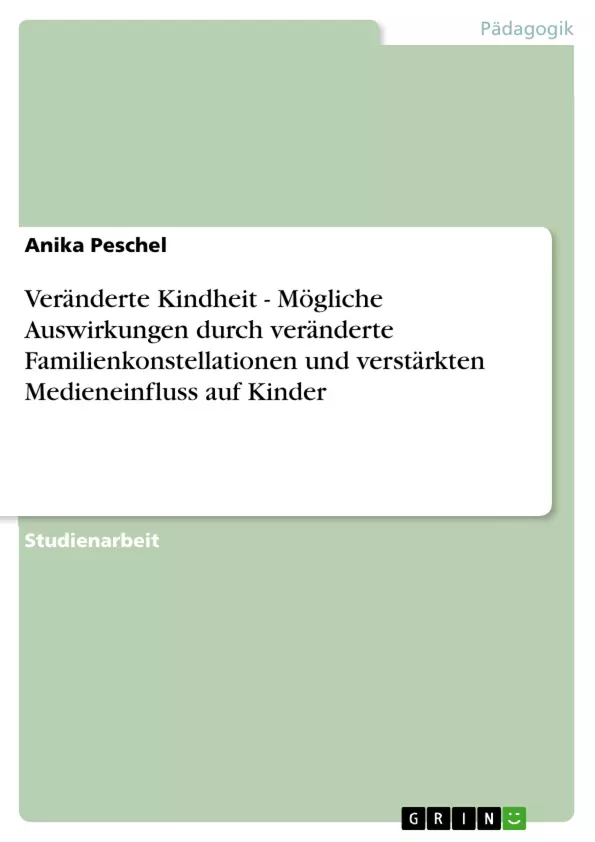Ausgehend von der seit den 80er wieder weit verbreiteten Thesen, die Kindheit verändere sich ständig – und dies meist zum Negativen, was ein Begriff wie „Verlustkindheit“, der z.B. Verluste in sozialen Beziehungen oder möglichen Spielorten beinhaltet, erahnen lassen – und die Schüler seien schwieriger geworden, sollen nachfolgend mögliche Gründe durch empirisch überprüfte Daten und Fakten dargelegt und begründet oder widerlegt werden. Zuvor jedoch soll kurz der Wandel der Auffassung des Lebensabschnittes „Kindheit“ dargestellt werden, dann werden mögliche Veränderungen aufgeführt, die anschließend direkt überprüft und beurteilt werden. „Kindheit“ wird hier hauptsächlich auf die frühe Kindheit (bis 13 Jahre, also vorrangig das Grundschulalter) beschränkt. Auch werden hier hauptsächlich Veränderungen der letzten 20 Jahre angeführt, darüber hinaus wird nur stellenweise zurück geblickt.
Zu überprüfen ist, sofern sich Veränderungen belegen lassen, in wiefern sich diese überhaupt negativ auf die nachfolgende Generation auswirkt. Denn oft werden sie ja als Problembelastungen für Kinder ausgelegt, die sich auch auf den Unterricht (z. B. durch Konzentrationsschwäche, Gewalt und Aggressivität) auswirken sollen.
Für Veränderungen in der Kindheit werden oft noch die gleichen gesellschaftlichen Entwicklungen angeführt, wie vor 20 Jahren (z.B. veränderte Familienkonstellationen und die Medien), in letzter Zeit sind jedoch auch neue (z.B. Krankheitsbelastung und Armut) hinzugekommen. Im Folgenden soll jedoch ausschließlich überprüft werden, inwiefern sich die beständig anhaltend aufgeführten Veränderungen „Veränderte Familienkonstella-tionen“ und der „Zuwachs der Mediennutzung“ auf die Entwicklung des Kindes auswirken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kindheit als gesellschaftliches Konstrukt
- Veränderungen der Familienkonstellationen
- Scheidungsfamilien
- Ein-Eltern-Familien
- Ein-Kind-Familien
- Steigende Mediennutzung
- Radio, Kassette, CD
- Fernseher
- Computer
- Internet
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die These einer sich verändernden Kindheit und deren potenziell negativen Auswirkungen auf Kinder, insbesondere im Grundschulalter. Sie beleuchtet empirisch überprüfbare Daten und Fakten, um mögliche Gründe für beobachtete Veränderungen zu belegen oder zu widerlegen. Der Fokus liegt auf dem Wandel der Auffassung von Kindheit, sowie auf den Einflussfaktoren veränderter Familienkonstellationen und steigender Mediennutzung.
- Wandel des Konstrukts „Kindheit“ im Laufe der Zeit
- Auswirkungen veränderter Familienkonstellationen auf Kinder
- Einfluss steigender Mediennutzung auf die kindliche Entwicklung
- Bewertung der These von negativen Auswirkungen der veränderten Kindheit
- Gegenüberstellung traditioneller und neuer Forschungsansätze zur Kindheitsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sich verändernden Kindheit ein und legt die Forschungsfrage fest: Inwiefern wirken sich die oft als problematisch angesehenen Veränderungen der Kindheit (veränderte Familienkonstellationen und steigender Medienkonsum) tatsächlich negativ auf die Entwicklung von Kindern aus? Die Arbeit kündigt die Vorgehensweise an, die darin besteht, bereits existierende Daten und Fakten zu überprüfen und zu bewerten, und beschränkt sich hauptsächlich auf die letzten 20 Jahre und die frühe Kindheit (bis 13 Jahre).
Kindheit als gesellschaftliches Konstrukt: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel des Verständnisses von Kindheit. Es wird gezeigt, wie sich die Auffassung von Kindheit vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart entwickelt hat, von der frühen Einbeziehung von Kindern in die Erwerbstätigkeit bis hin zum modernen Verständnis von Kindheit als eigenständiges, sozial geprägtes Konstrukt. Die Entstehung der neuen Kindheitsforschung in den 1970er Jahren und deren Fokus auf die Perspektive der Kinder wird hervorgehoben. Der Übergang von einer positiven Betrachtung der Kindheit in den 60er und 70er Jahren hin zur negativen Konnotation, beispielsweise durch den Begriff der "Fernsehkindheit" in den 80er Jahren, wird ebenfalls diskutiert. Die Bedeutung der Einbeziehung der Kinderperspektive in die Forschung, trotz der Einschränkungen durch Interpretation und Fragestellung, wird betont.
Veränderungen der Familienkonstellationen: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss veränderter Familienstrukturen auf Kinder. Obwohl die Familie weiterhin der wichtigste Lebensraum für Kinder ist, wird der Anstieg der Scheidungsraten und die damit verbundenen Veränderungen betrachtet. Es wird jedoch herausgestellt, dass trotz der Zunahme der Scheidungen, der Anteil der betroffenen Kinder prozentual sinkt und dass moderne Forschungsergebnisse die negativen Auswirkungen von Scheidungen auf Kinder relativieren. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von sozialen, kulturellen und ökonomischen Ressourcen und darauf, dass Konflikte in unglücklichen, aber bestehenden Partnerschaften negative Folgen für Kinder eher hervorrufen als die Trennung selbst. Die zunehmende Zahl von Ein-Eltern- und Ein-Kind-Familien wird ebenfalls angesprochen, jedoch ohne detaillierte Ausarbeitung in diesem Abschnitt der Zusammenfassung.
Schlüsselwörter
Kindheit, Kindheitsforschung, Familienstrukturen, Scheidung, Mediennutzung, Medienkonsum, Entwicklungspsychologie, Grundschule, gesellschaftliche Veränderungen, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Text: Veränderte Kindheit
Was ist der allgemeine Inhalt des Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über die Thematik der sich verändernden Kindheit. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf dem Wandel des Kindheitverständnisses, den Auswirkungen veränderter Familienkonstellationen und der steigenden Mediennutzung auf Kinder im Grundschulalter.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Kindheit als gesellschaftliches Konstrukt, Veränderungen der Familienkonstellationen (mit Unterpunkten zu Scheidungs-, Ein-Eltern- und Ein-Kind-Familien), Steigende Mediennutzung (mit Unterpunkten zu Radio, Kassette, CD, Fernsehen, Computer und Internet) und Schluss.
Was ist die zentrale Forschungsfrage des Textes?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern wirken sich die oft als problematisch angesehenen Veränderungen der Kindheit (veränderte Familienkonstellationen und steigender Medienkonsum) tatsächlich negativ auf die Entwicklung von Kindern aus?
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht den Wandel des Konstrukts „Kindheit“, die Auswirkungen veränderter Familienkonstellationen (insbesondere Scheidungen) auf Kinder, den Einfluss steigender Mediennutzung auf die kindliche Entwicklung, die Bewertung der These von negativen Auswirkungen der veränderten Kindheit und die Gegenüberstellung traditioneller und neuer Forschungsansätze zur Kindheitsforschung.
Wie wird der Einfluss veränderter Familienkonstellationen behandelt?
Der Text analysiert den Einfluss veränderter Familienstrukturen, insbesondere den Anstieg der Scheidungsraten. Es wird jedoch betont, dass moderne Forschungsergebnisse die negativen Auswirkungen von Scheidungen relativieren und dass Konflikte in unglücklichen Partnerschaften negative Folgen für Kinder eher hervorrufen als die Trennung selbst. Die Zunahme von Ein-Eltern- und Ein-Kind-Familien wird ebenfalls erwähnt.
Wie wird die steigende Mediennutzung behandelt?
Der Text betrachtet die steigende Mediennutzung von Radio, Kassetten, CDs, Fernsehen, Computern und dem Internet. Der Einfluss dieser Medien auf die kindliche Entwicklung wird untersucht, jedoch ohne detaillierte Ausarbeitung in der Zusammenfassung.
Welche Zeitspanne wird im Text betrachtet?
Der Text konzentriert sich hauptsächlich auf die letzten 20 Jahre und die frühe Kindheit (bis 13 Jahre).
Welche Methode wird im Text angewendet?
Der Text überprüft und bewertet bereits existierende Daten und Fakten, um mögliche Gründe für beobachtete Veränderungen zu belegen oder zu widerlegen. Es handelt sich also um eine empirisch orientierte Untersuchung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Kindheit, Kindheitsforschung, Familienstrukturen, Scheidung, Mediennutzung, Medienkonsum, Entwicklungspsychologie, Grundschule, gesellschaftliche Veränderungen, empirische Forschung.
Welche Perspektive wird in der Kindheitsforschung hervorgehoben?
Der Text betont die Bedeutung der Einbeziehung der Kinderperspektive in die Forschung, obwohl die Einschränkungen durch Interpretation und Fragestellung anerkannt werden.
- Quote paper
- Anika Peschel (Author), 2005, Veränderte Kindheit - Mögliche Auswirkungen durch veränderte Familienkonstellationen und verstärkten Medieneinfluss auf Kinder , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52168