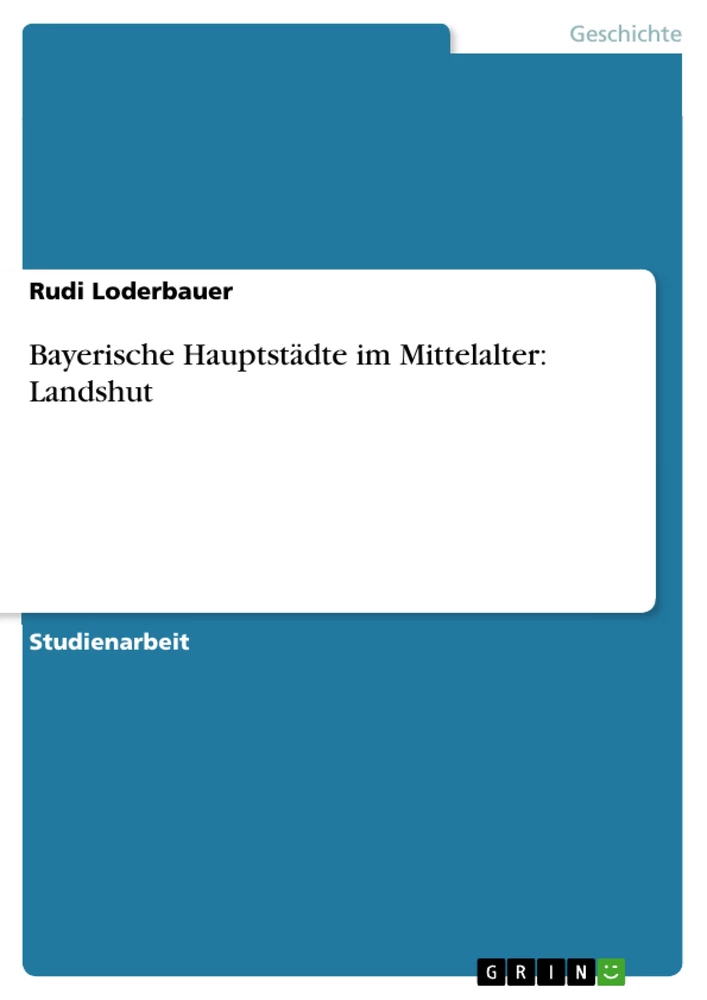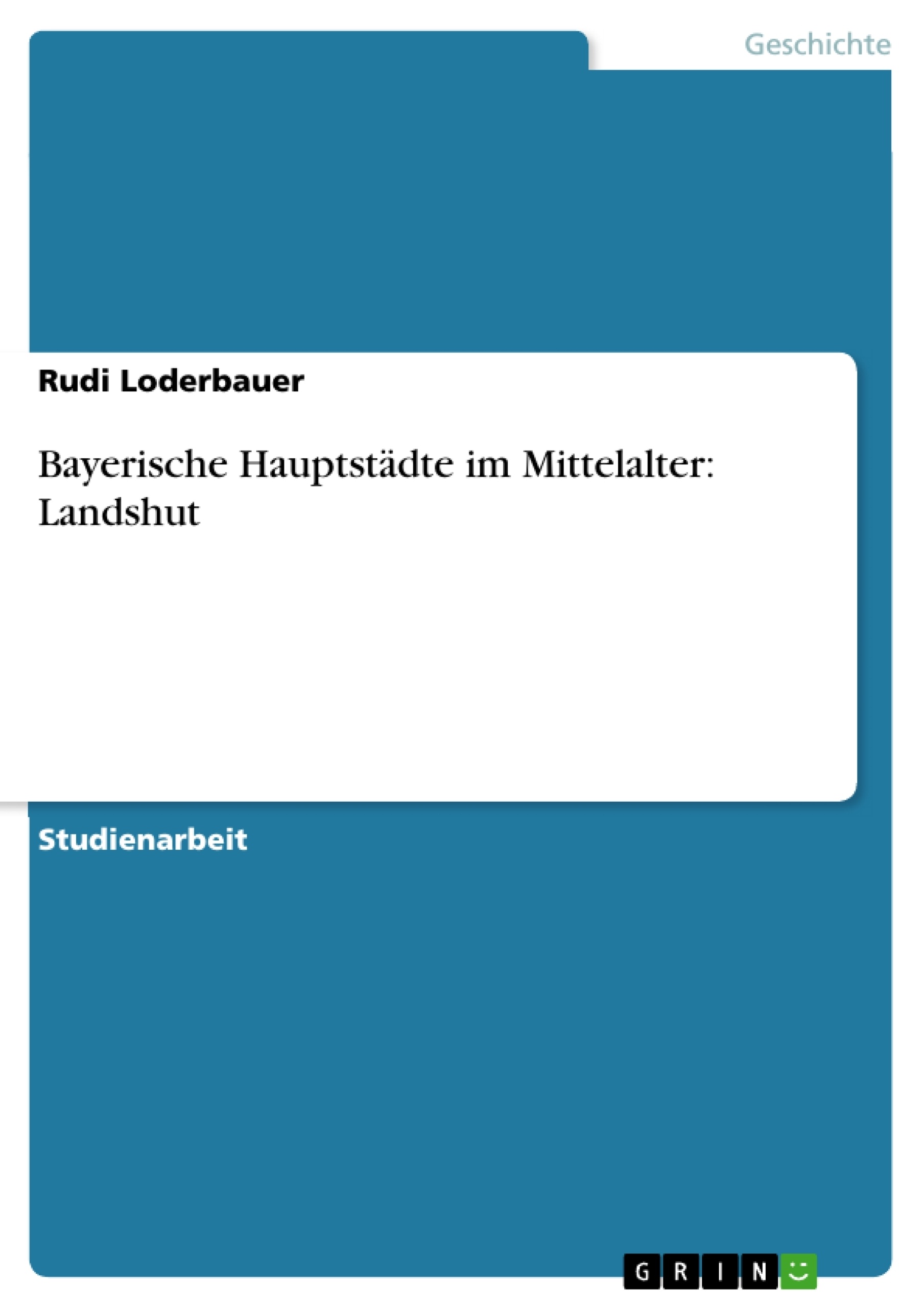Im Rahmen dieser Seminararbeit soll die Entwicklung der Stadt Landshut im Mittelalter seit der Gründung näher beleuchtet werden. Dabei soll insbesondere die bauliche Ausstattung im Rahmen einer wohl durchdachten und klar strukturierten Stadtplanung näher untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Lage und Gründung
- III. Name „Landshut“
- IV. Siegel
- V. Entwicklung
- 1. Anfänge
- 2. Glanzzeit (1392 - 1503)
- VI. Ausstattung
- 1. Grundriss
- 2. Burg Landshut (später Trausnitz) und der Landshuter Hof
- 3. Kirchen
- a) St. Martin
- b) Heilig Geist
- c) St. Jodok
- 4. Klöster
- a) Zisterzienserinnen
- b) Franziskaner
- c) Franziskanerinnen
- d) Dominikaner
- 5. Spitalwesen
- 6. Märkte
- 7. Weitere Verwaltungseinrichtungen in der Stadt
- 8. Künstler und Gelehrte
- VII. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beleuchtet die Entwicklung der Stadt Landshut im Mittelalter seit ihrer Gründung, mit besonderem Fokus auf die städtebauliche Entwicklung und Ausstattung im Kontext einer durchdachten Stadtplanung. Die Arbeit untersucht die Entstehung und Bedeutung Landshuts als Residenzstadt und deren Rolle innerhalb des Herzogtums Bayern.
- Gründung und strategische Lage Landshuts
- Entwicklung der städtischen Infrastruktur und Verwaltung
- Die Bedeutung Landshuts als Residenzstadt innerhalb des Wittelsbacher Herzogtums
- Die Rolle des Bürgertums in der Stadtentwicklung
- Die Bedeutung von Bauwerken und Symbolen (Siegel, Wappen)
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Diese Einleitung beschreibt den Fokus der Seminararbeit: die Erforschung der Entwicklung der Stadt Landshut im Mittelalter, insbesondere im Hinblick auf ihre bauliche Ausstattung und Stadtplanung. Der Autor kündigt eine detaillierte Untersuchung dieser Aspekte an.
II. Lage und Gründung: Dieses Kapitel beschreibt die Gründung Landshuts im Jahr 1204 durch Herzog Ludwig I. als Reaktion auf das schwierige Verhältnis der Wittelsbacher zum Regensburger Bischof. Die strategische Lage an einem wichtigen Isarübergang und an alten Handelsstraßen wird hervorgehoben. Die Zerstörung der Straßburg und der Bau einer neuen Siedlung auf Freisinger Gebiet, um den Einfluss des Regensburger Bischofs zu beschränken, wird detailliert erläutert. Die Gründung Landshuts wird als Teil einer größeren Strategie der Wittelsbacher zur Stärkung ihrer territorialen Macht und Kontrolle über den Handel in der Region gesehen. Der Bau einer romanischen Kirche (St. Martin) als Kern der neuen Siedlung wird erwähnt, sowie die anfängliche administrative Kontrolle durch einen herzoglichen Beauftragten.
III. Name „Landshut“: Das Kapitel erklärt die Bedeutung des Namens „Landshut“ als „sprechenden Namen“, der sich auf den Schutz („Hut“) des Landes bezieht, mit der Burg Trausnitz als zentralem Schutzpunkt. Die frühere Existenz einer hölzernen Bergwarte an gleicher Stelle wird ebenfalls erwähnt, obwohl deren Besitzer unbekannt ist.
IV. Siegel: Dieses Kapitel beschreibt die vier leicht variierenden Stadtsiegel Landshuts aus dem 13. und 14. Jahrhundert, die alle das Dreihelmenwappen tragen. Die These, Kaiser Ludwig der Bayer habe dieses Wappen als Belohnung für Verdienste verliehen, wird anhand eines älteren Nachweises widerlegt. Die Interpretation des Wappens als „redendes Zeichen“, symbolisierend den Schutz („Hut“) des Landes, wird favorisiert. Die Abwesenheit der wittelsbachischen Raute im Landshuter Wappen wird ebenfalls erwähnt, ebenso wie der kürzlich entdeckte Kachelofenrest mit dem Dreihelmenwappen.
V. Entwicklung: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung Landshuts, beginnend mit seiner Rolle als Hauptstadt des Herzogtums Bayern unter den frühen Wittelsbachern. Der Mord an Ludwig I. im Jahr 1231 wird als unwesentlich für die weitere Entwicklung dargestellt. Die Aufteilung des Herzogtums im Jahr 1255 und der Verlust des Status als alleinige Hauptstadt werden beschrieben, ebenso wie die Erlangung der Selbstständigkeit in den 70er Jahren des 13. Jahrhunderts und der Aufbau einer bürgerlichen Verfassung. Das wachsende Bürgertum im 14. Jahrhundert, die Anpassung der städtischen Verfassung, der Einfluss eines Gemeindeausschusses, sowie Rückschläge wie der Tod Heinrichs XIV. und ein großer Stadtbrand, werden besprochen. Die Auswirkungen der Pest von 1348 und die Entwicklung der städtischen Dokumentation (Salbuch, Stadtbuch) und Handwerkerzünfte werden ebenfalls thematisiert. Die Kapitel beschreibt außerdem die Wiedervereinigung Ober- und Niederbayerns unter Stephan II. und die erneute Teilung des Herzogtums im Jahr 1392.
Schlüsselwörter
Landshut, Wittelsbacher, Mittelalter, Stadtgründung, Stadtentwicklung, Residenzstadt, Stadtplanung, Burg Trausnitz, Siegel, Wappen, Dreihelmenwappen, Bürgertum, Herzogtum Bayern, Stadtprivilegien, städtische Verfassung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Entwicklung der Stadt Landshut im Mittelalter
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Entwicklung der Stadt Landshut im Mittelalter, beginnend mit ihrer Gründung bis hin zu ihrer Ausstattung und Stadtplanung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Landshuts Rolle als Residenzstadt innerhalb des Herzogtums Bayern und der Bedeutung des Bürgertums für die Stadtentwicklung.
Wann und von wem wurde Landshut gegründet?
Landshut wurde 1204 von Herzog Ludwig I. gegründet. Die Gründung erfolgte als Reaktion auf die schwierigen Beziehungen der Wittelsbacher zum Regensburger Bischof und nutzte die strategisch günstige Lage an einem wichtigen Isarübergang und alten Handelsstraßen.
Welche strategische Bedeutung hatte die Lage Landshuts?
Die Lage Landshuts an einem wichtigen Isarübergang und an alten Handelsstraßen war von großer strategischer Bedeutung. Die Gründung diente auch dazu, den Einfluss des Regensburger Bischofs einzuschränken.
Was bedeutet der Name „Landshut“?
Der Name „Landshut“ wird als „sprechender Name“ interpretiert, der den Schutz („Hut“) des Landes symbolisiert, wobei die Burg Trausnitz als zentraler Schutzpunkt fungierte.
Welche Bedeutung haben die Stadtsiegel Landshuts?
Landshut besaß im 13. und 14. Jahrhundert vier leicht variierende Stadtsiegel, die alle das Dreihelmenwappen trugen. Dieses Wappen wird als „redendes Zeichen“ interpretiert, das den Schutz des Landes symbolisiert. Die These einer Verleihung durch Kaiser Ludwig den Bayern wird widerlegt.
Wie entwickelte sich Landshut im Laufe des Mittelalters?
Landshut entwickelte sich von einer frühmittelalterlichen Gründung zu einer bedeutenden Residenzstadt. Die Arbeit beschreibt die Anfänge, die Glanzzeit (1392-1503), den Aufstieg des Bürgertums, die Entwicklung der städtischen Verfassung, wirtschaftliche und politische Veränderungen sowie die Auswirkungen von Ereignissen wie der Pest von 1348.
Welche Rolle spielte das Bürgertum in der Stadtentwicklung Landshuts?
Das Bürgertum spielte eine entscheidende Rolle in der Stadtentwicklung Landshuts. Im Laufe des Mittelalters gewann es an Einfluss und trug maßgeblich zur Gestaltung der städtischen Verfassung und des wirtschaftlichen Aufschwungs bei.
Welche Bedeutung hatte Landshut als Residenzstadt?
Landshut war eine wichtige Residenzstadt innerhalb des Wittelsbacher Herzogtums Bayern, obwohl es zeitweise seinen Status als alleinige Hauptstadt verlor. Die Arbeit untersucht die Bedeutung dieser Rolle für die Stadtentwicklung.
Welche Bauwerke und Institutionen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zahlreiche Bauwerke und Institutionen in Landshut, darunter die Burg Trausnitz, den Landshuter Hof, verschiedene Kirchen (St. Martin, Heilig Geist, St. Jodok), Klöster (Zisterzienserinnen, Franziskaner, Franziskanerinnen, Dominikaner), das Spitalwesen, Märkte und weitere Verwaltungseinrichtungen. Der Fokus liegt auf deren Rolle im Kontext der Stadtplanung und -entwicklung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Landshut, Wittelsbacher, Mittelalter, Stadtgründung, Stadtentwicklung, Residenzstadt, Stadtplanung, Burg Trausnitz, Siegel, Wappen, Dreihelmenwappen, Bürgertum, Herzogtum Bayern, Stadtprivilegien, städtische Verfassung.
- Quote paper
- Rudi Loderbauer (Author), 2004, Bayerische Hauptstädte im Mittelalter: Landshut, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/52139